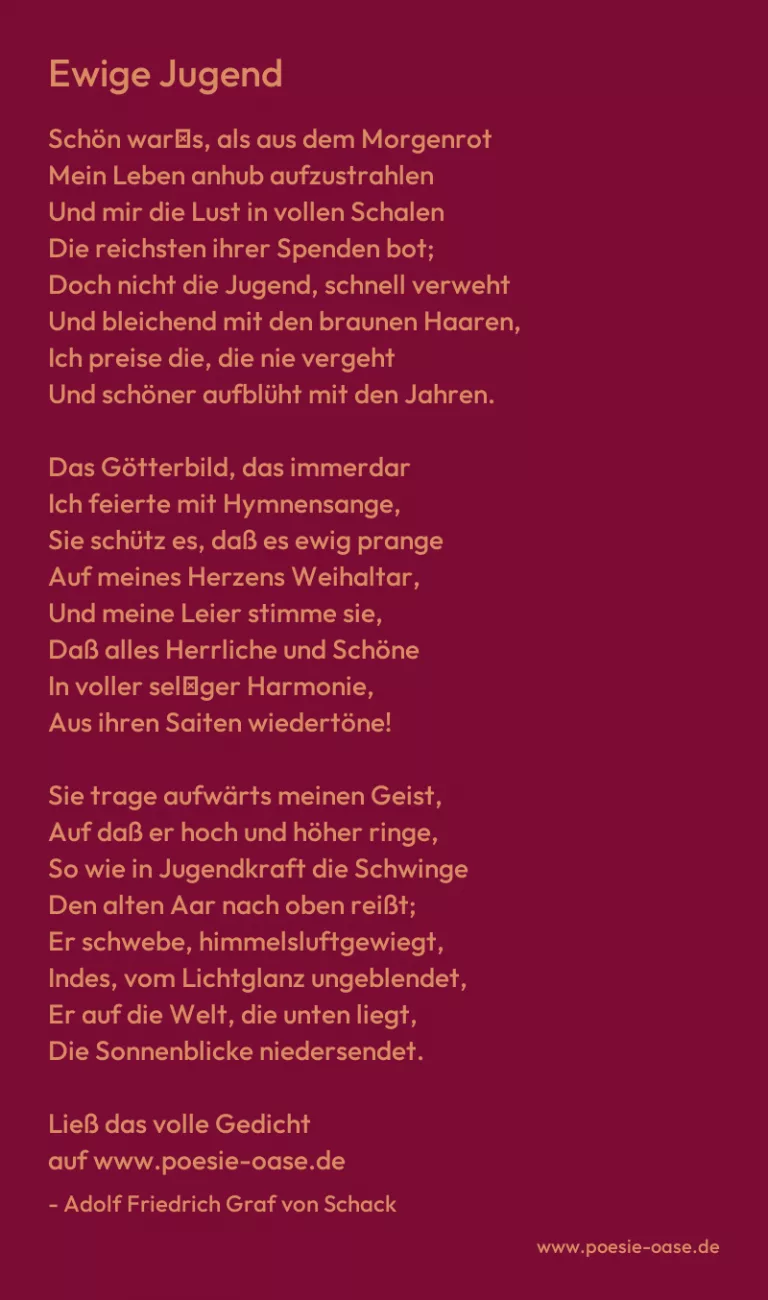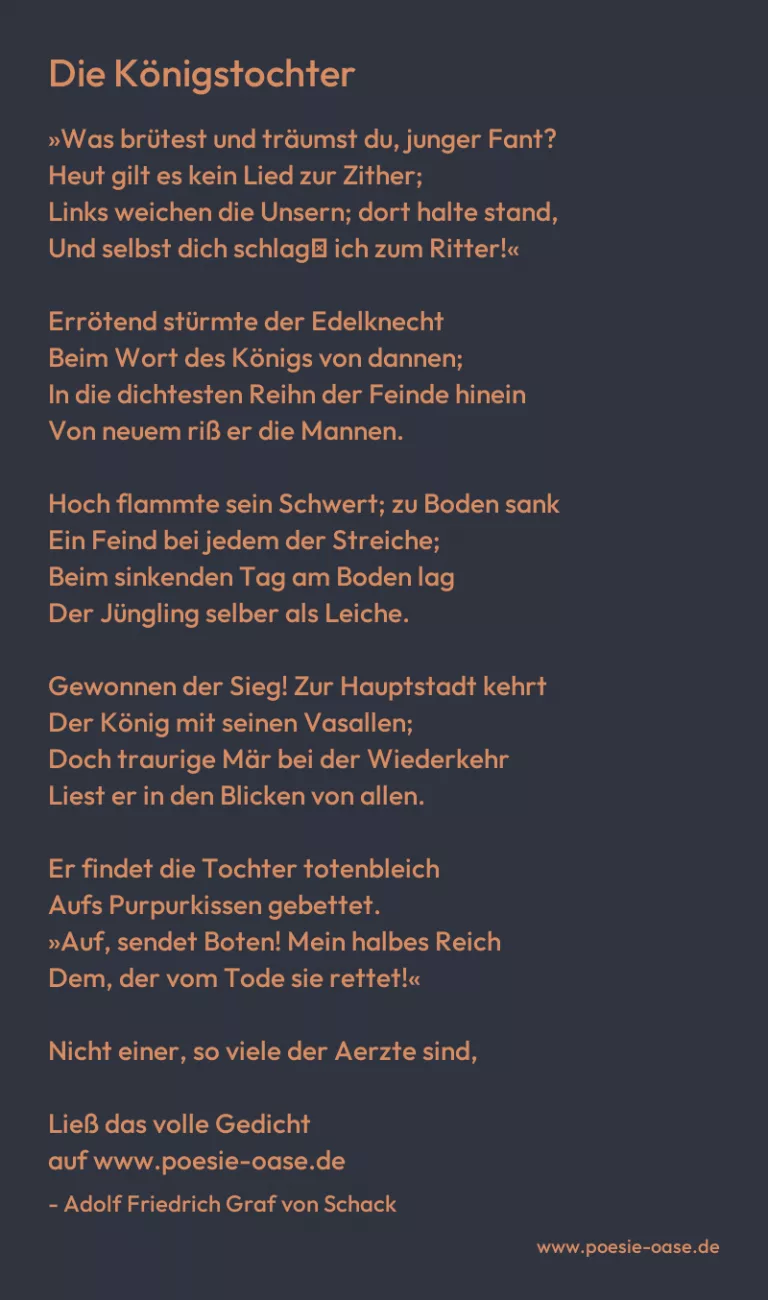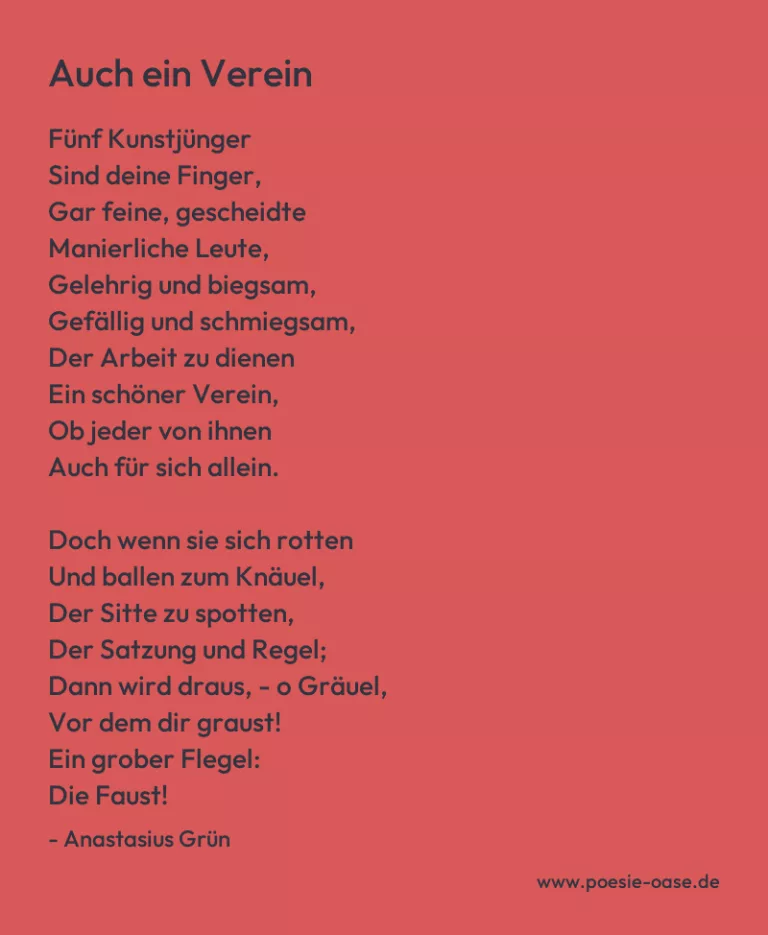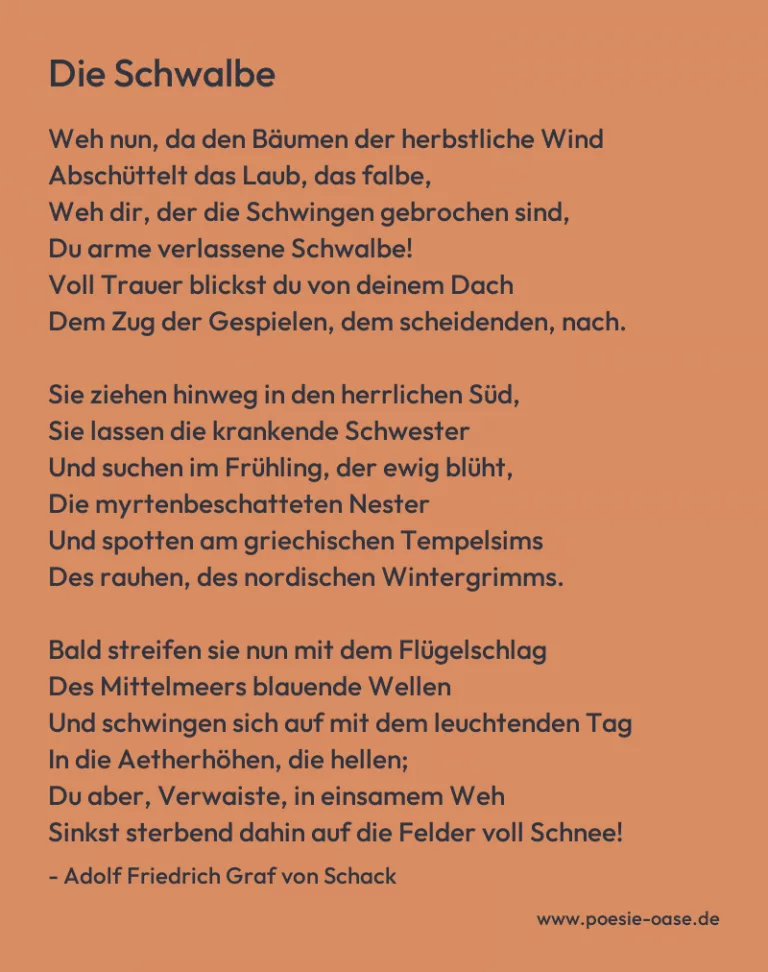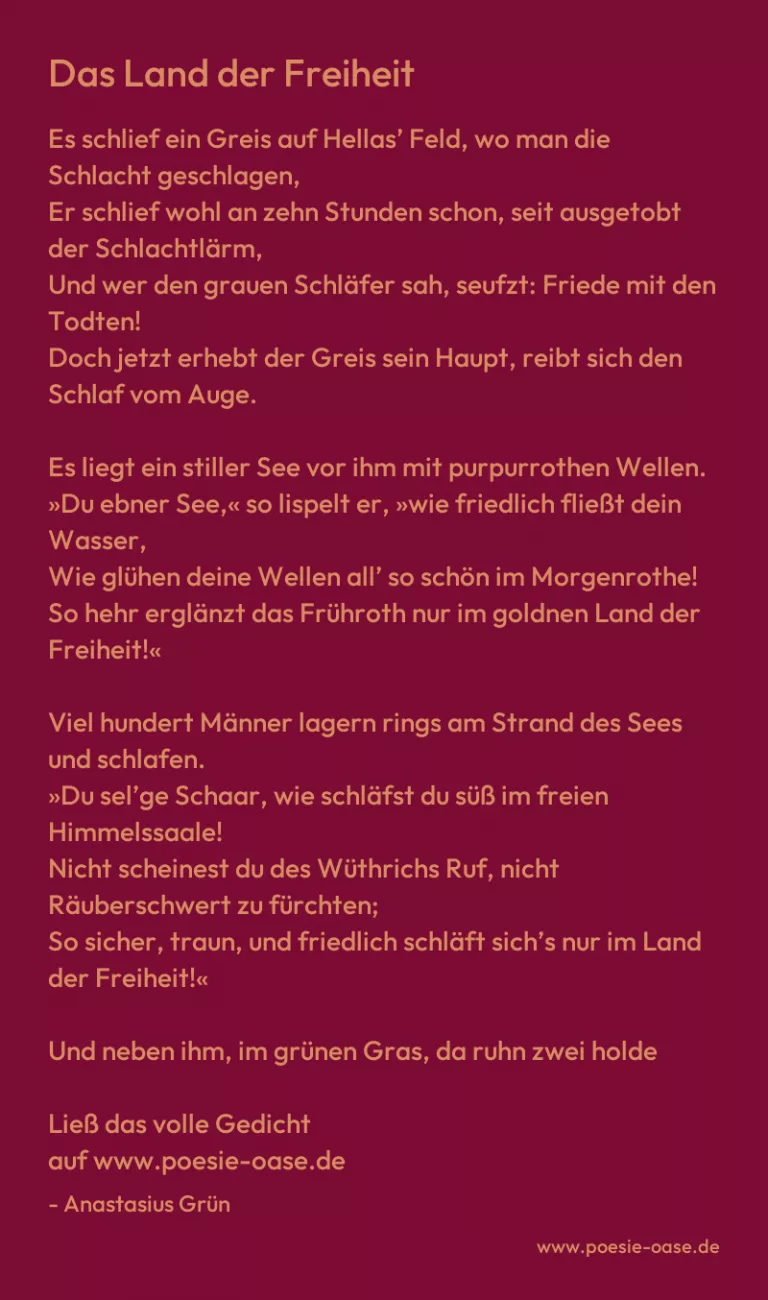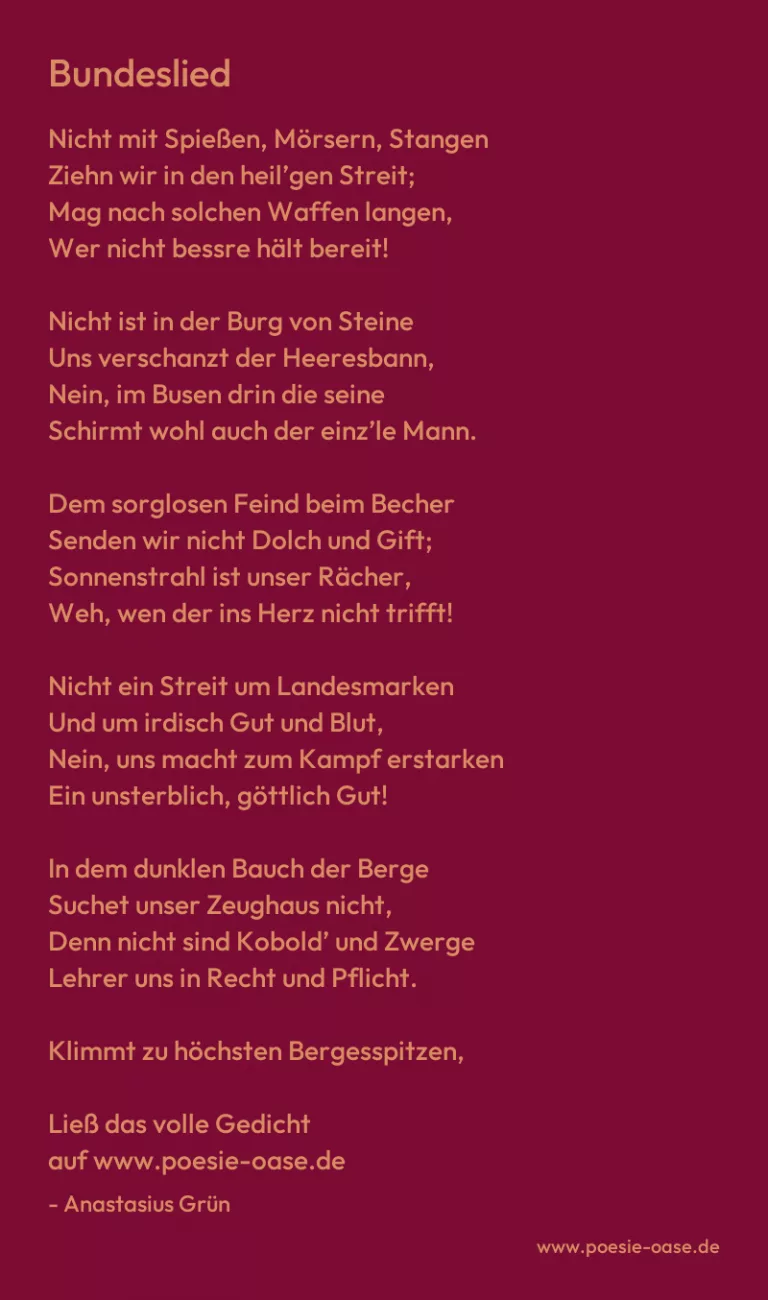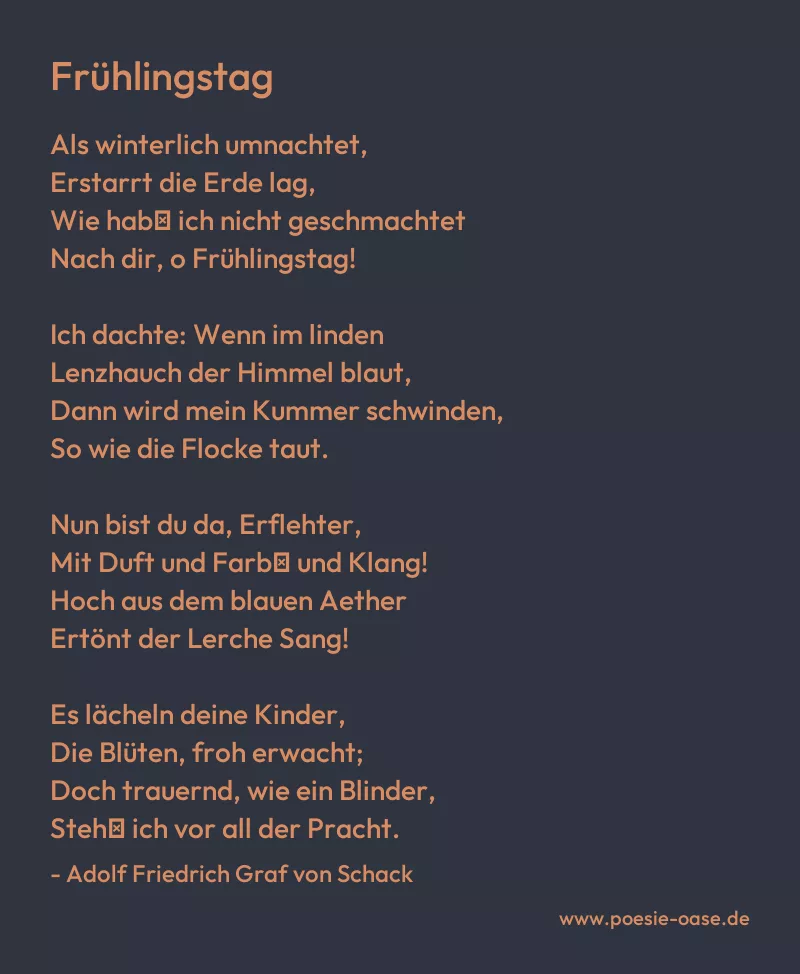Frühlingstag
Als winterlich umnachtet,
Erstarrt die Erde lag,
Wie hab′ ich nicht geschmachtet
Nach dir, o Frühlingstag!
Ich dachte: Wenn im linden
Lenzhauch der Himmel blaut,
Dann wird mein Kummer schwinden,
So wie die Flocke taut.
Nun bist du da, Erflehter,
Mit Duft und Farb′ und Klang!
Hoch aus dem blauen Aether
Ertönt der Lerche Sang!
Es lächeln deine Kinder,
Die Blüten, froh erwacht;
Doch trauernd, wie ein Blinder,
Steh′ ich vor all der Pracht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
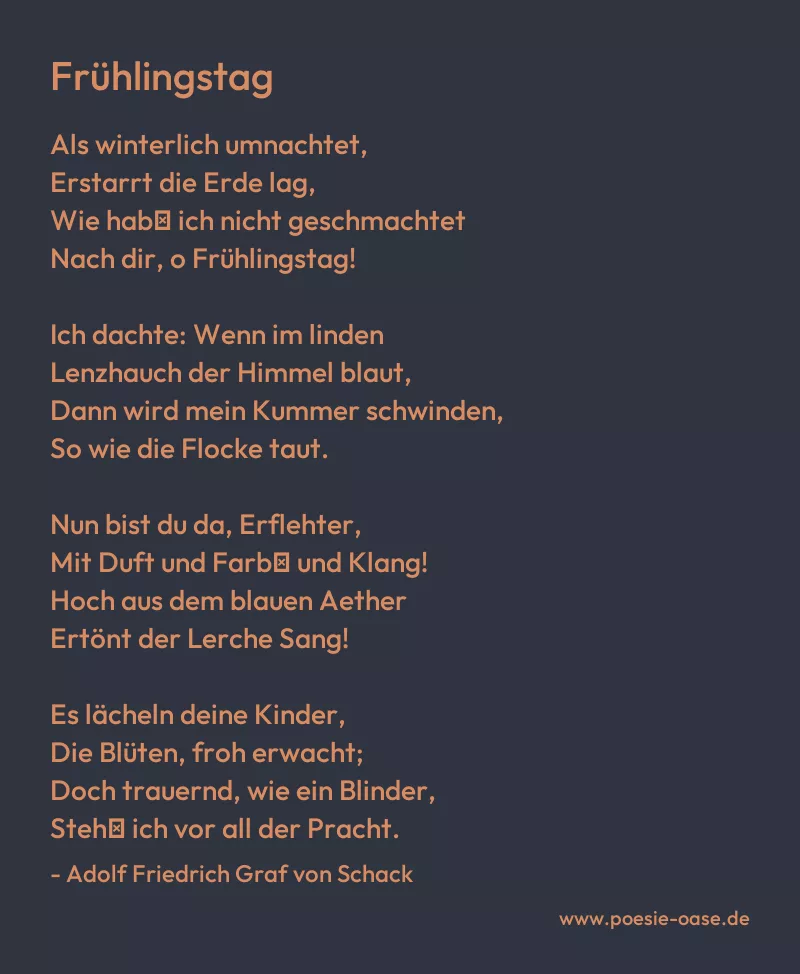
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Frühlingstag“ von Adolf Friedrich Graf von Schack beschreibt die Sehnsucht nach dem Frühling und das anschließende Gefühl der Enttäuschung, das trotz des ersehnten Frühlings eintritt. Das Gedicht beginnt mit einer Schilderung des Winters, in dem die Erde „erstarrt“ und der Autor nach dem Frühlingstag schmachtet. Diese sehnsüchtige Erwartung wird durch die Frage ausgedrückt, die die Hoffnung auf Trost und das Schwinden des Kummers in den milden Frühlingslüften impliziert, vergleichbar mit dem Schmelzen der Schneeflocken.
Der zweite Teil des Gedichts, der mit „Nun bist du da, Erflehter“ beginnt, wendet sich dem eigentlichen Frühlingstag zu. Er wird in all seiner Pracht beschrieben: „Duft und Farb’ und Klang“ sowie der Gesang der Lerche. Diese bildhaften Beschreibungen sollen die Lebendigkeit und Freude des Frühlings vermitteln. Allerdings wird der Kontrast zwischen der erwarteten Erleichterung und dem tatsächlichen Erleben deutlich. Der Autor steht trotz all der Schönheit und des Lebens, das den Frühling kennzeichnet, in Trauer und fühlt sich wie ein Blinder, der die Pracht nicht wirklich wahrnehmen kann.
Die zentrale Ironie des Gedichts liegt in der Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Der Autor hat sich nach dem Frühling gesehnt, in der Hoffnung, dass er den Kummer vertreiben würde. Doch als der Frühling endlich da ist, bleibt der Kummer bestehen. Dies deutet auf eine tiefere innere Not hin, die sich nicht von äußeren Umständen beeinflussen lässt. Das lyrische Ich steht wie ein Blinder vor der Schönheit, unfähig, sie zu genießen, was auf eine tiefe Melancholie oder eine innere Leere hindeutet, die durch äußere Reize nicht aufgehoben werden kann.
Das Gedicht verdeutlicht damit die menschliche Erfahrung von Enttäuschung und das Unvermögen, Glück und Trost in äußeren Gegebenheiten zu finden, wenn die innere Verfassung eine andere ist. Der Frühling, der traditionell für Neubeginn und Hoffnung steht, wird hier zu einem Spiegelbild der eigenen Traurigkeit. Die „Kinder“ des Frühlings, die „Blüten“, sind „froh erwacht“, während der Autor in seiner Trauer gefangen bleibt. Diese Gegenüberstellung unterstreicht die Isolation des lyrischen Ichs und die Unfähigkeit, sich an der Freude der Welt zu beteiligen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.