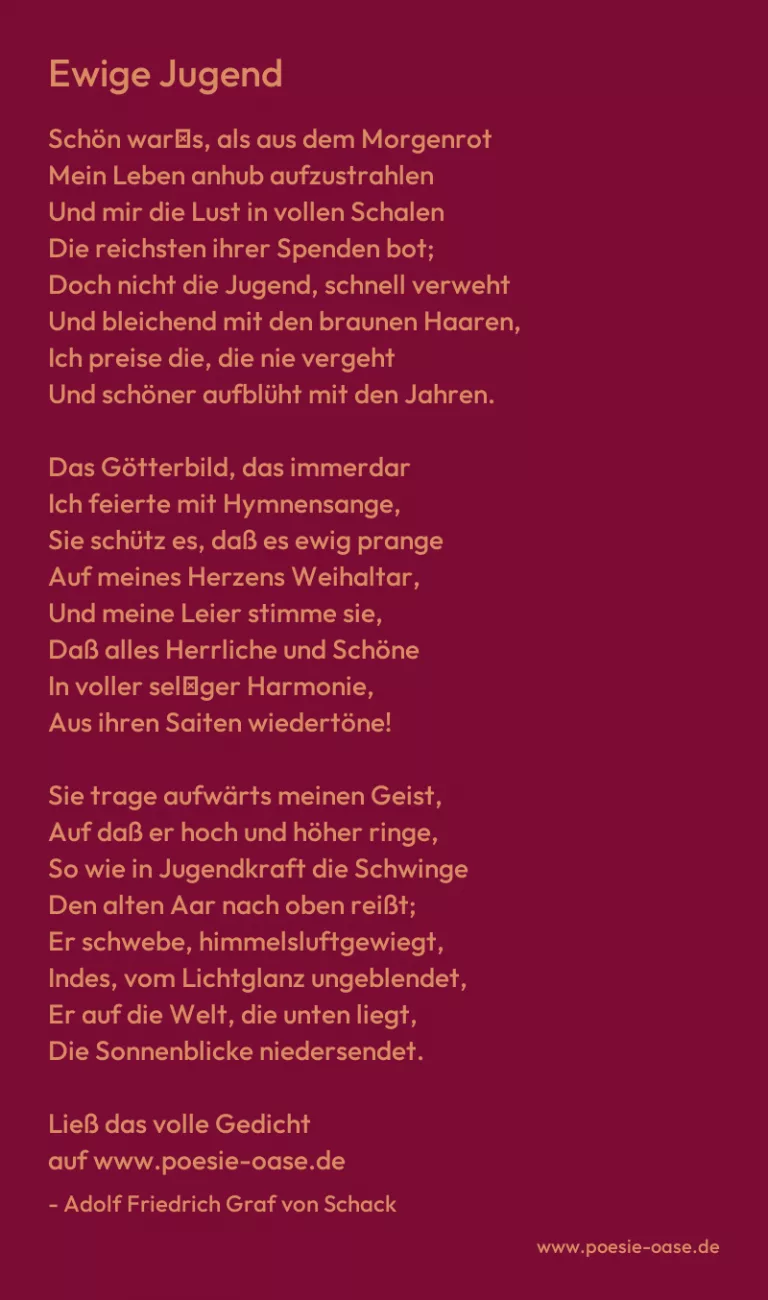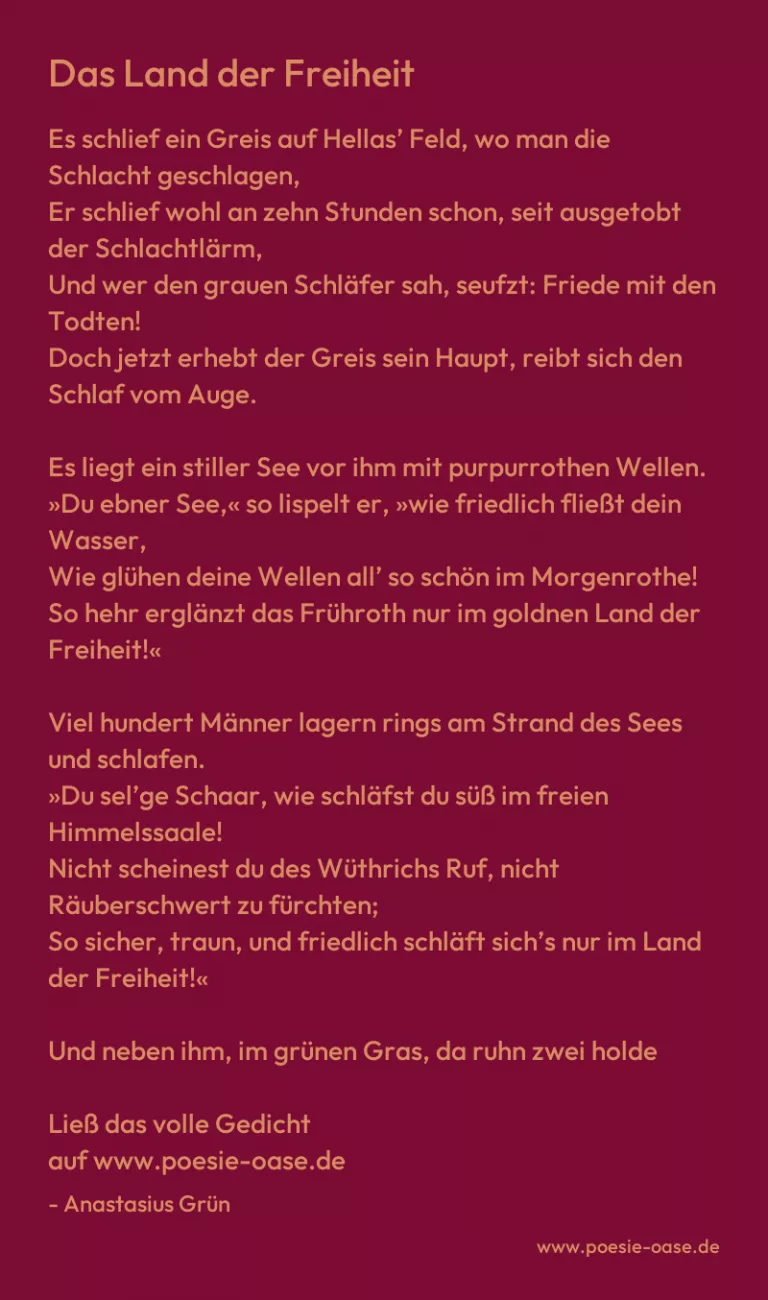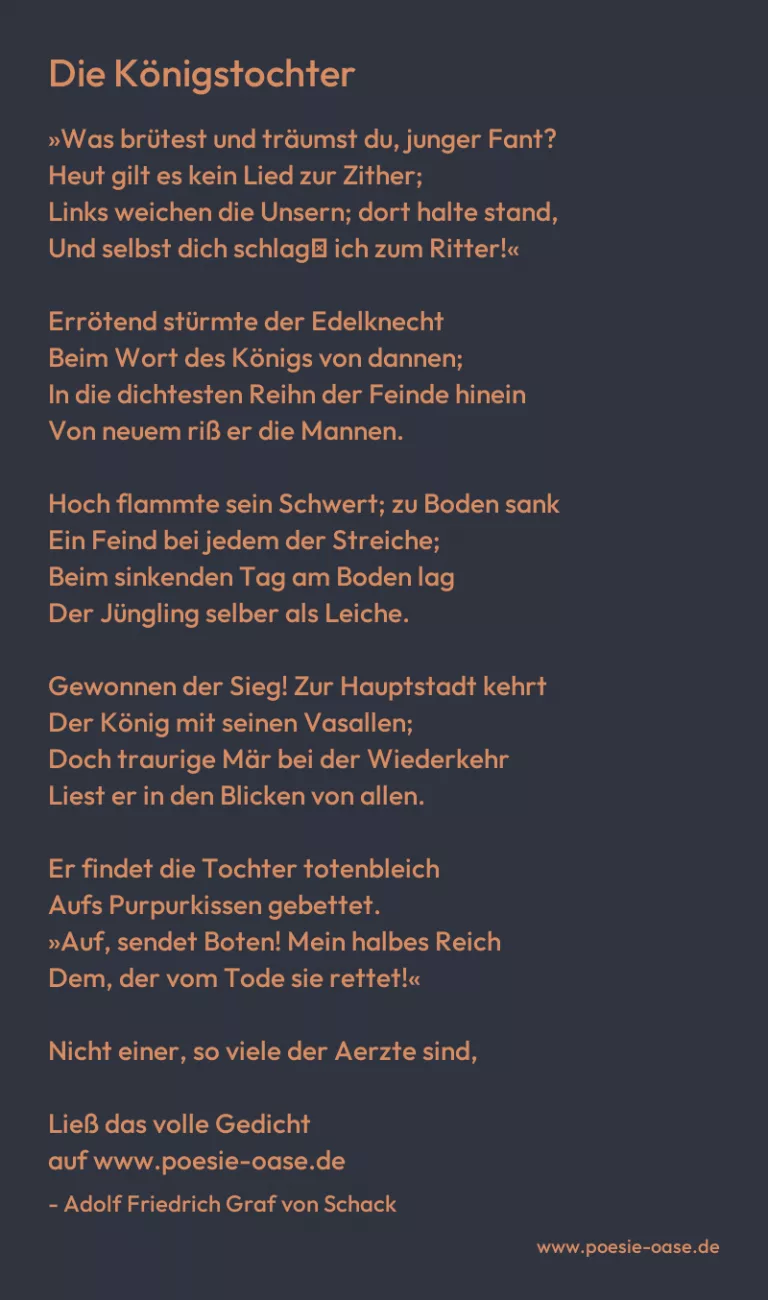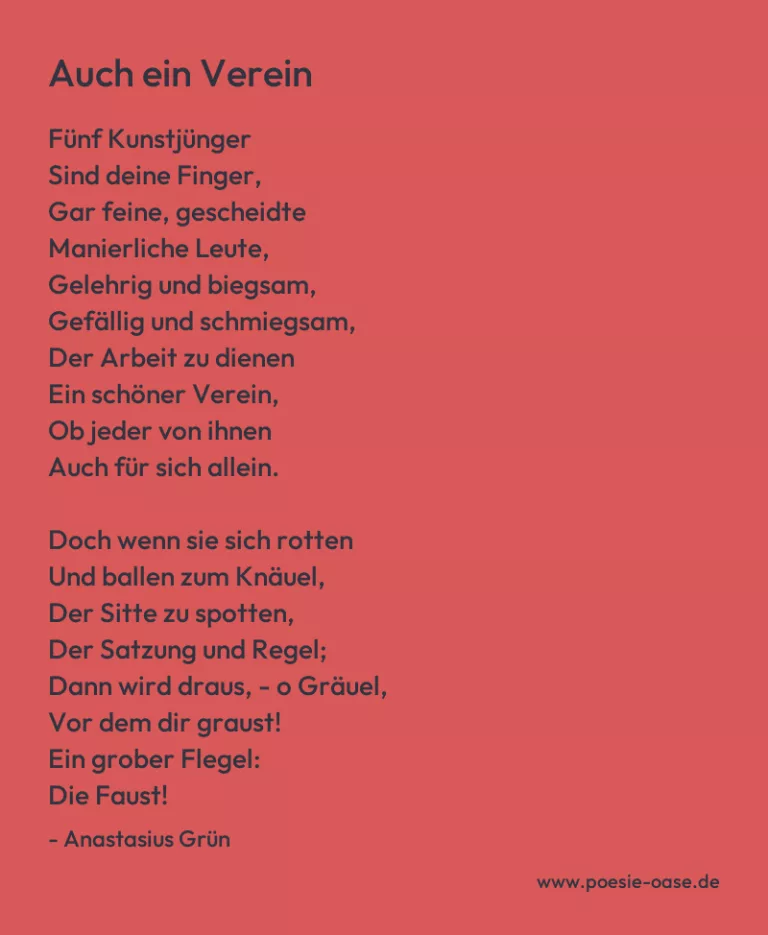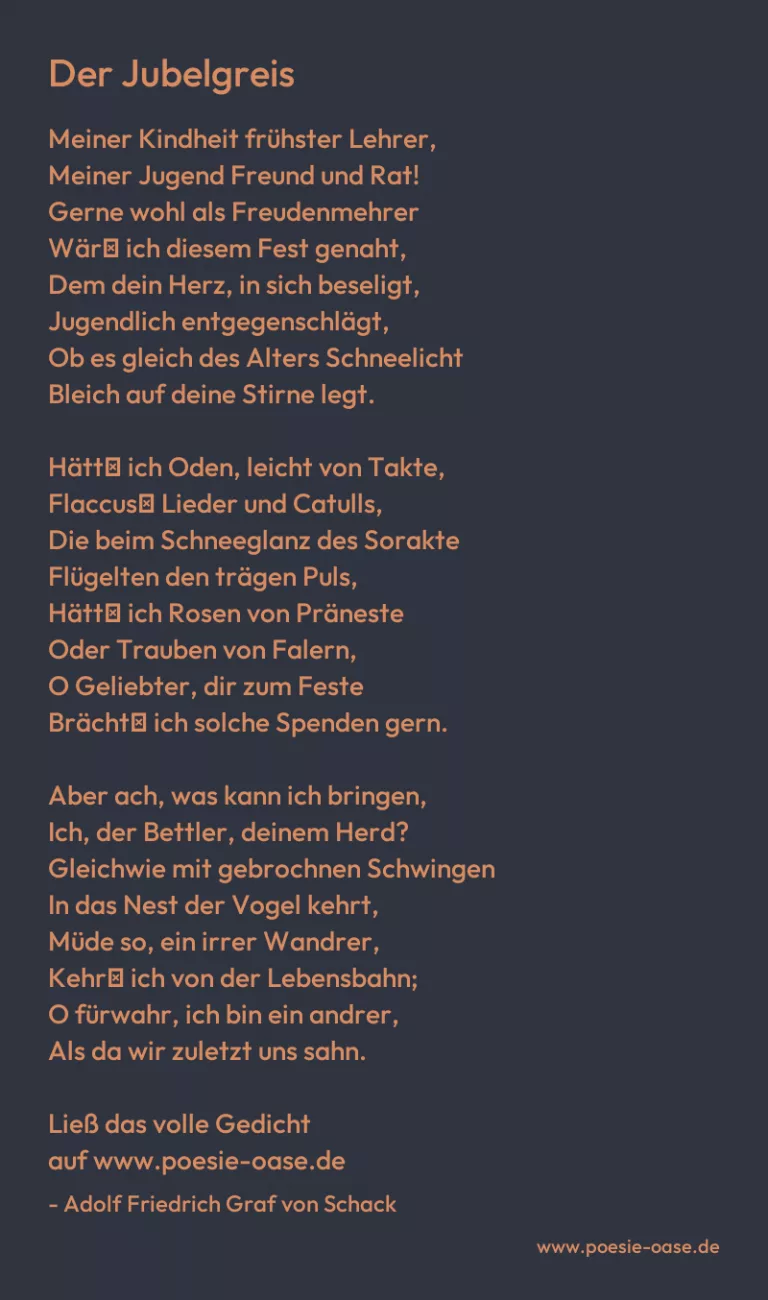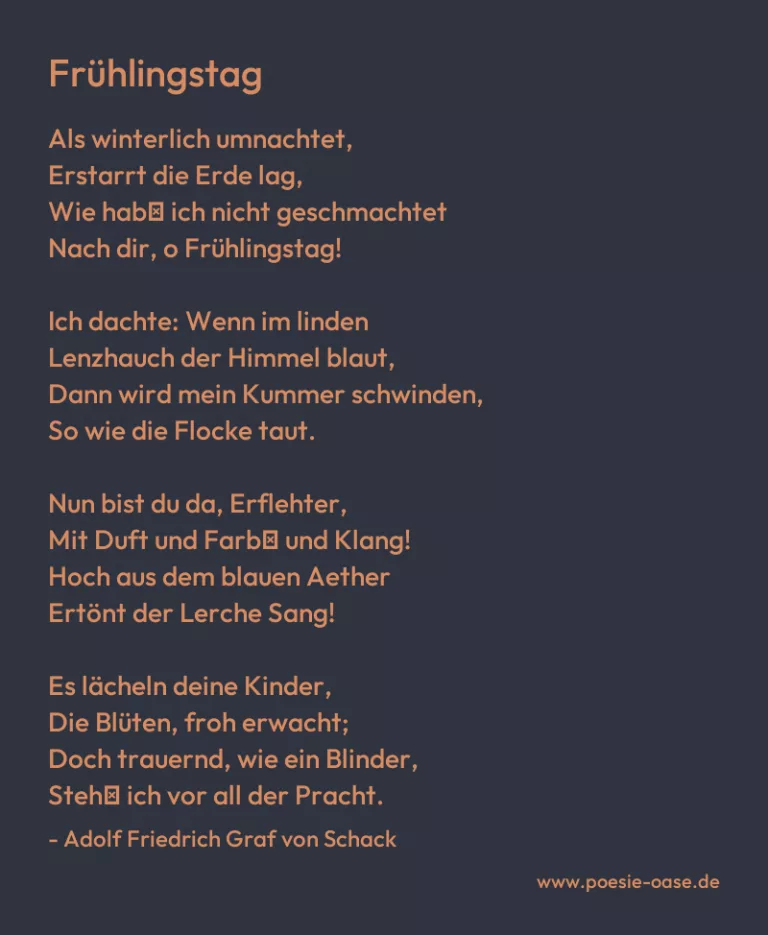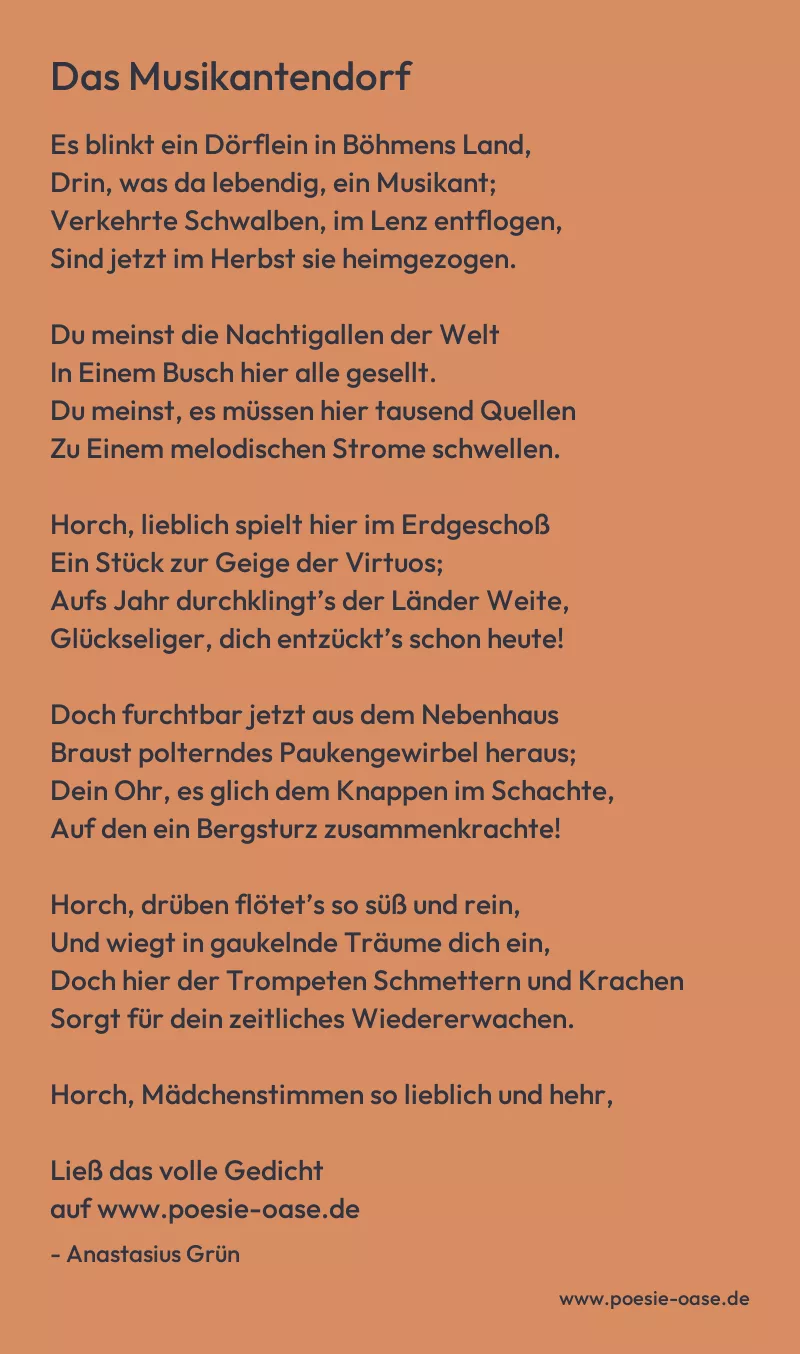Es blinkt ein Dörflein in Böhmens Land,
Drin, was da lebendig, ein Musikant;
Verkehrte Schwalben, im Lenz entflogen,
Sind jetzt im Herbst sie heimgezogen.
Du meinst die Nachtigallen der Welt
In Einem Busch hier alle gesellt.
Du meinst, es müssen hier tausend Quellen
Zu Einem melodischen Strome schwellen.
Horch, lieblich spielt hier im Erdgeschoß
Ein Stück zur Geige der Virtuos;
Aufs Jahr durchklingt’s der Länder Weite,
Glückseliger, dich entzückt’s schon heute!
Doch furchtbar jetzt aus dem Nebenhaus
Braust polterndes Paukengewirbel heraus;
Dein Ohr, es glich dem Knappen im Schachte,
Auf den ein Bergsturz zusammenkrachte!
Horch, drüben flötet’s so süß und rein,
Und wiegt in gaukelnde Träume dich ein,
Doch hier der Trompeten Schmettern und Krachen
Sorgt für dein zeitliches Wiedererwachen.
Horch, Mädchenstimmen so lieblich und hehr,
Dein Ohr durchschifft des Wohllauts Meer!
Am Brummbaß hat der Nachbar Behagen,
Vom Sturm, ach, wird dein Schifflein verschlagen!
Horch, Waldhornklang! Wie herrlich er schallt!
Dir säuselt der duftige grüne Wald;
Doch dort des Dudelsacks Surren und Summen
Dich mahnt’s, daß in Wäldern auch Bären brummen!
Hier flüstert der Guitarren Erguß
Von Rosenlauben und heimlichem Kuß;
Dort braust aus dem Haus der Klang der Fagotte,
Wie von Betrunkenen eine Rotte.
Der übt auf dem Klarinett sich ein,
Der will ein Meister am Hackbrett sein;
Dort stürzt vom Fenster Posaunenschall nieder,
Wie eines Verzweiflers zerschmetterte Glieder.
Jed’ einzelner Ton klingt gut und rein,
Doch will kein Einklang Aller gedeihn,
Wie die zerhauenen Glieder der Schlangen
Sich winden und nie zusammen gelangen.
So heult’s durcheinander und wimmert und dröhnt
Und ächzt und schnurrt und pfeift und stöhnt,
Als säßen im Chor des Mißlauts Geister,
Als wäre Satan Kapellenmeister!
Du fliehst und suchst vor dem Thore Ruh
Und fühlst, es dachten die Vogel wie du,
Die Schwalben und Störche, die auch entflogen,
Weil heim die Musikanten gezogen. –
Doch wenn der Schnee zu schmelzen begann,
Dann wallt aus dem Dörflein Weib und Mann,
Die wollen ostwärts, die westwärts wandern,
Nach Süden die Einen, gen Norden die Andern.
Vereint, was getrennt zu Hause war:
Dort drei, hier ein Pärlein, dort eine Schaar,
Wie des Wohllauts Geist sie zu Kränzen reihte
Und, Blumen gleich, durch die Lande streute!
Das kommt dem Dörflein auch eben recht,
Drin musizirt der Lerchen Geschlecht,
Frau Schwalbe kommt herbeigeflogen,
Herr Storch ist auch wieder eingezogen.
Die Spielleut’ grüßen manch fernes Land,
Sind üb’rall willkommen und wohlbekannt,
Finden üb’rall offene Ohren und Hände
Und schäumende Becher und Beifallsspende.
Da hat jeder Busch seine Nachtigall
Und jeder Fels seinen Wasserfall,
In allen Wäldern die Vögel singen,
Durch alle Thäler die Quellen springen.