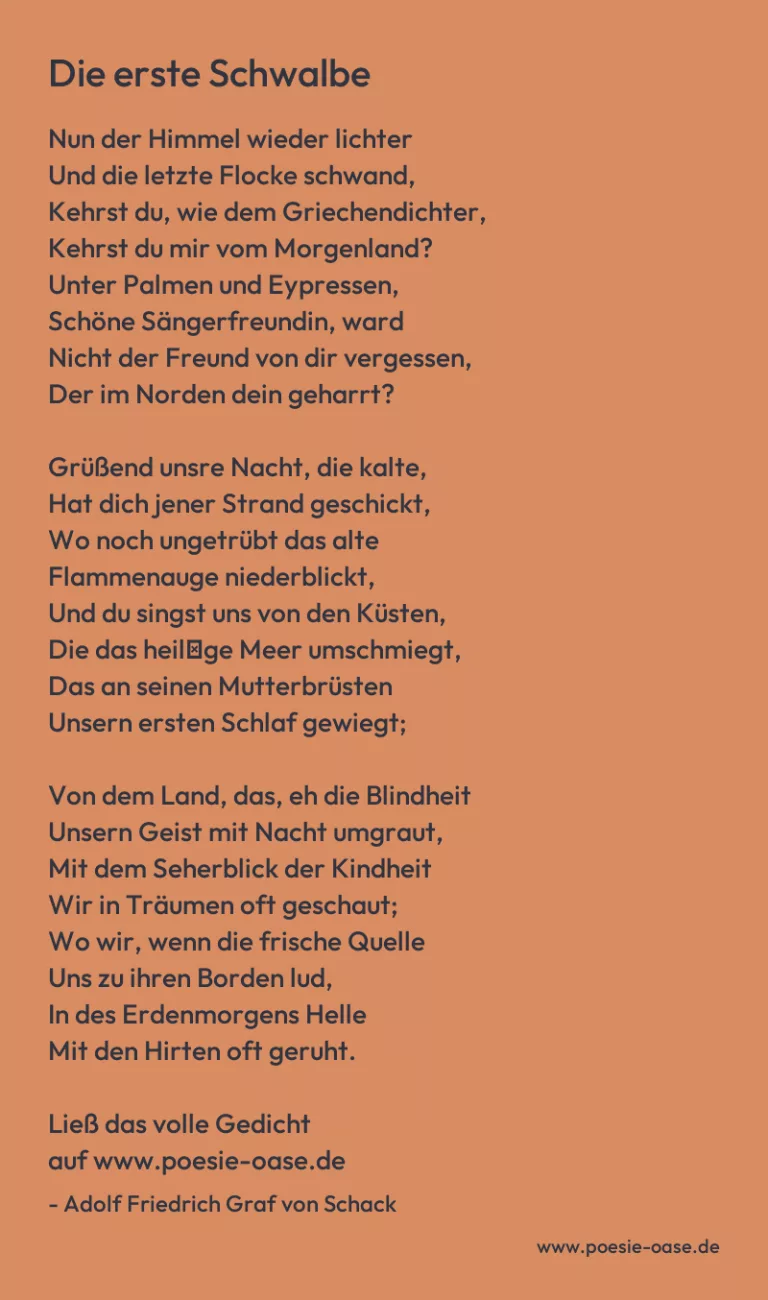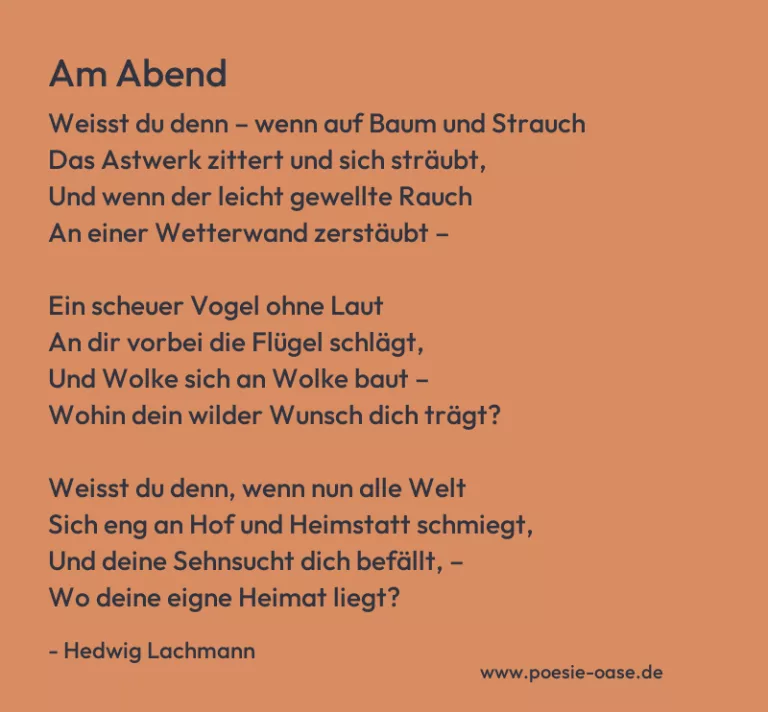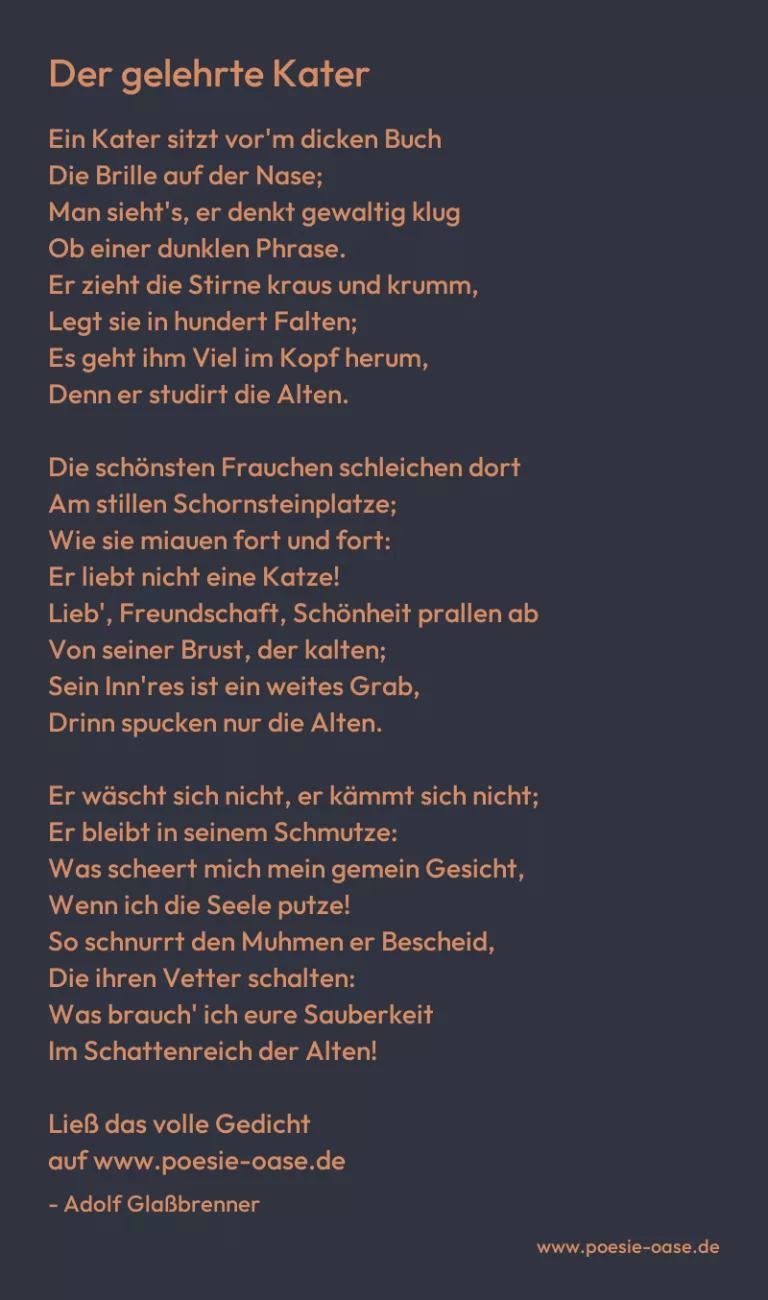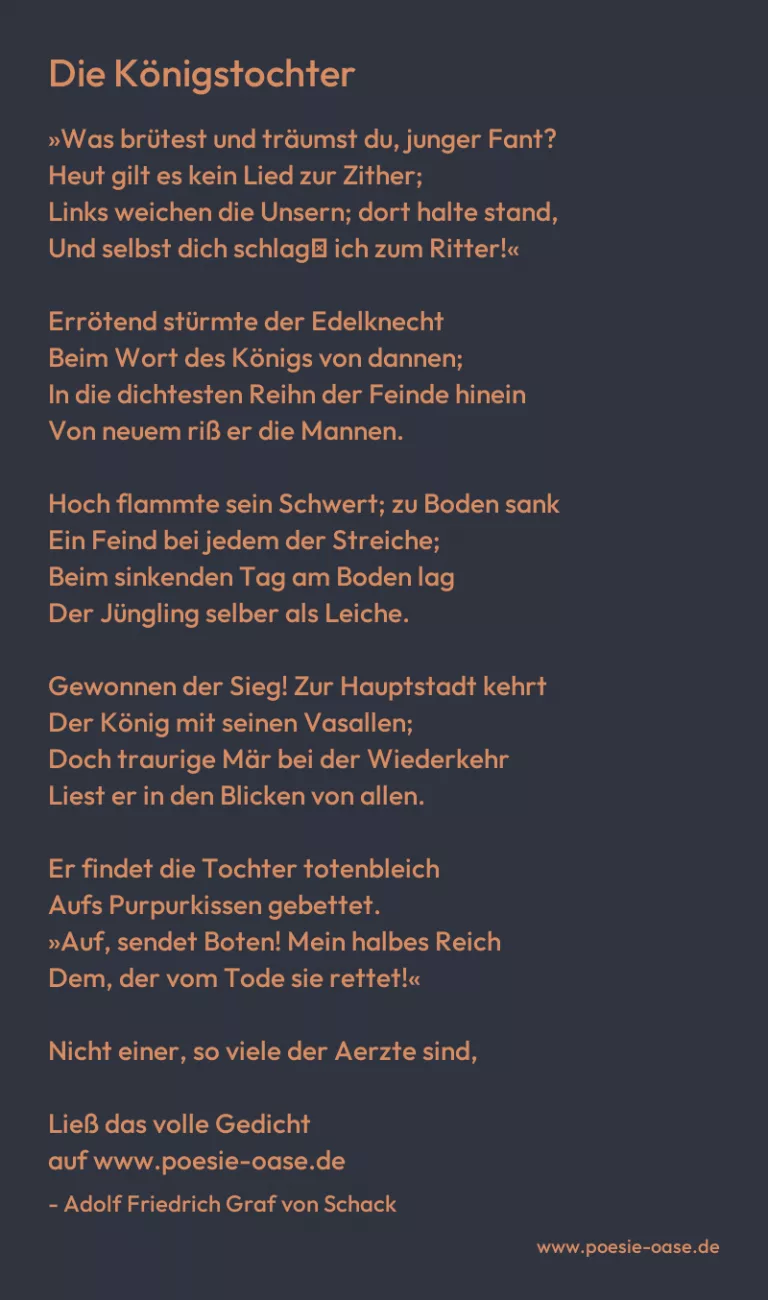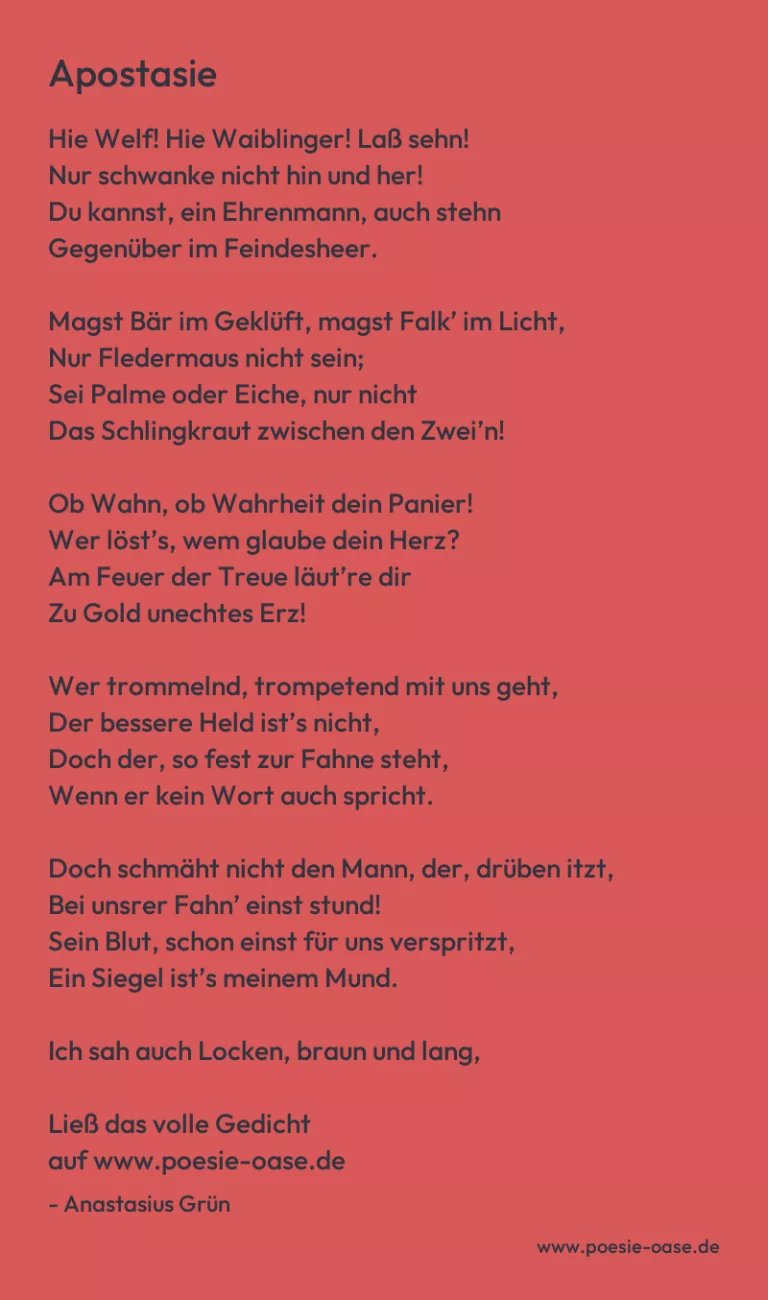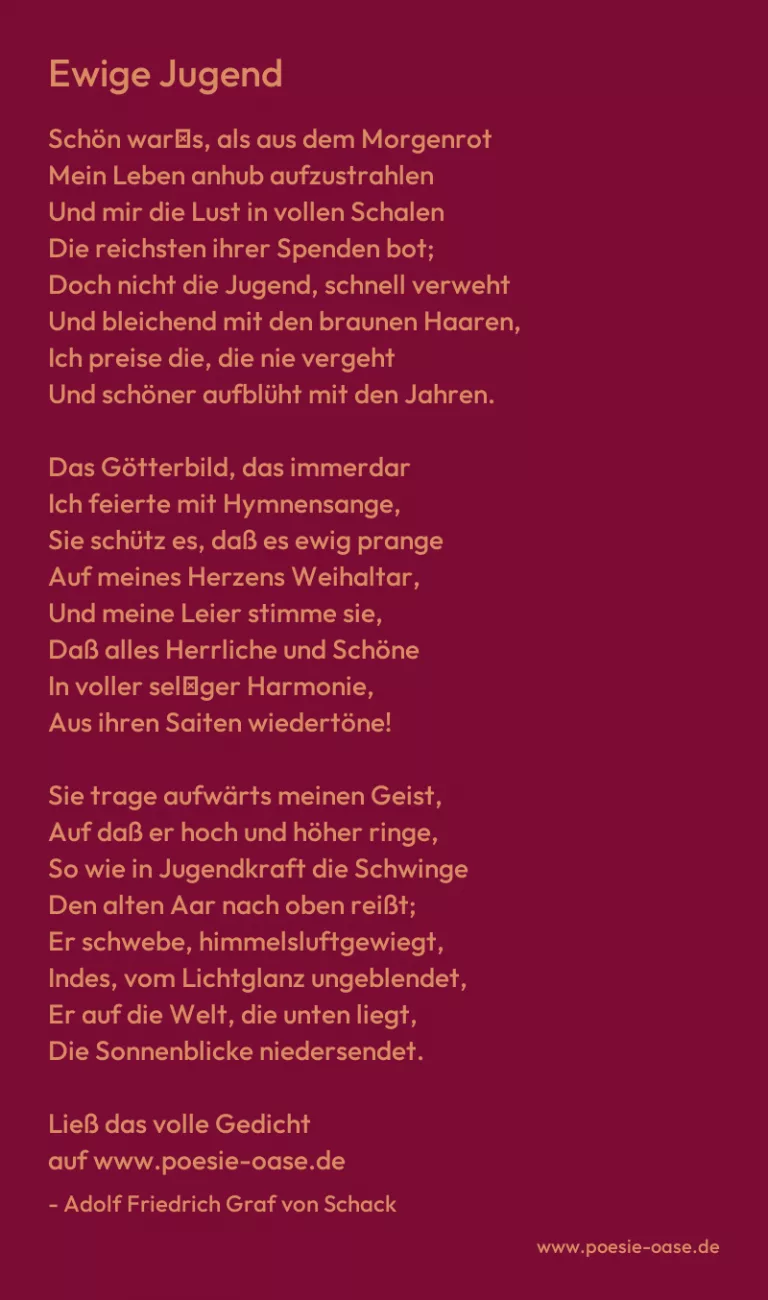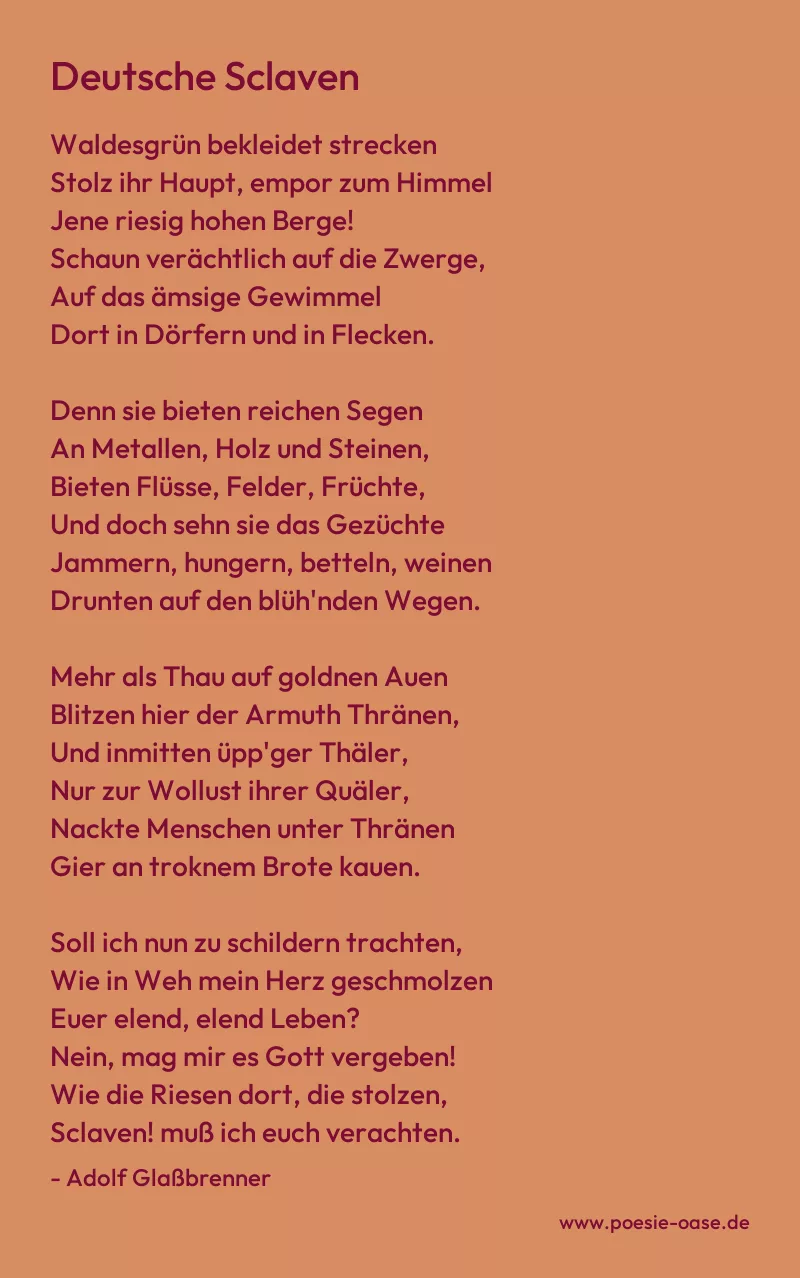Deutsche Sclaven
Waldesgrün bekleidet strecken
Stolz ihr Haupt, empor zum Himmel
Jene riesig hohen Berge!
Schaun verächtlich auf die Zwerge,
Auf das ämsige Gewimmel
Dort in Dörfern und in Flecken.
Denn sie bieten reichen Segen
An Metallen, Holz und Steinen,
Bieten Flüsse, Felder, Früchte,
Und doch sehn sie das Gezüchte
Jammern, hungern, betteln, weinen
Drunten auf den blüh’nden Wegen.
Mehr als Thau auf goldnen Auen
Blitzen hier der Armuth Thränen,
Und inmitten üpp’ger Thäler,
Nur zur Wollust ihrer Quäler,
Nackte Menschen unter Thränen
Gier an troknem Brote kauen.
Soll ich nun zu schildern trachten,
Wie in Weh mein Herz geschmolzen
Euer elend, elend Leben?
Nein, mag mir es Gott vergeben!
Wie die Riesen dort, die stolzen,
Sclaven! muß ich euch verachten.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
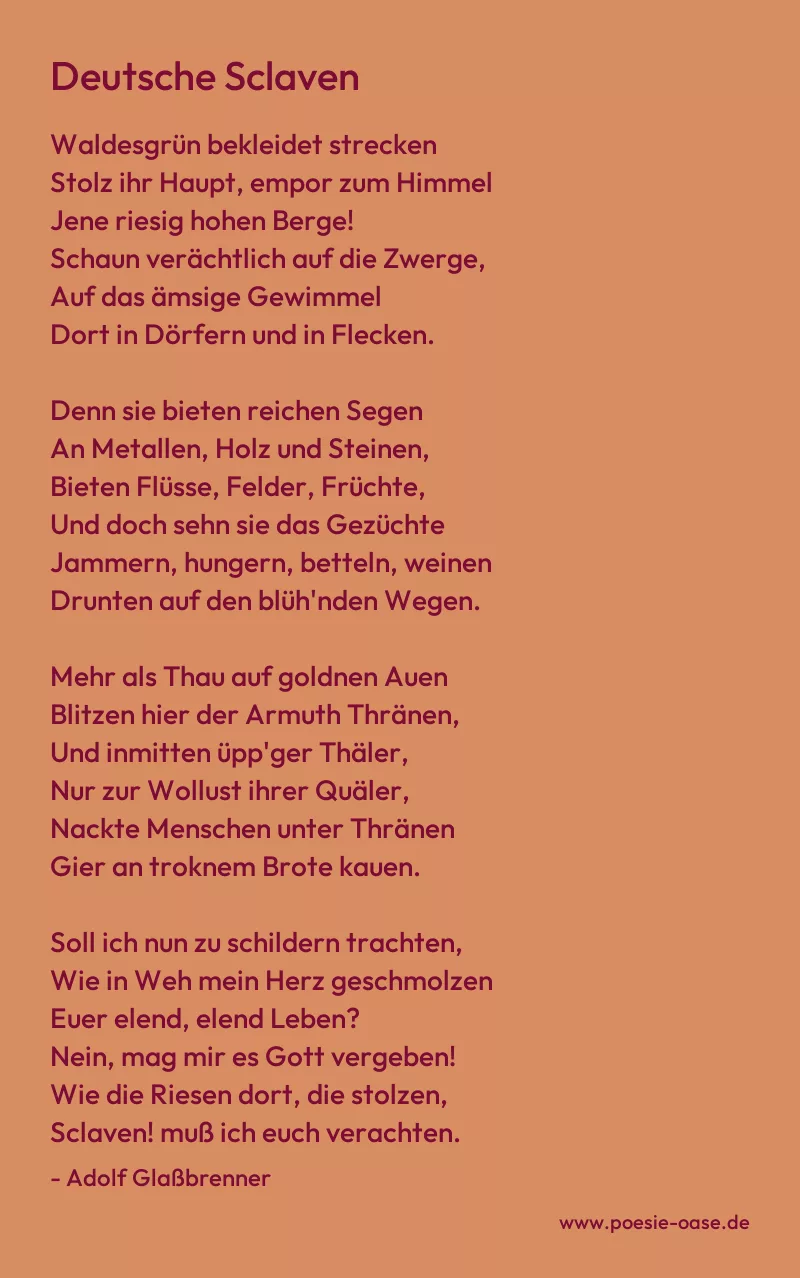
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Deutsche Sclaven“ von Adolf Glaßbrenner ist eine bittere Anklage der sozialen Ungleichheit im Deutschland seiner Zeit. Der Titel selbst, der „deutsche Sklaven“ impliziert, deutet auf ein tiefgreifendes Gefühl der Erniedrigung und der Abhängigkeit der einfachen Bevölkerung von den Reichen und Mächtigen. Das Gedicht ist in drei Strophen aufgebaut, die jeweils ein anderes Aspekt dieser Ungerechtigkeit hervorheben, bevor es in der vierten Strophe zu einem überraschenden, wenn auch zynischen, Schluss kommt.
Die erste Strophe beschreibt eine kontrastreiche Szenerie, in der die majestätischen Berge stolz in den Himmel ragen und verächtlich auf die kleinen Dörfer und Flecken herabblicken. Diese Beschreibung dient als Metapher für die Kluft zwischen den Reichen und den Armen. Die Berge, reich an Ressourcen, symbolisieren die Wohlhabenden, die über das arme „Gewimmel“ der Bevölkerung hinwegsehen, das in den kleinen Dörfern lebt. Die Beschreibung der Berge als „riesig hohen“ und stolz, zusammen mit dem Vergleich der Bewohner der Dörfer mit „Zwergen“, verstärkt das Gefühl der Machtlosigkeit und Unterdrückung.
Die zweite Strophe vertieft die Thematik, indem sie die reichhaltigen Ressourcen der Natur, wie Metalle, Holz, Steine, Flüsse, Felder und Früchte, als einen Segen beschreibt, der paradoxerweise nicht den Armen zugutekommt. Trotz des Überflusses müssen die Menschen „jammern, hungern, betteln, weinen“. Dieses Bild verdeutlicht die ungerechte Verteilung des Reichtums und die extreme Armut, die trotz der natürlichen Fülle herrscht. Die „Armuth Thränen“ werden als zahlreicher beschrieben als Tau auf den „goldnen Auen“, was die Verzweiflung und das Leid der Armen noch verstärkt.
Die dritte Strophe kulminiert in einer Beschreibung des elenden Lebens der Armen, die inmitten üppiger Täler, die nur „zur Wollust ihrer Quäler“ dienen, hungern und um ihr Leben kämpfen müssen. Diese Zeilen sind von einer tiefen Verbitterung durchzogen. Der Sprecher fragt sich, ob er das Elend der Armen schildern soll, entscheidet sich aber dagegen. In der abschließenden Strophe folgt dann der Schock. Anstatt Mitleid zu bekunden oder eine Lösung zu suchen, wählt der Sprecher, der sich durch die Macht der Reichen und die Ohnmacht der Armen gleichermaßen erniedrigt fühlt, die Verachtung für die „Sclaven“. Diese Schlussfolgerung ist zynisch, spiegelt aber vermutlich das Gefühl der Resignation und des fehlenden Glaubens an eine Veränderung wider, das viele Menschen in einer ungerechten Gesellschaft empfinden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.