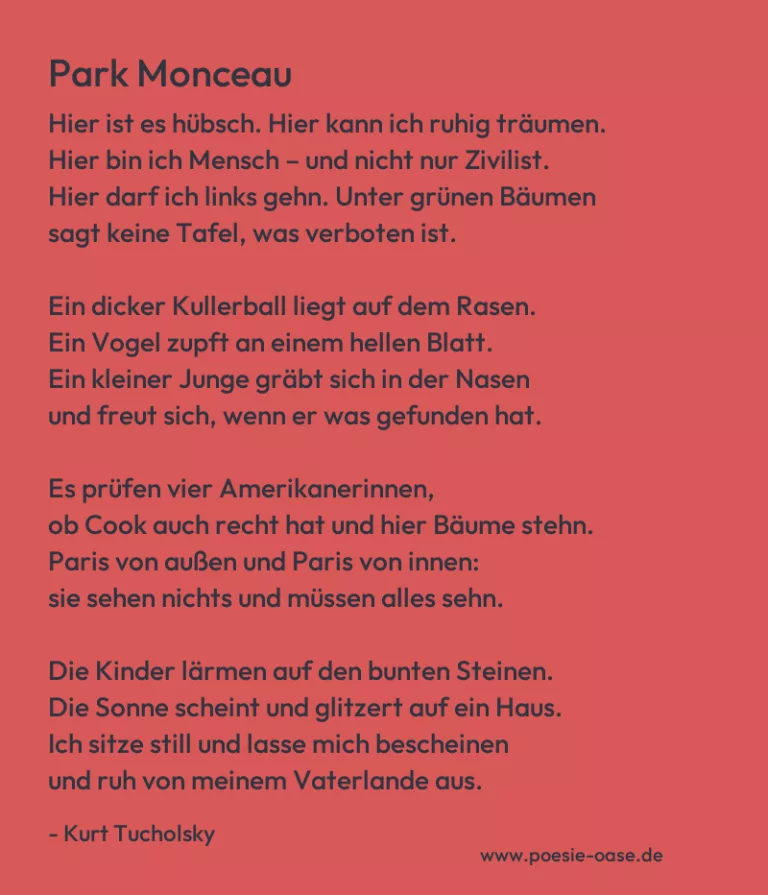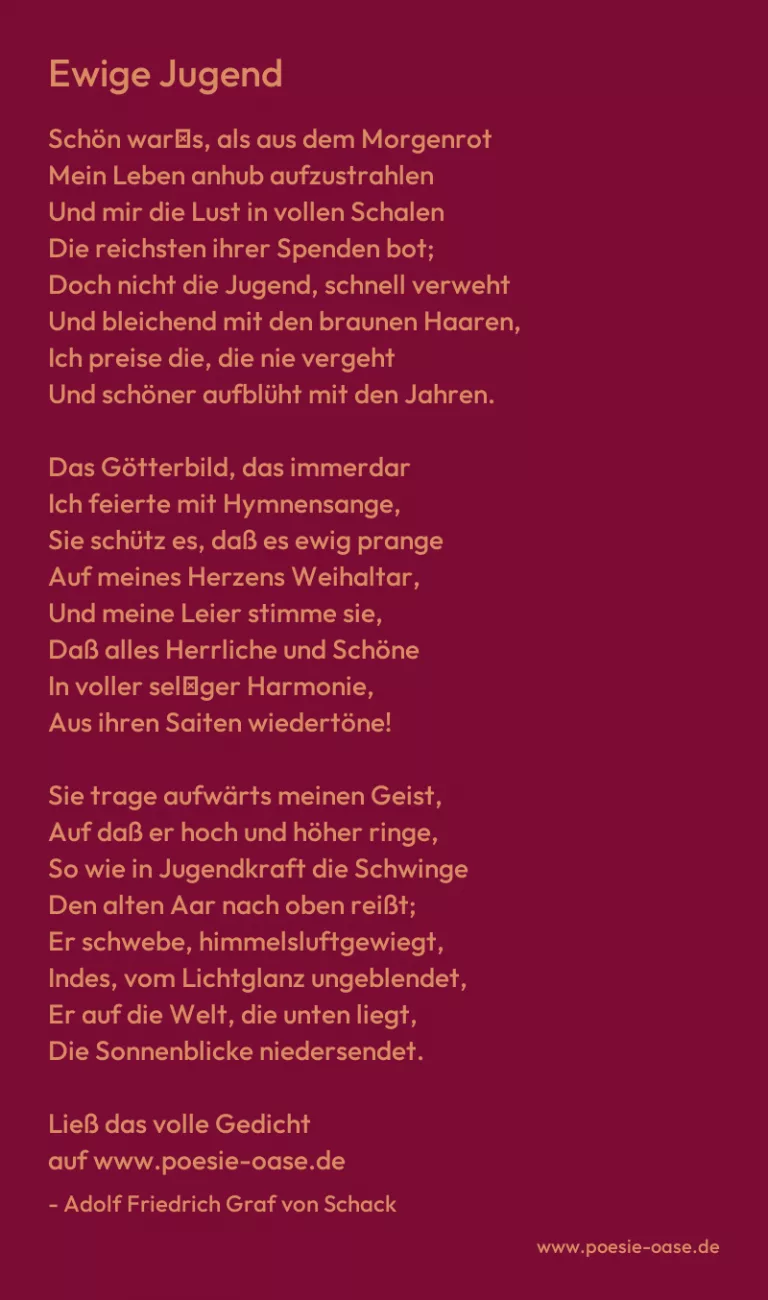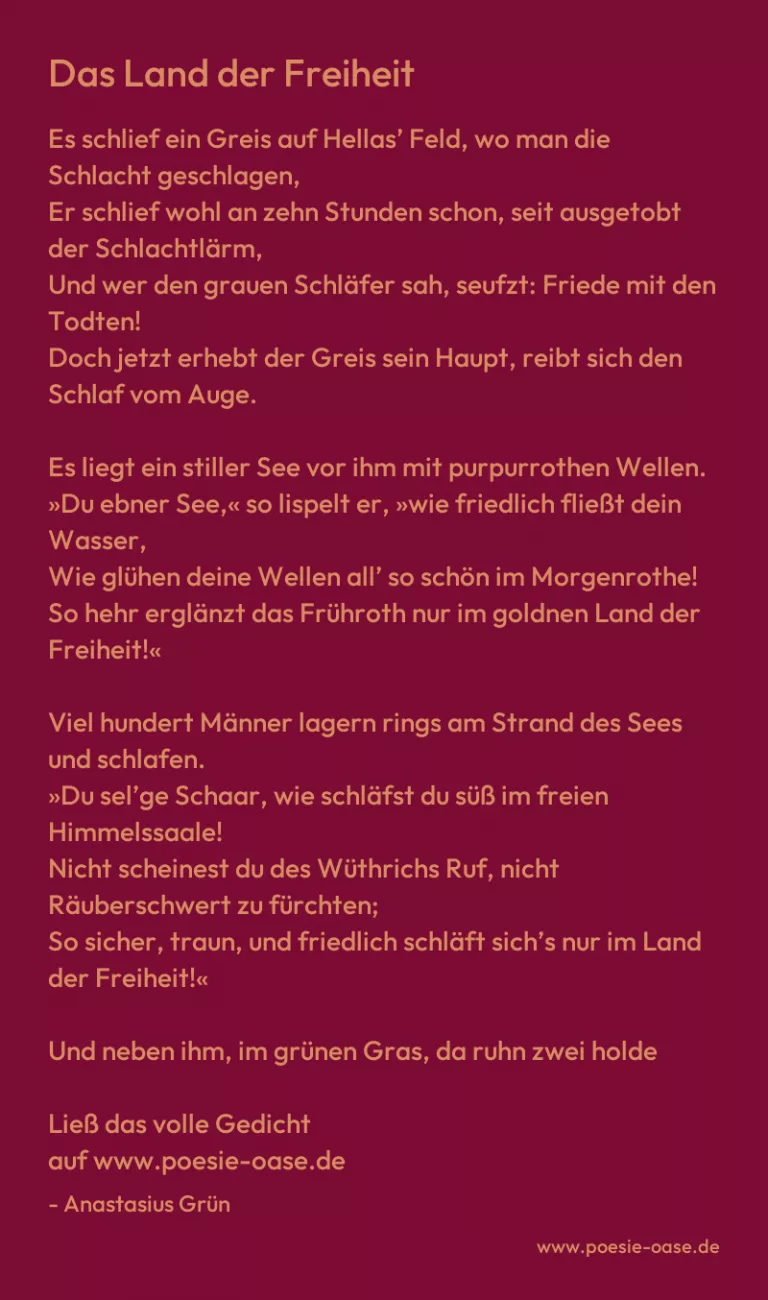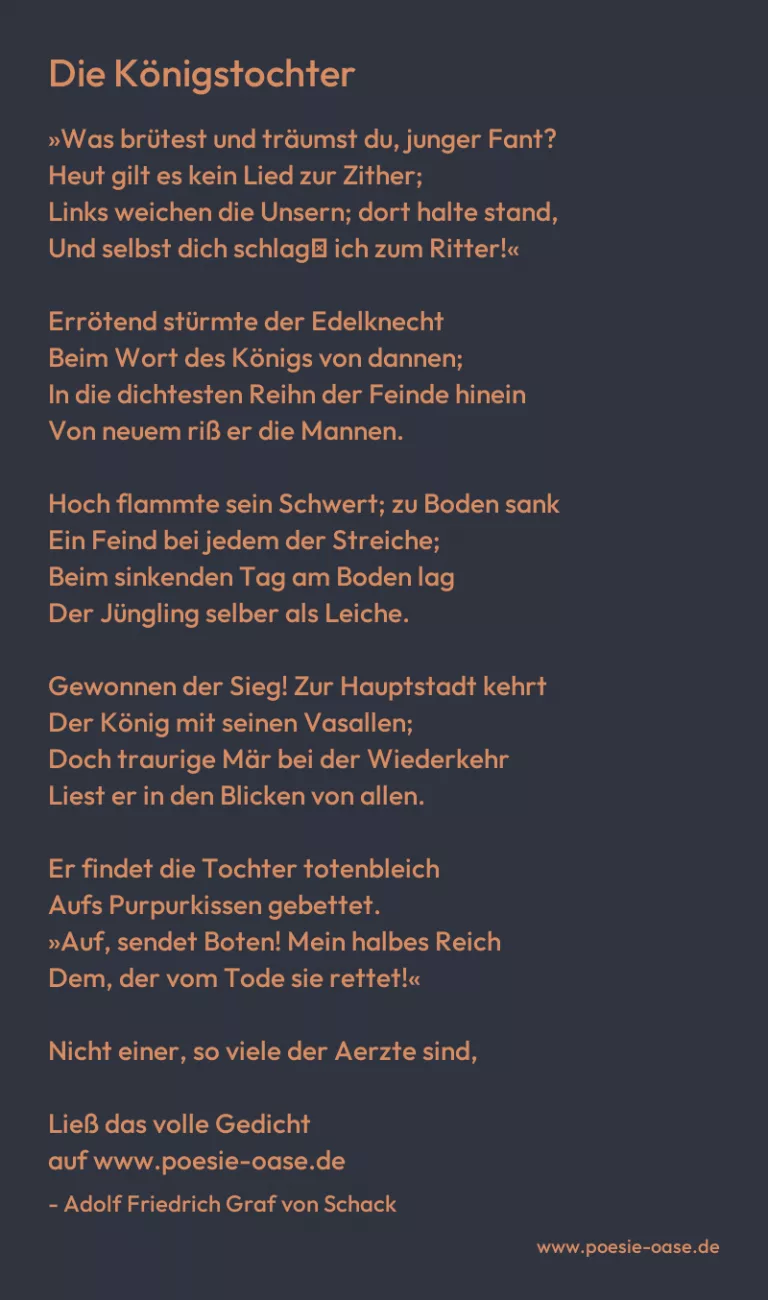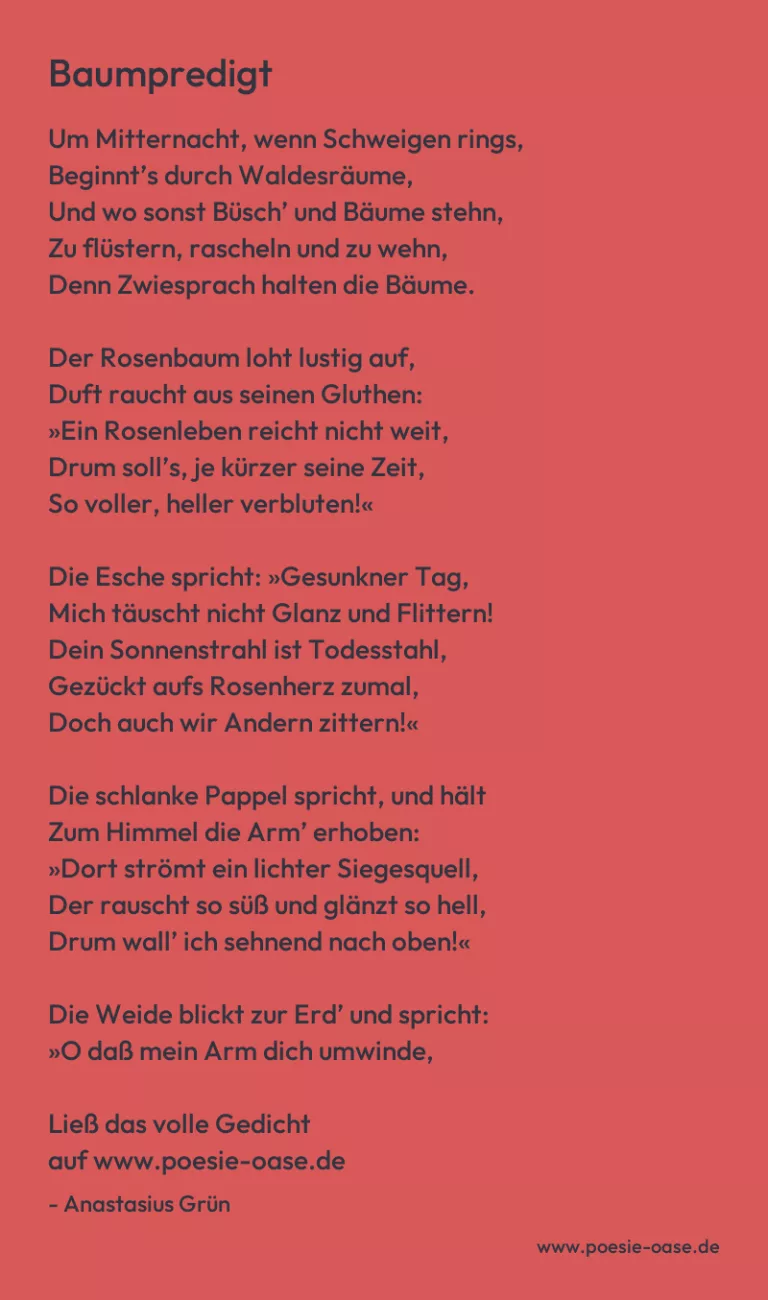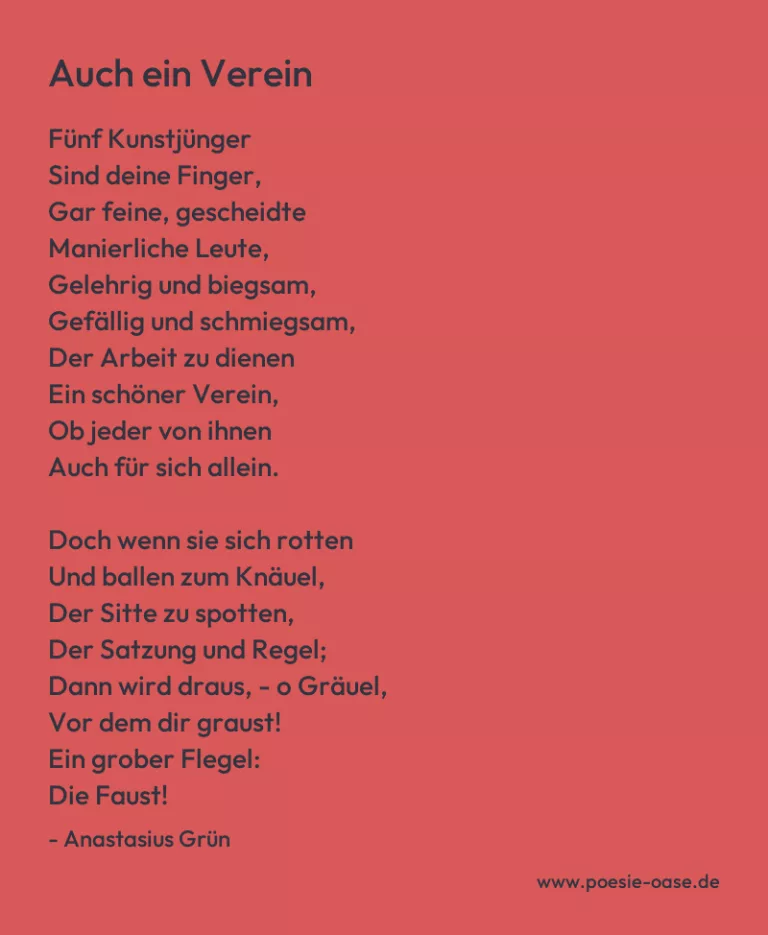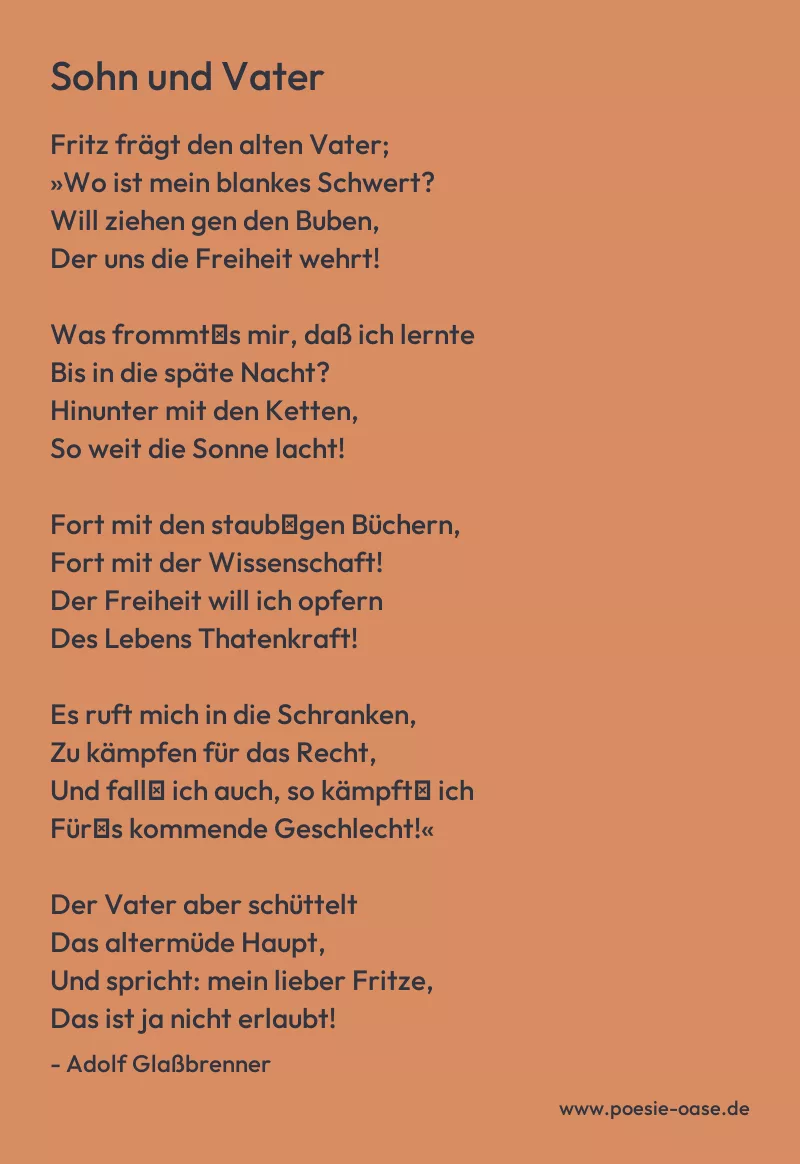Sohn und Vater
Fritz frägt den alten Vater;
»Wo ist mein blankes Schwert?
Will ziehen gen den Buben,
Der uns die Freiheit wehrt!
Was frommt′s mir, daß ich lernte
Bis in die späte Nacht?
Hinunter mit den Ketten,
So weit die Sonne lacht!
Fort mit den staub′gen Büchern,
Fort mit der Wissenschaft!
Der Freiheit will ich opfern
Des Lebens Thatenkraft!
Es ruft mich in die Schranken,
Zu kämpfen für das Recht,
Und fall′ ich auch, so kämpft′ ich
Für′s kommende Geschlecht!«
Der Vater aber schüttelt
Das altermüde Haupt,
Und spricht: mein lieber Fritze,
Das ist ja nicht erlaubt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
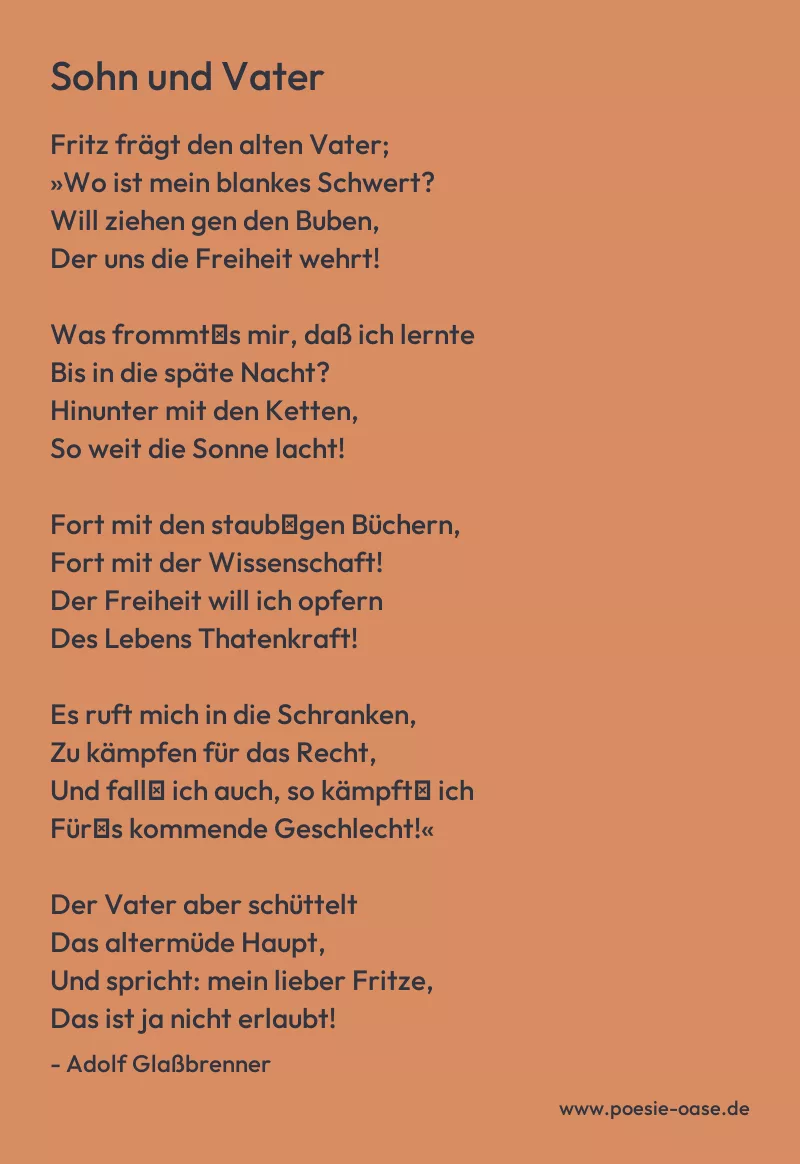
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sohn und Vater“ von Adolf Glaßbrenner ist ein kurzer, dramatischer Dialog, der eine Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann, Fritz, und seinem Vater darstellt, und sich mit dem Thema der Freiheit, des Kampfes und der unterschiedlichen Herangehensweisen an politische und gesellschaftliche Veränderungen auseinandersetzt. Der Kern der Auseinandersetzung ist die Ungeduld und der Drang des Sohnes, sofort und mit Gewalt für die Freiheit zu kämpfen, im Gegensatz zur vorsichtigeren, möglicherweise resignierten Haltung des Vaters.
Fritz, der Sohn, drückt in leidenschaftlichen Worten seinen Wunsch aus, gegen die „Buben“ zu ziehen, die die Freiheit unterdrücken. Seine Worte sind von jugendlichem Elan und dem Glauben an die Macht der direkten Aktion geprägt. Er kritisiert die „staub’gen Bücher“ und die „Wissenschaft“, die er als Hindernisse auf dem Weg zur Freiheit sieht. Für ihn ist der Kampf das Mittel der Wahl, und er ist bereit, sein Leben für das „kommende Geschlecht“ zu opfern, ein Ideal, das den Wunsch nach einer besseren Zukunft und die Opferbereitschaft der Jugend widerspiegelt. Die Rhetorik des Sohnes ist geprägt von starken Bildern und einer klaren, wenn auch vereinfachenden, Weltanschauung von Gut und Böse.
Der Vater, repräsentiert durch die Metapher des „altermüden Hauptes“, stellt einen Kontrast zur jugendlichen Aufbruchsstimmung dar. Seine einzige Reaktion ist ein entschiedenes „Das ist ja nicht erlaubt!“. Diese kurze Antwort deutet auf eine andere Sichtweise, möglicherweise geprägt von Erfahrung und Vorsicht. Der Vater scheint die Ideale des Sohnes zu verstehen, teilt aber dessen Ungeduld und seine Art des Kampfes nicht. Seine Worte sind eine klare Ablehnung des gewaltsamen Vorgehens, möglicherweise aus der Einsicht heraus, dass politische Veränderungen nicht so einfach zu erreichen sind wie von Fritz angenommen, oder aus einer pragmatischen Einschätzung der politischen Gegebenheiten.
Das Gedicht endet mit einem offenen Schluss, der die unterschiedlichen Ansichten von Vater und Sohn nebeneinanderstellt, ohne eine von beiden zu bevorzugen. Es wirft Fragen nach der Natur von Freiheit, dem richtigen Weg zur Erreichung gesellschaftlicher Veränderungen und der Rolle von Erfahrung und Idealismus auf. Der Kontrast zwischen der jugendlichen Begeisterung und der altersbedingten Skepsis macht die Dichtung zu einem Zeitdokument, das die Spannung zwischen verschiedenen Generationen und deren unterschiedlichen Herangehensweisen an politische Fragen widerspiegelt. Die Knappheit des Gedichts unterstreicht die Tragweite der Kluft, die zwischen den beiden Generationen besteht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.