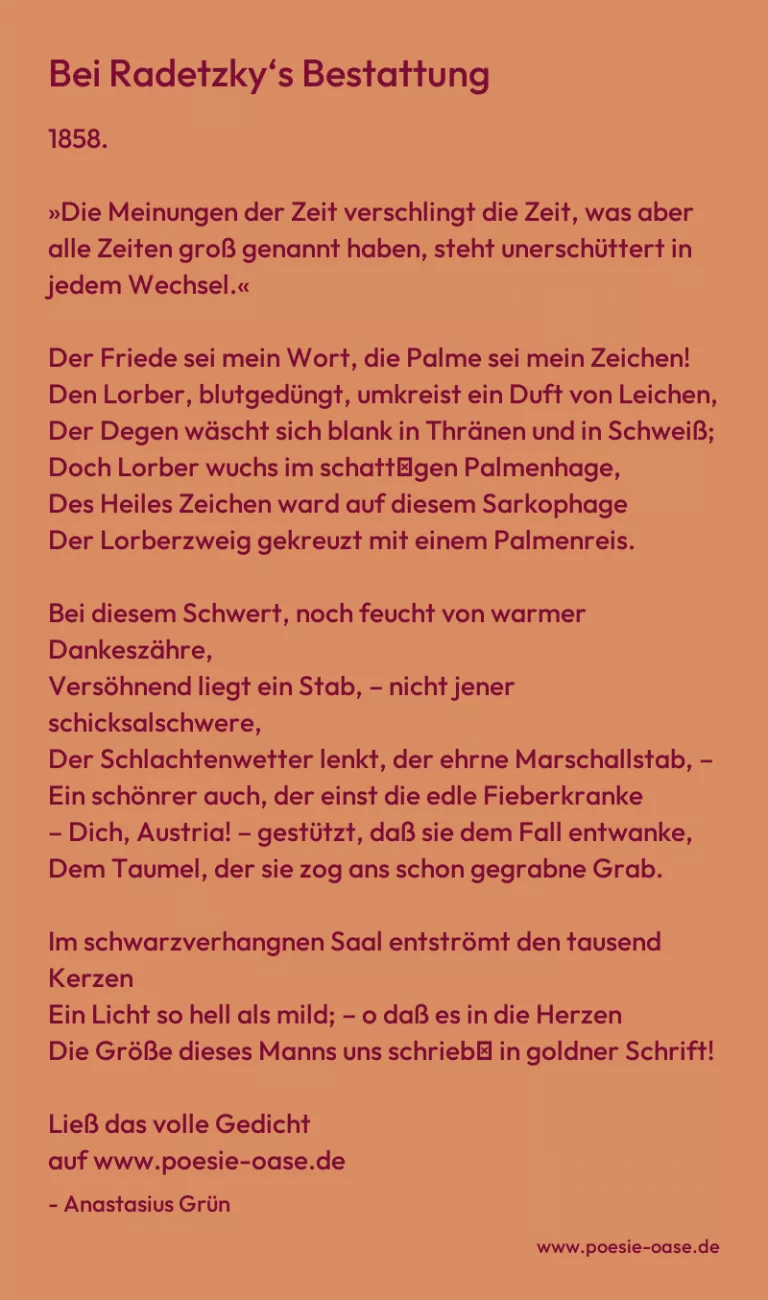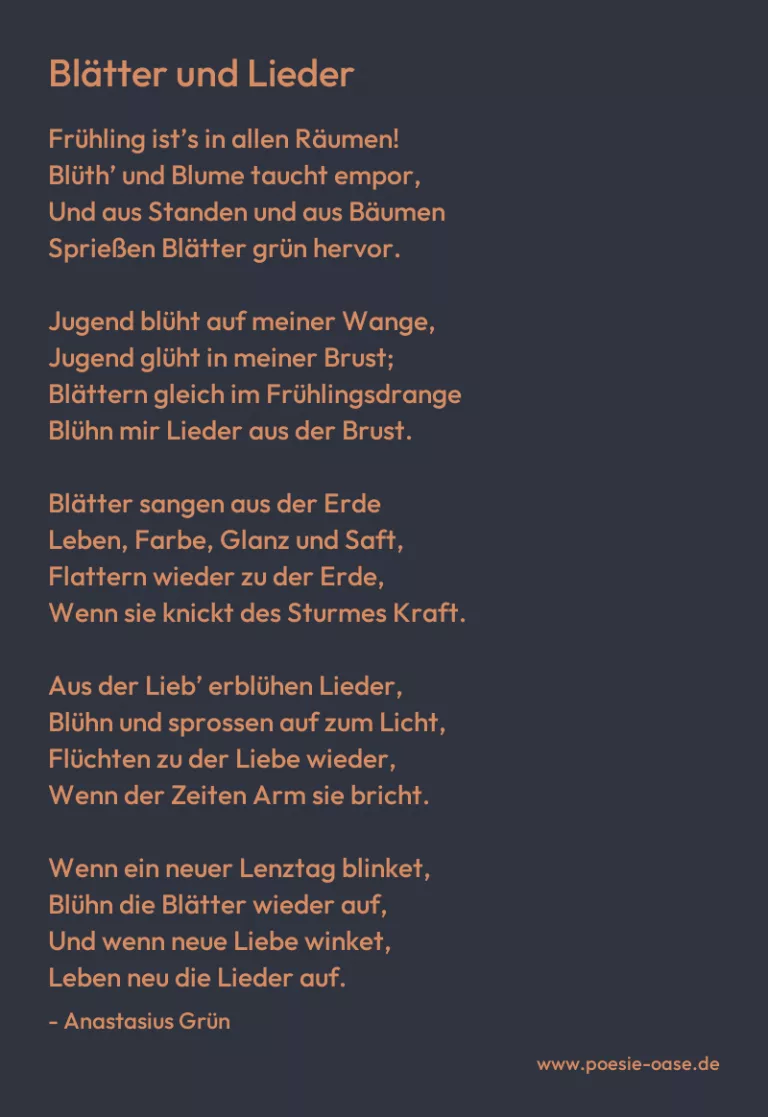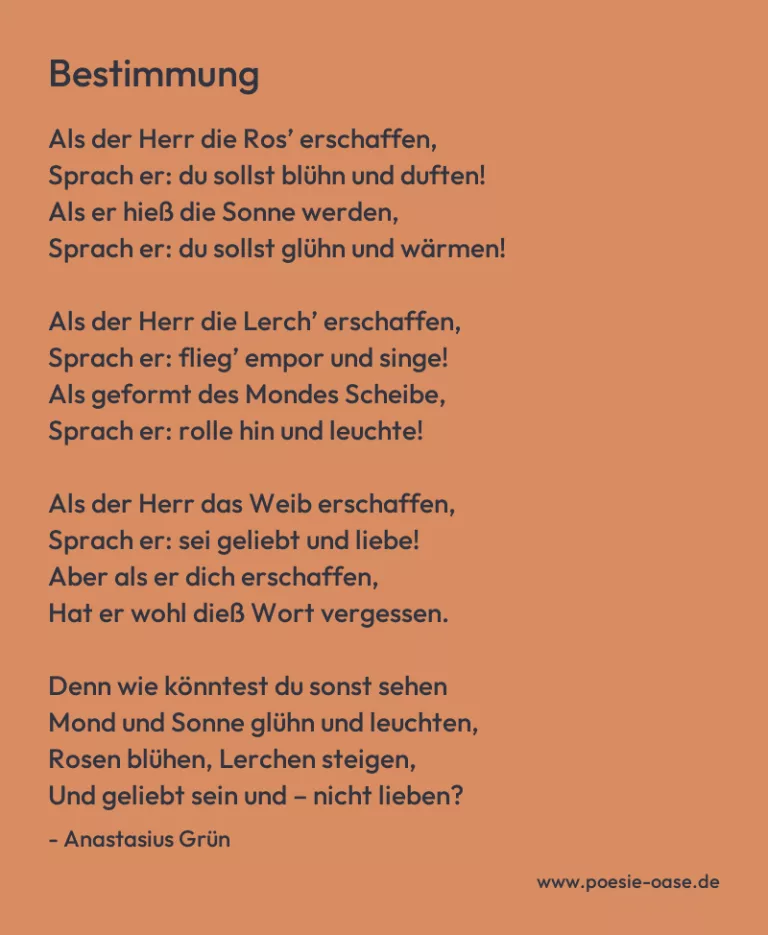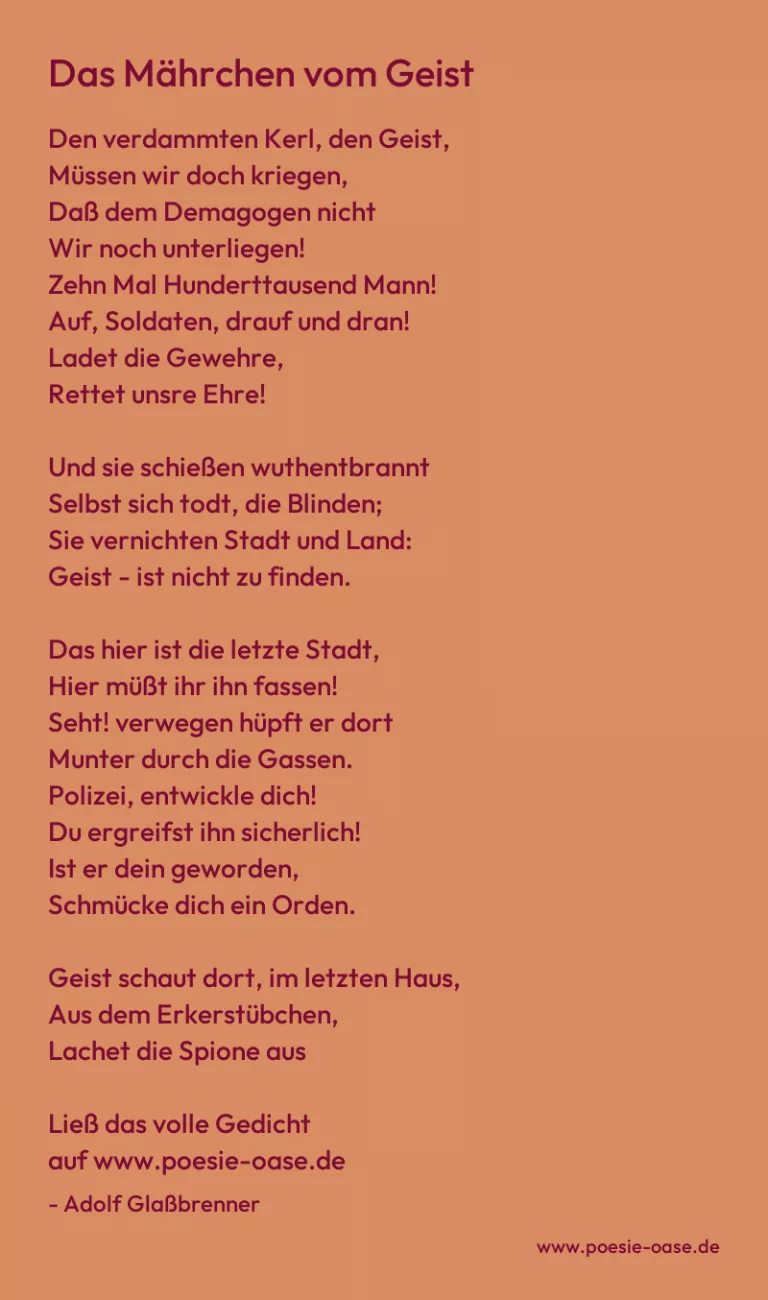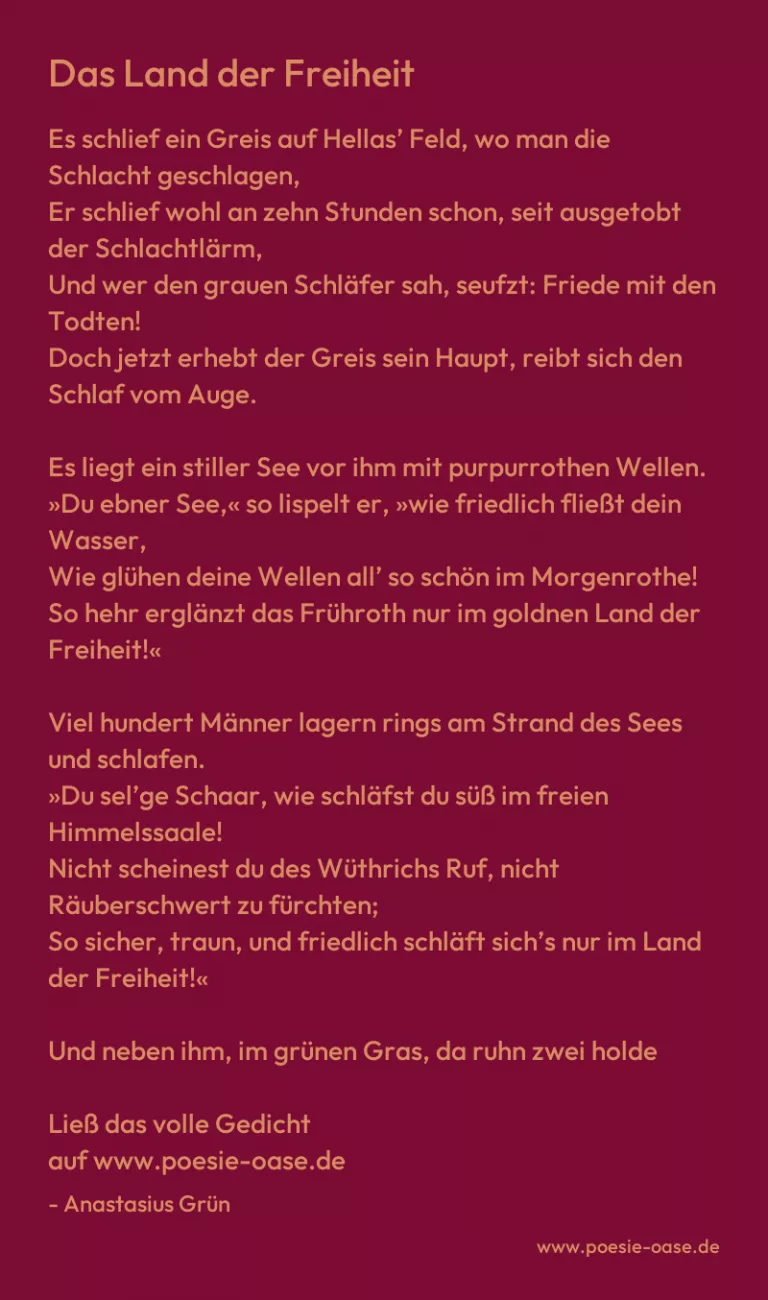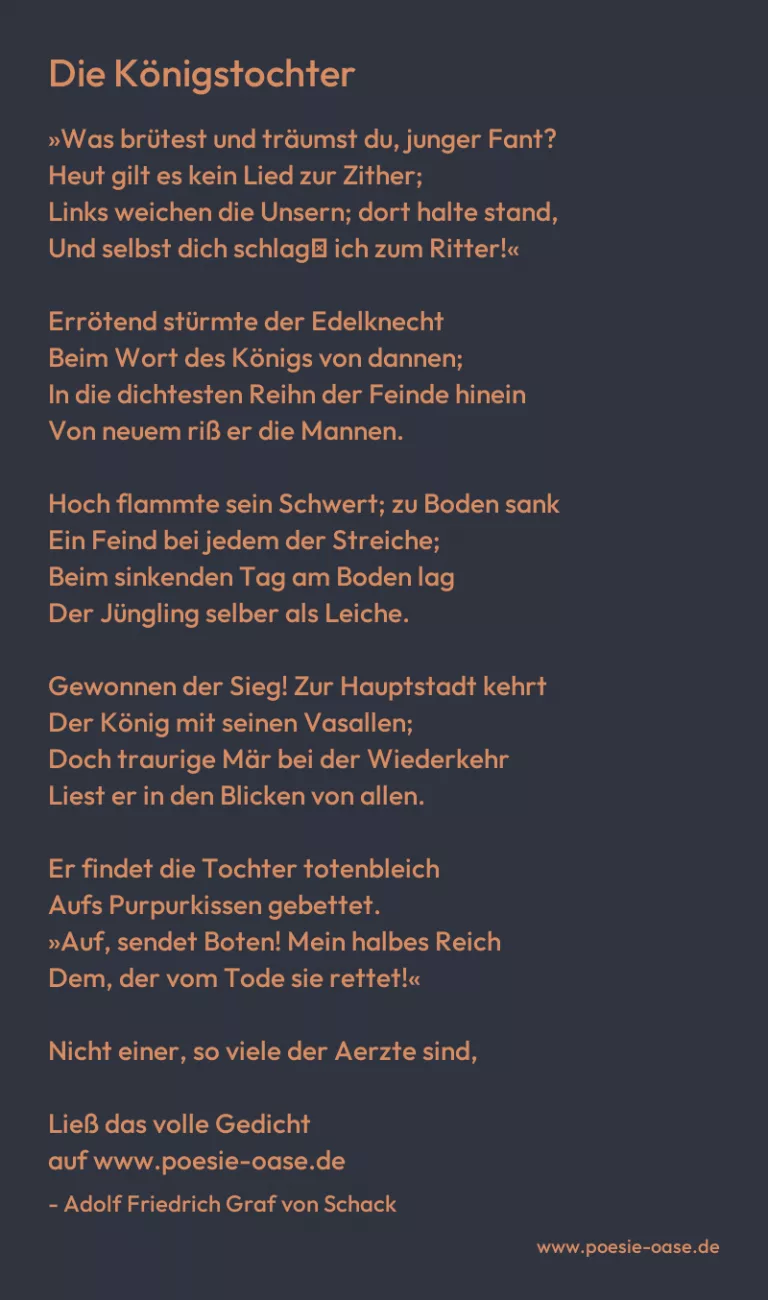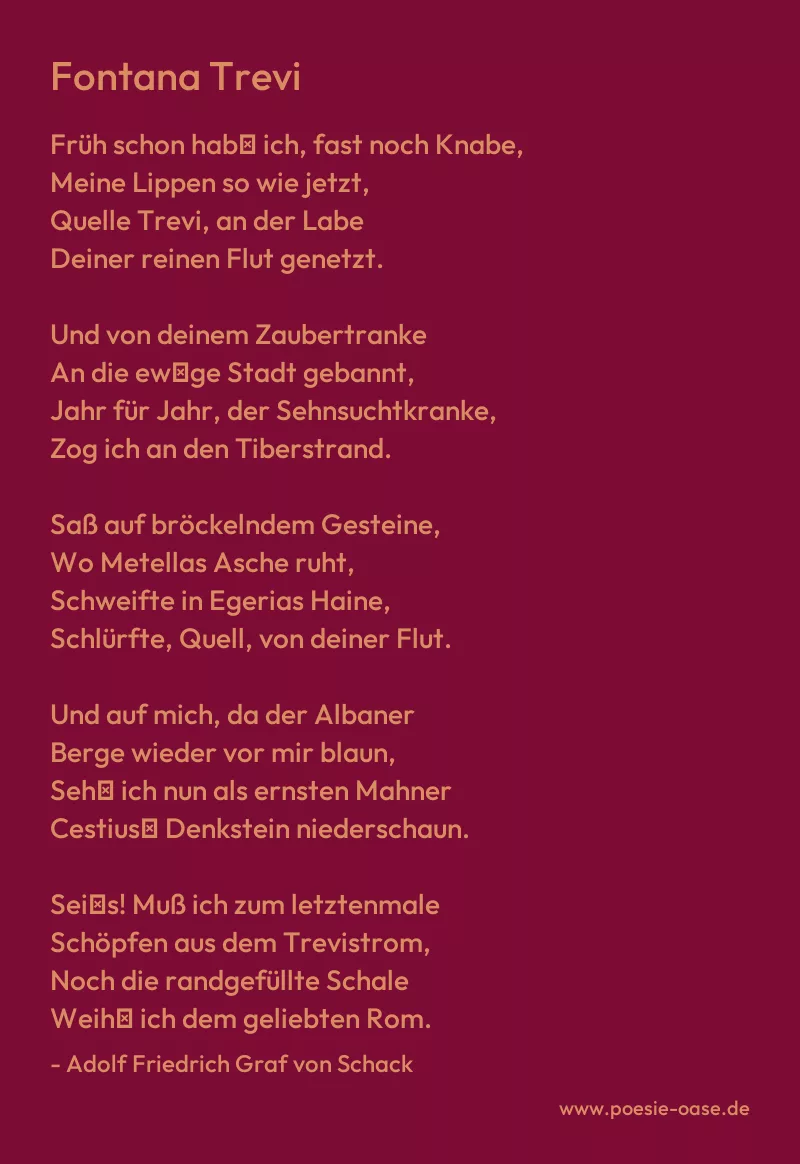Früh schon hab′ ich, fast noch Knabe,
Meine Lippen so wie jetzt,
Quelle Trevi, an der Labe
Deiner reinen Flut genetzt.
Und von deinem Zaubertranke
An die ew′ge Stadt gebannt,
Jahr für Jahr, der Sehnsuchtkranke,
Zog ich an den Tiberstrand.
Saß auf bröckelndem Gesteine,
Wo Metellas Asche ruht,
Schweifte in Egerias Haine,
Schlürfte, Quell, von deiner Flut.
Und auf mich, da der Albaner
Berge wieder vor mir blaun,
Seh′ ich nun als ernsten Mahner
Cestius′ Denkstein niederschaun.
Sei′s! Muß ich zum letztenmale
Schöpfen aus dem Trevistrom,
Noch die randgefüllte Schale
Weih′ ich dem geliebten Rom.