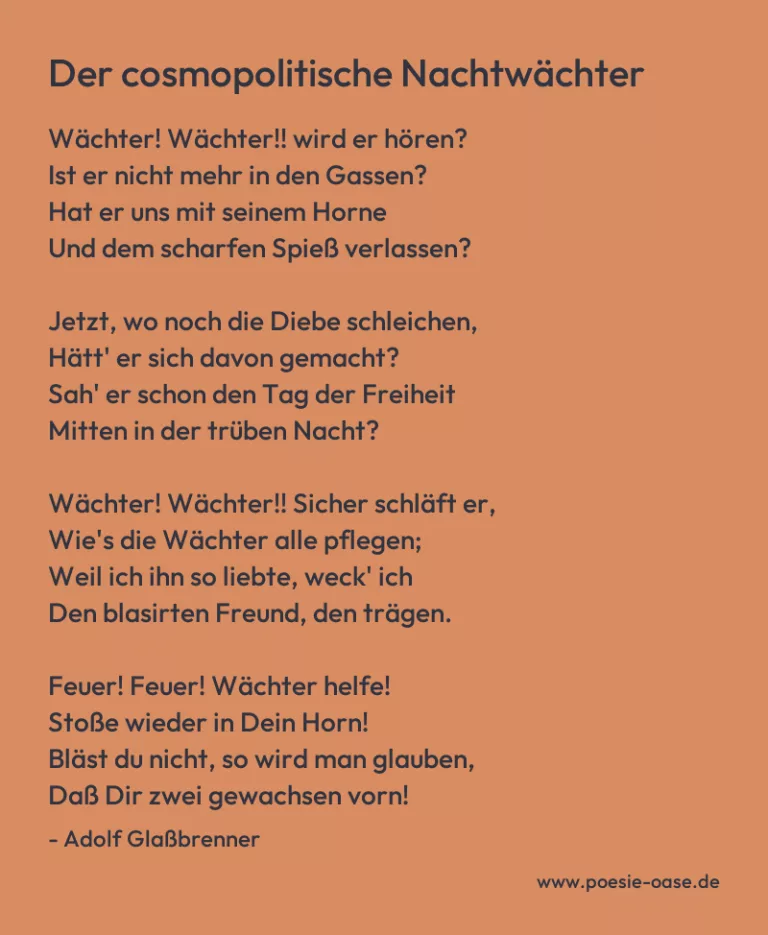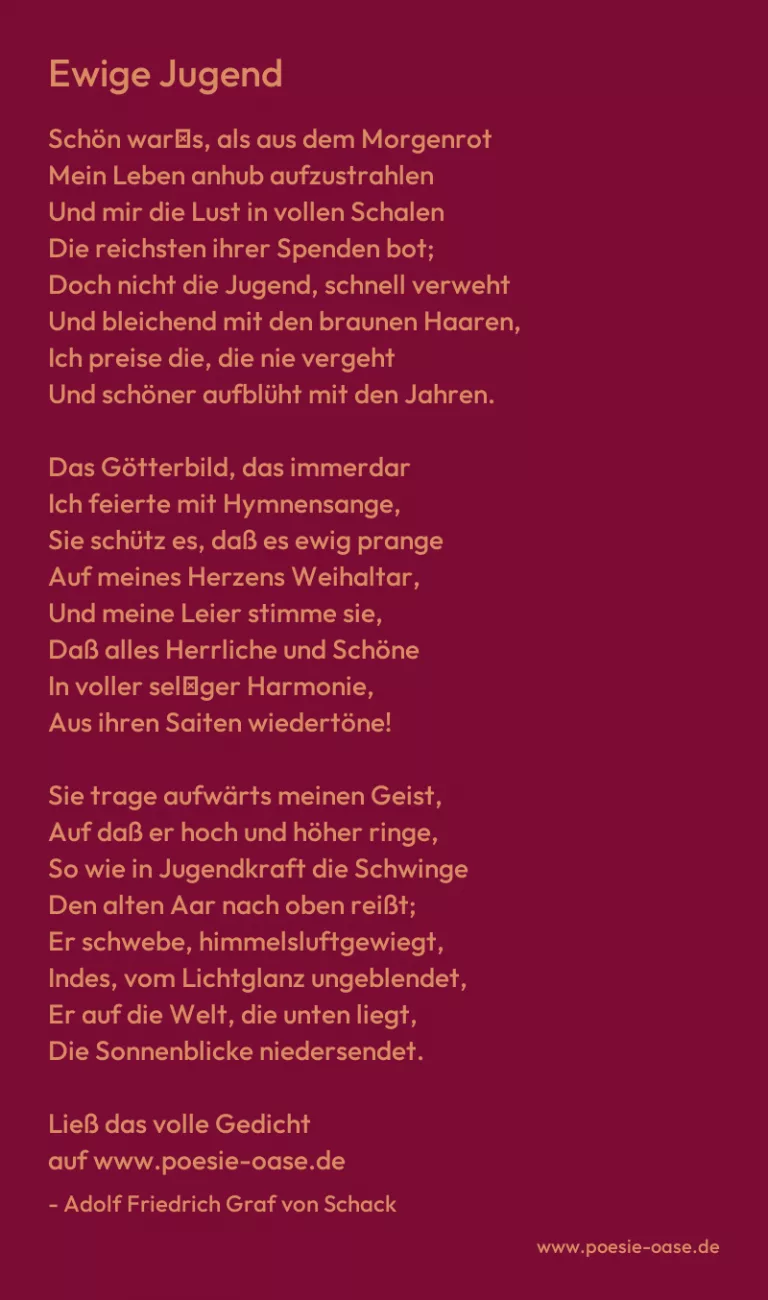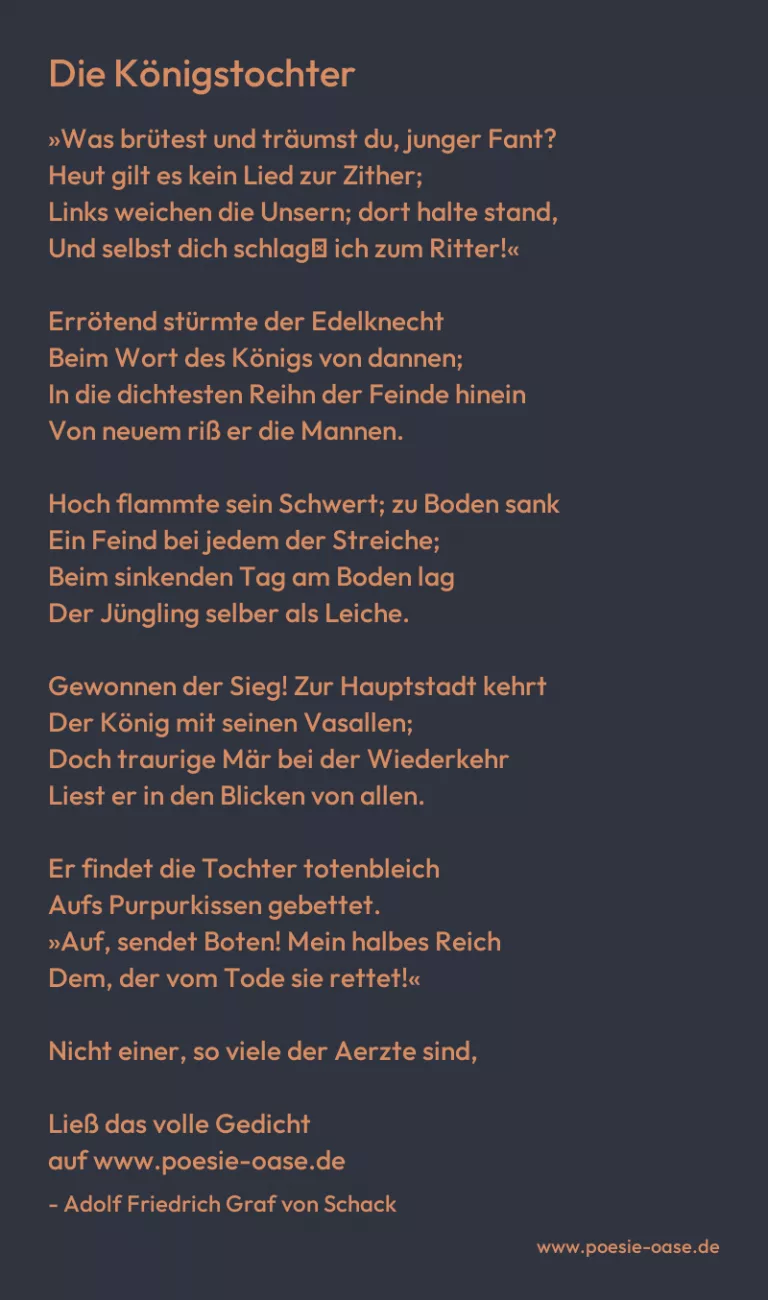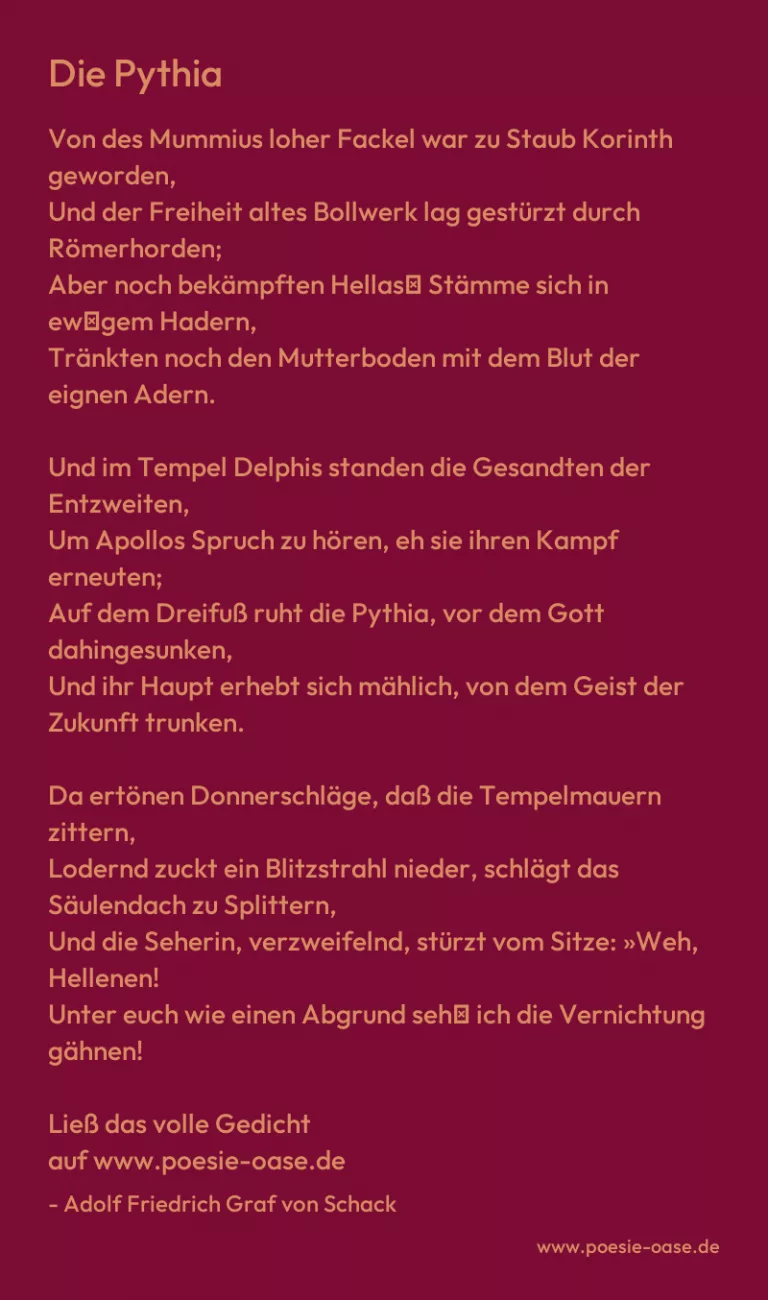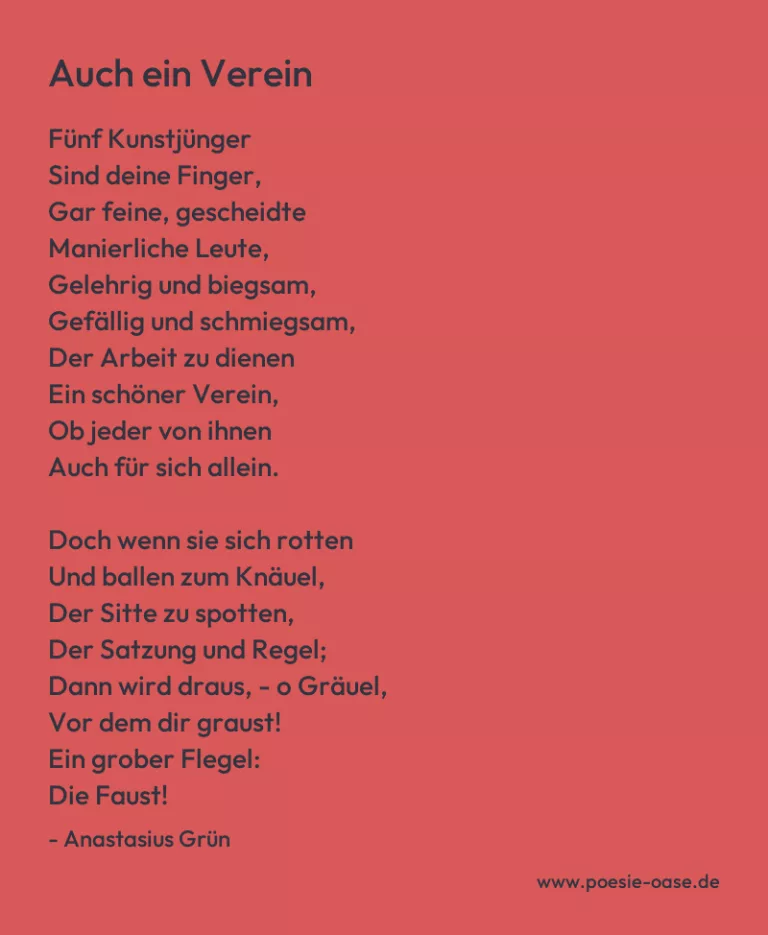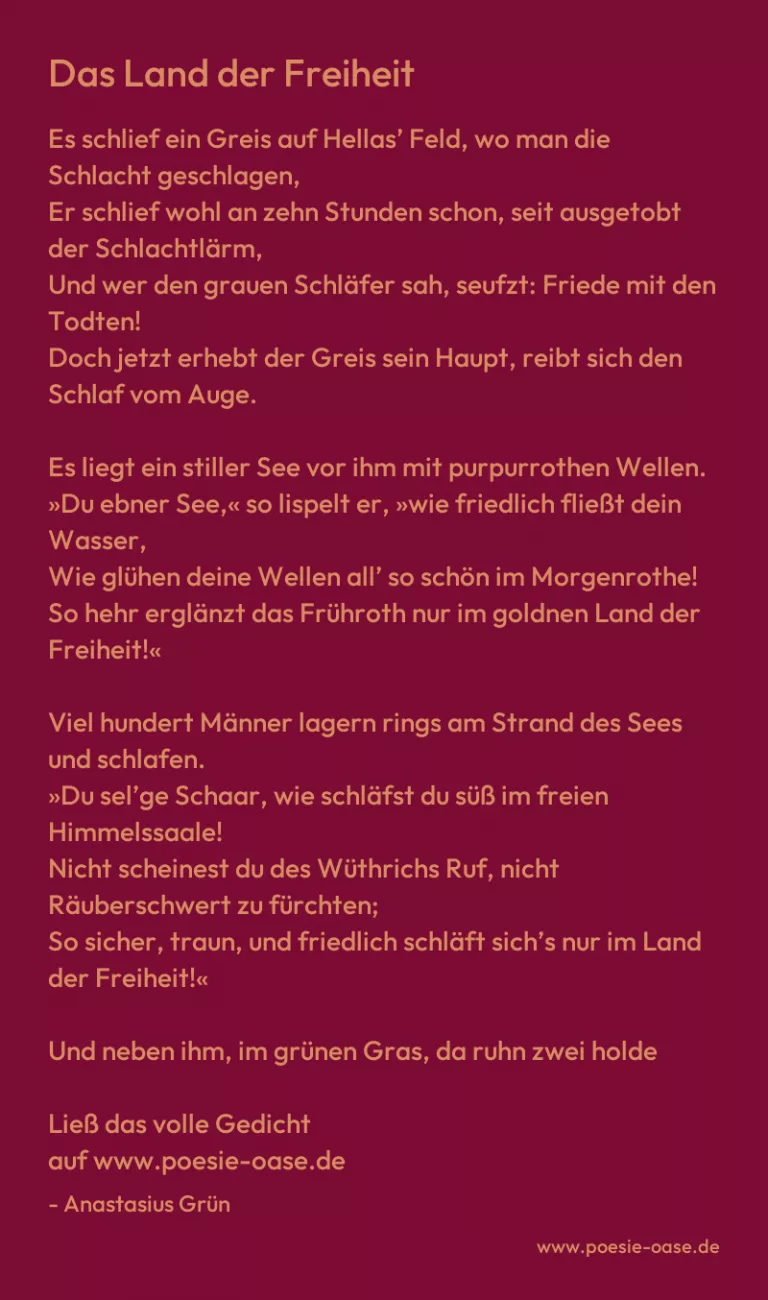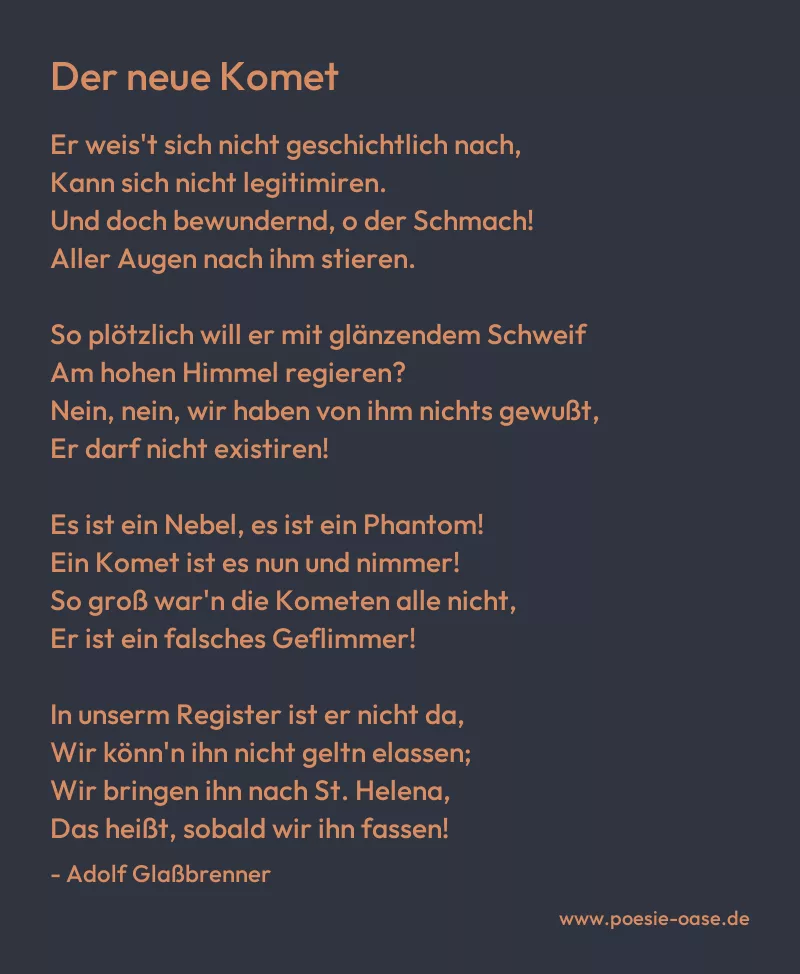Der neue Komet
Er weis’t sich nicht geschichtlich nach,
Kann sich nicht legitimiren.
Und doch bewundernd, o der Schmach!
Aller Augen nach ihm stieren.
So plötzlich will er mit glänzendem Schweif
Am hohen Himmel regieren?
Nein, nein, wir haben von ihm nichts gewußt,
Er darf nicht existiren!
Es ist ein Nebel, es ist ein Phantom!
Ein Komet ist es nun und nimmer!
So groß war’n die Kometen alle nicht,
Er ist ein falsches Geflimmer!
In unserm Register ist er nicht da,
Wir könn’n ihn nicht geltn elassen;
Wir bringen ihn nach St. Helena,
Das heißt, sobald wir ihn fassen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
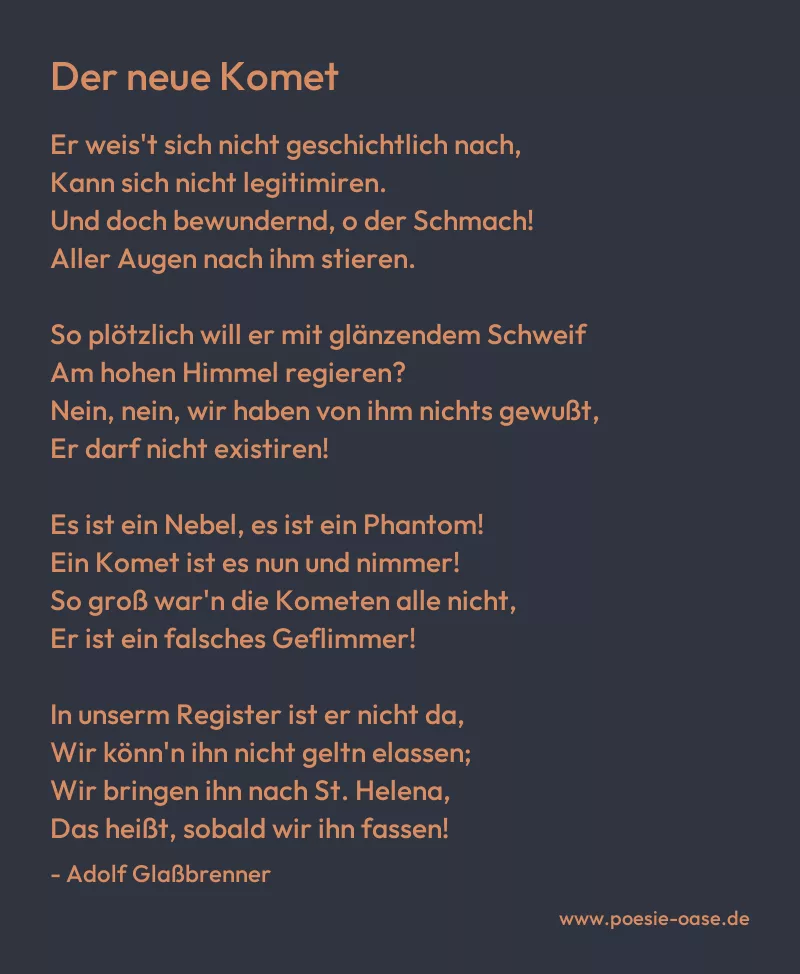
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der neue Komet“ von Adolf Glaßbrenner ist eine beißende Satire auf die Reaktion der etablierten Gesellschaft auf eine unerwartete und unkonventionelle Erscheinung – in diesem Fall einen Kometen. Die ersten beiden Strophen etablieren das Grundmotiv: Der Komet ist neu, „weis’t sich nicht geschichtlich nach“ und „kann sich nicht legitimieren“. Trotzdem zieht er die Blicke aller auf sich, was eine „Schmach“ für diejenigen darstellt, die sich etabliert und etabliert fühlen. Der Dichter spielt hier mit der Ironie, dass eine natürliche Erscheinung, die per Definition außerhalb der menschlichen Kontrolle liegt, von der Gesellschaft abgelehnt wird, weil sie nicht in das etablierte Ordnungssystem passt. Die Frage, ob der Komet am „hohen Himmel regieren“ darf, deutet auf den Anspruch der etablierten Ordnung hin, die Kontrolle über das Universum zu beanspruchen.
Die zweite Hälfte des Gedichts vertieft die satirische Kritik. Der Komet wird als „Nebel“, „Phantom“ und „falsches Geflimmer“ abgetan, um seine Existenz zu negieren. Die Ablehnung des Kometen wird auf eine bürokratische Ebene gehoben: „In unserm Register ist er nicht da, / Wir könn’n ihn nicht geltn elassen“. Hier offenbart sich die Engstirnigkeit und der Widerstand gegen das Neue und Unbekannte, das in der etablierten Ordnung keinen Platz findet. Glaßbrenner kritisiert die Tendenz der Gesellschaft, alles, was nicht in ihre vorgefassten Muster passt, abzulehnen und zu unterdrücken.
Die letzte Strophe gipfelt in der absurden Drohung, den Kometen „nach St. Helena“ zu bringen. St. Helena, bekannt als der Ort des Exils Napoleons, symbolisiert hier die Verbannung und Unterdrückung. Der Dichter verwandelt die astronomische Beobachtung in eine politische Allegorie, in der die Gesellschaft versucht, eine abweichende Erscheinung zu kontrollieren und zu zerstören, anstatt sie zu akzeptieren oder zu verstehen. Die Schlusspointe, „sobald wir ihn fassen“, ist ironisch, da ein Komet per Definition nicht „gefasst“ werden kann, und unterstreicht die Unfähigkeit der etablierten Ordnung, mit dem Neuen umzugehen.
Insgesamt ist das Gedicht eine scharfe Kritik an der Engstirnigkeit, dem Konservatismus und der Angst vor Veränderung, die in der Gesellschaft herrschen können. Glaßbrenner nutzte das Bild des Kometen, um die Reaktion der etablierten Ordnung auf das Unbekannte, das Neue und das Ungewöhnliche zu persiflieren und die Leser zum Nachdenken über ihre eigene Akzeptanz des Wandels und der Andersartigkeit anzuregen. Der satirische Ton und die einfache, zugängliche Sprache machen die Botschaft des Gedichts auch heute noch relevant.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.