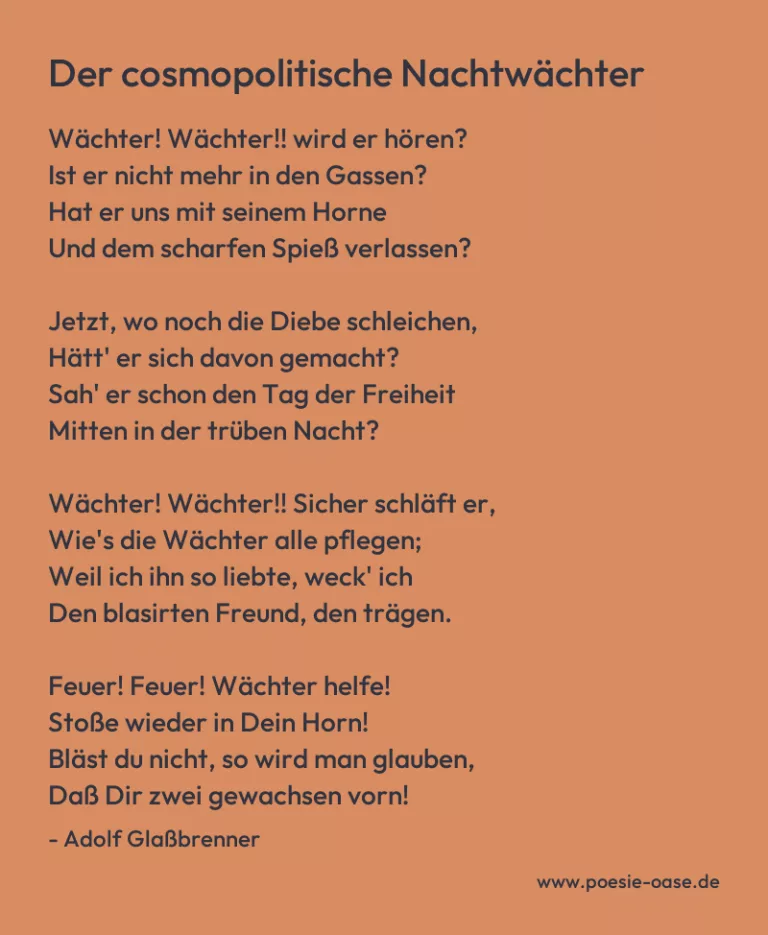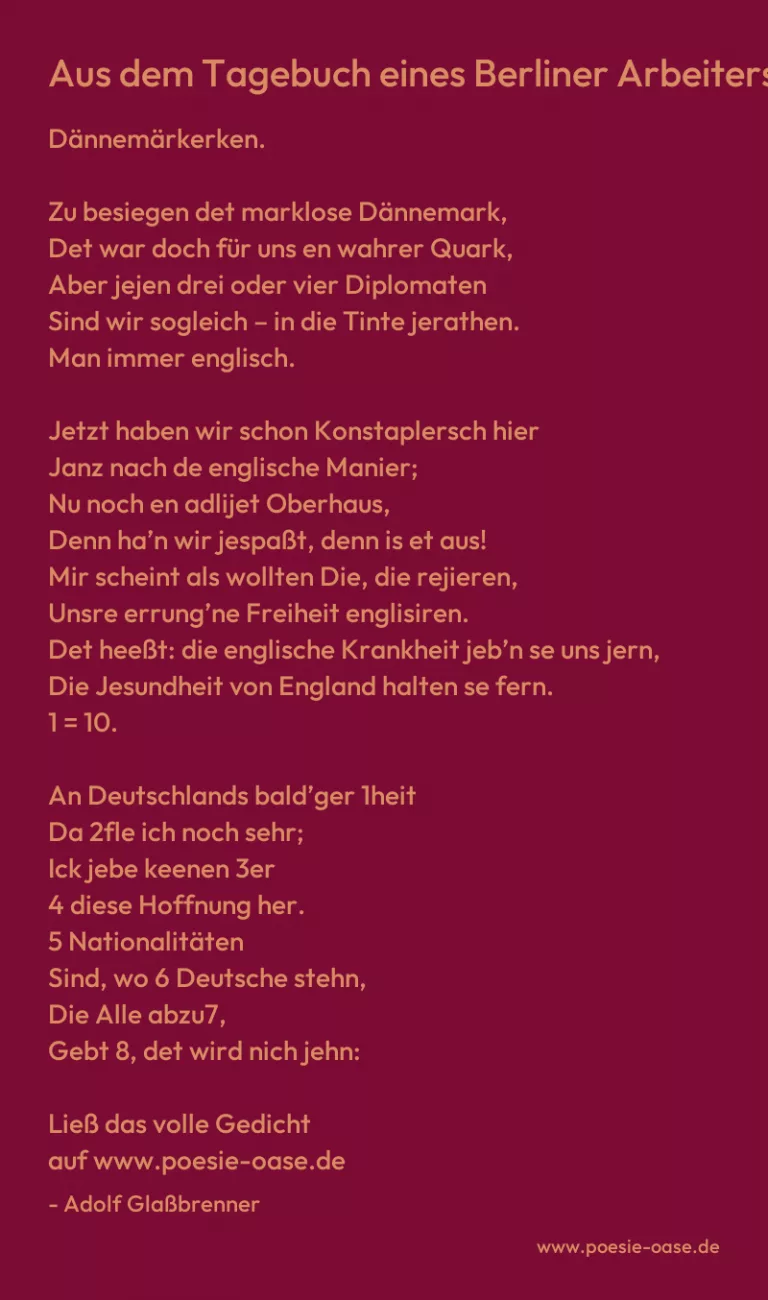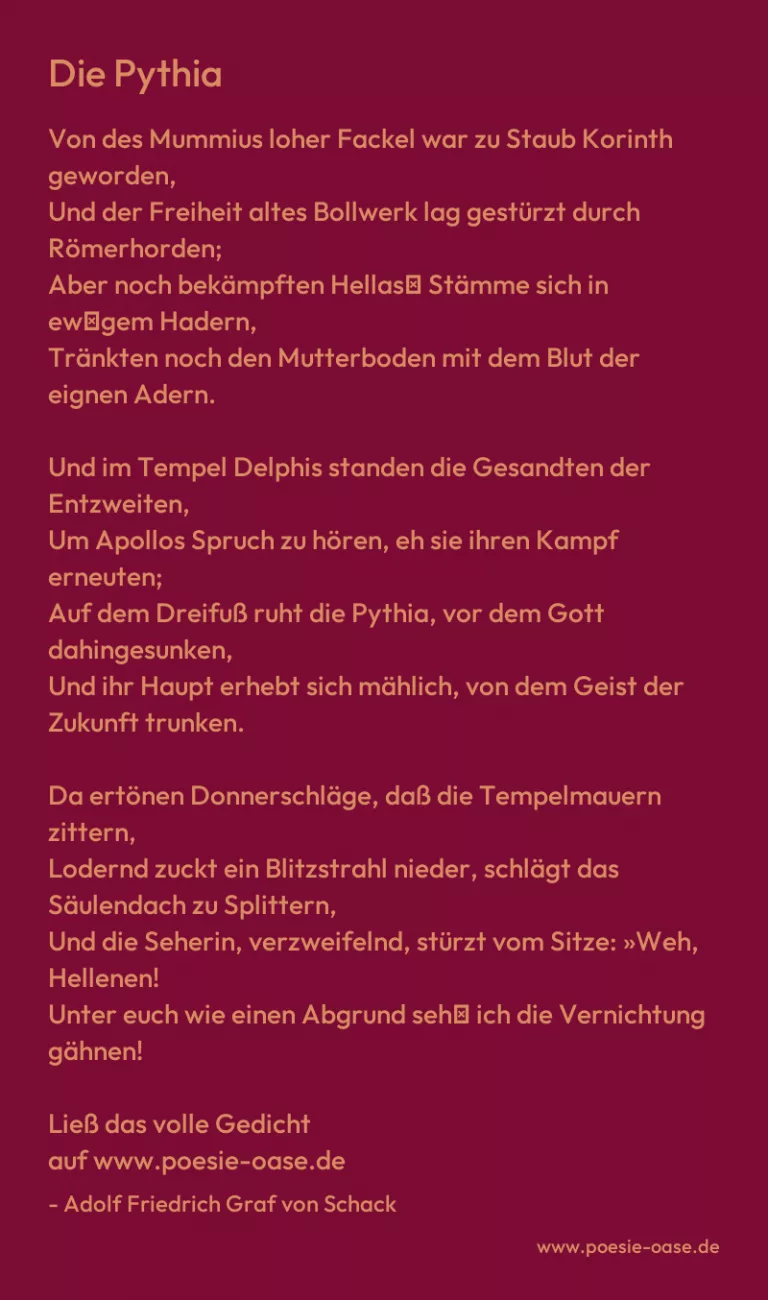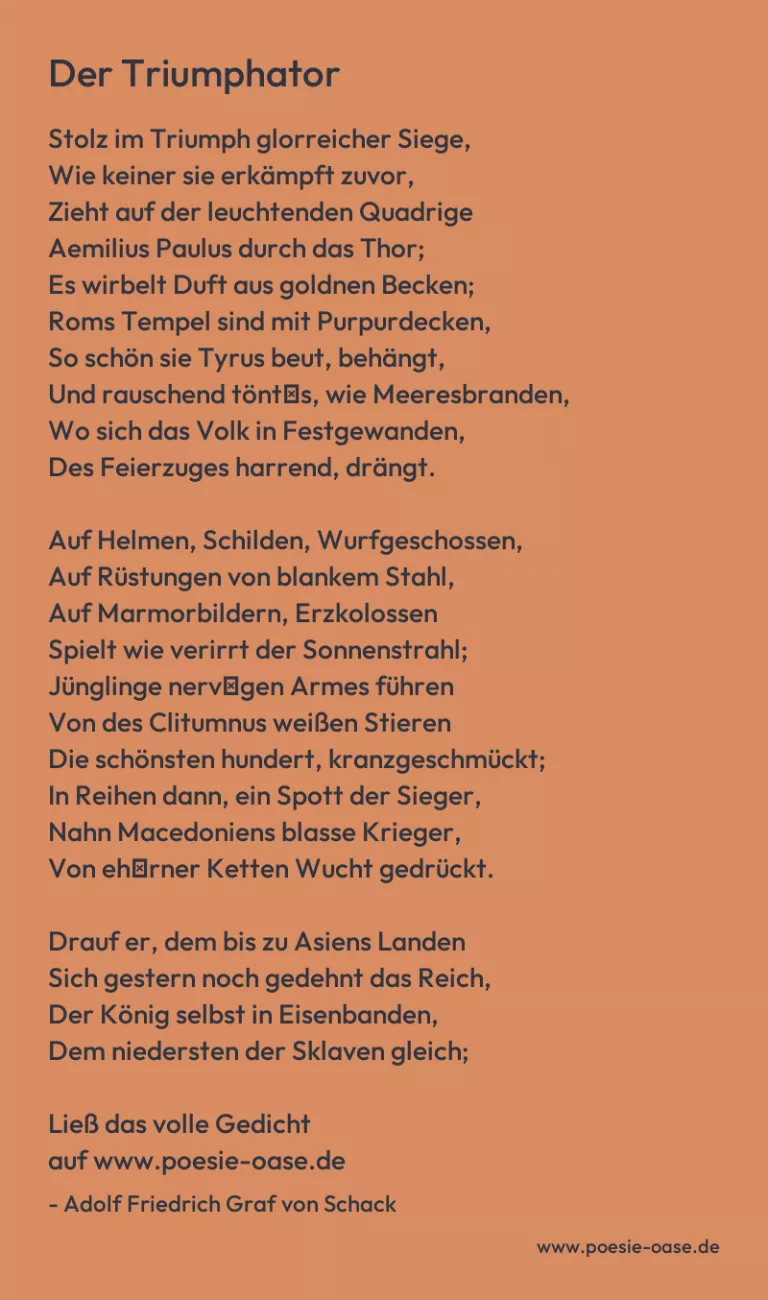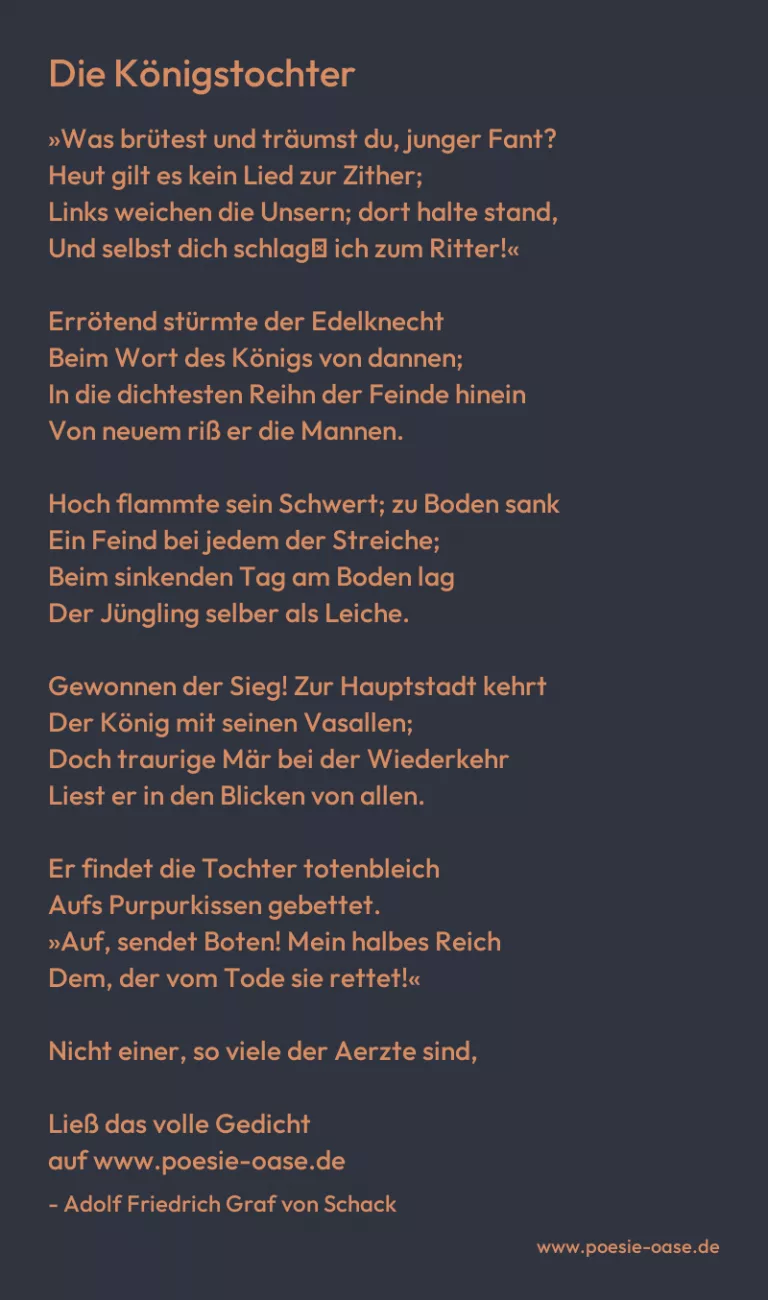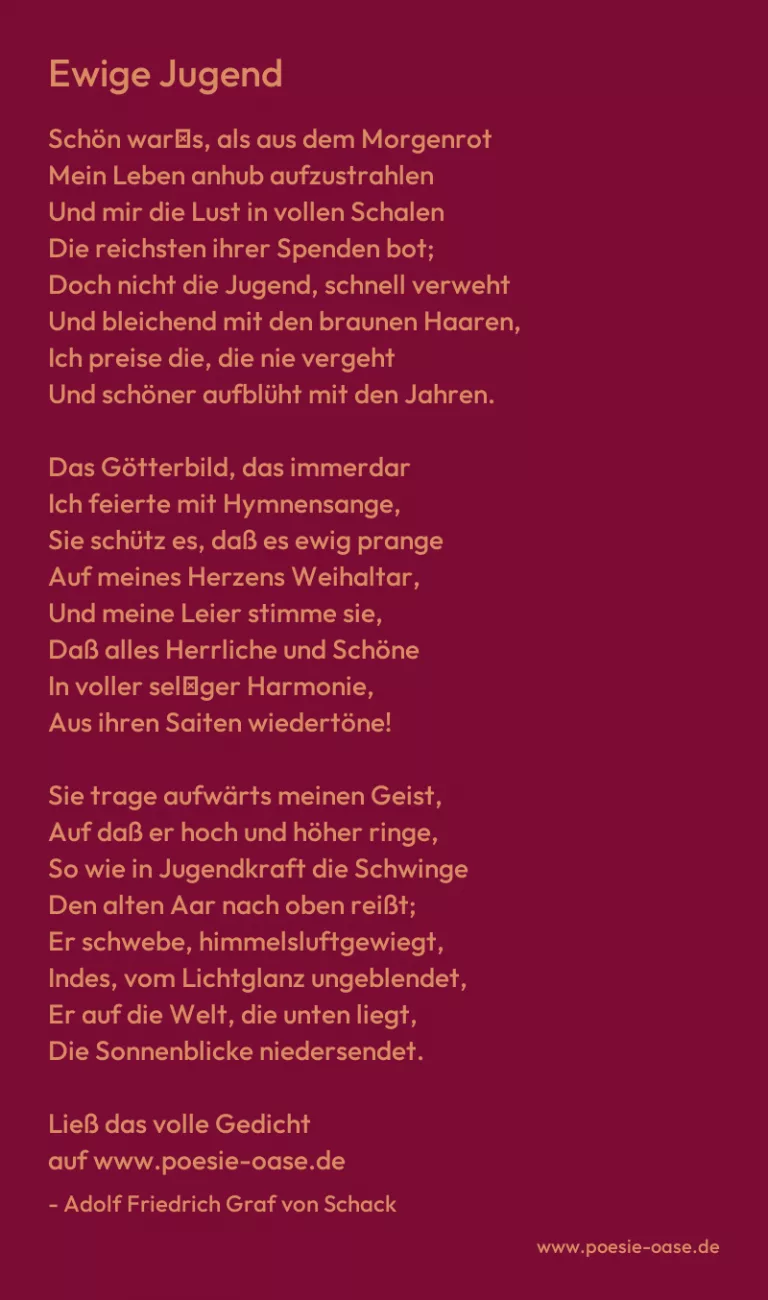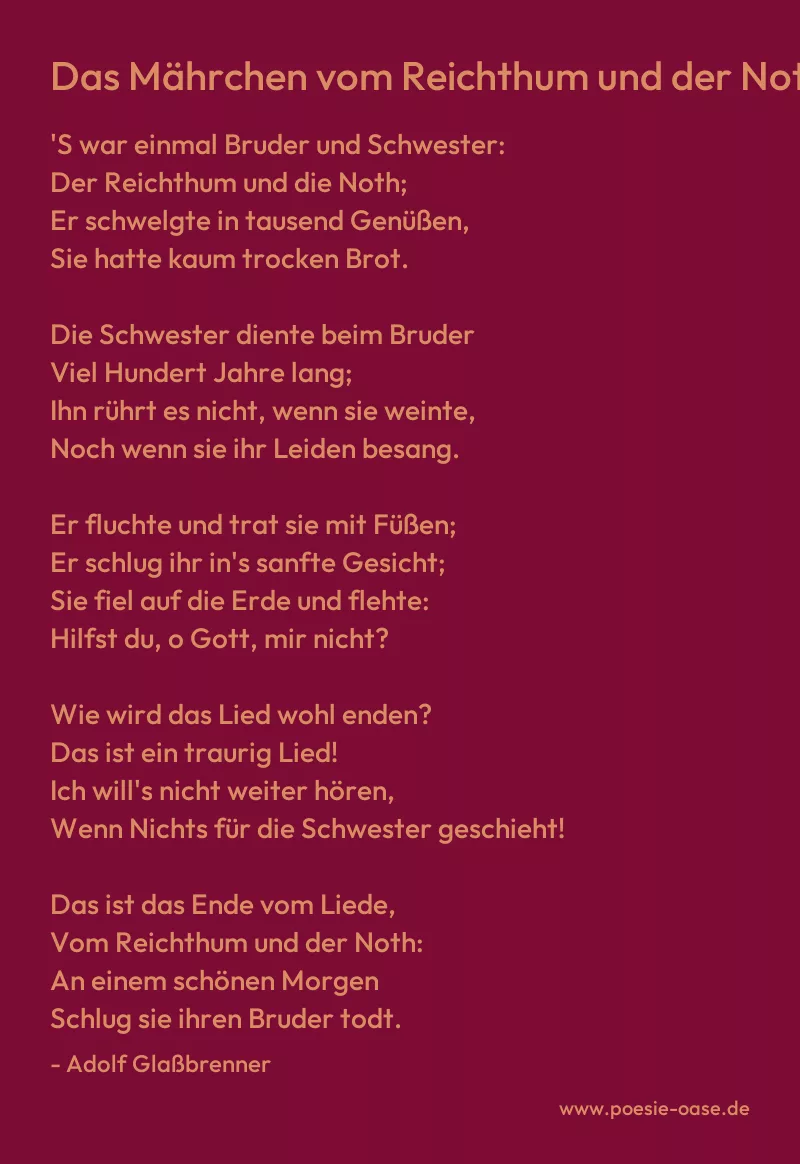Das Mährchen vom Reichthum und der Noth
‚S war einmal Bruder und Schwester:
Der Reichthum und die Noth;
Er schwelgte in tausend Genüßen,
Sie hatte kaum trocken Brot.
Die Schwester diente beim Bruder
Viel Hundert Jahre lang;
Ihn rührt es nicht, wenn sie weinte,
Noch wenn sie ihr Leiden besang.
Er fluchte und trat sie mit Füßen;
Er schlug ihr in’s sanfte Gesicht;
Sie fiel auf die Erde und flehte:
Hilfst du, o Gott, mir nicht?
Wie wird das Lied wohl enden?
Das ist ein traurig Lied!
Ich will’s nicht weiter hören,
Wenn Nichts für die Schwester geschieht!
Das ist das Ende vom Liede,
Vom Reichthum und der Noth:
An einem schönen Morgen
Schlug sie ihren Bruder todt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
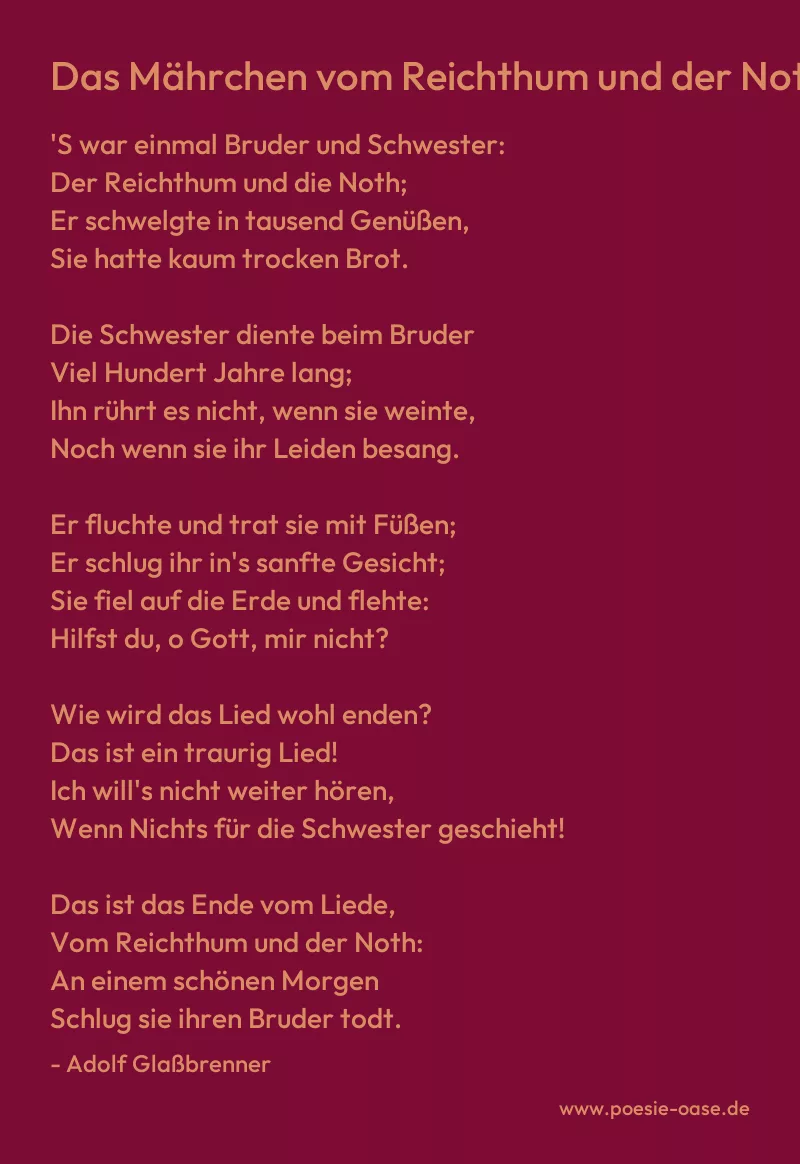
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Mährchen vom Reichthum und der Noth“ von Adolf Glaßbrenner erzählt in einfacher, volkstümlicher Sprache eine Geschichte von Ungleichheit, Unterdrückung und schließlich von Rache. Es präsentiert zwei allegorische Figuren, Reichthum und Noth (Armut), die in einem klaren Machtungleichgewicht zueinander stehen. Der reiche Bruder lebt in Saus und Braus, während die arme Schwester unter ihm leidet und ausgebeutet wird. Glaßbrenner nutzt hierbei eine schlichte Reimstruktur (ABAB), um die Botschaft des Gedichts für ein breites Publikum zugänglich zu machen.
Die ersten drei Strophen beschreiben detailliert das Verhältnis zwischen den Geschwistern. Der Reichthum herrscht, flucht, misshandelt und verachtet die Noth, die ihm untertan ist. Die Noth wird in ihrer Not nicht erhört, sondern fleht vergeblich um Hilfe, was die Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit ihrer Situation verdeutlicht. Diese Darstellung ist von großer sozialer Brisanz, da sie die Ungleichheit der sozialen Klassen anprangert und die Perspektive der Unterdrückten einnimmt. Die direkten Aussagen und das Fehlen jeglicher subtiler Metaphorik unterstreichen die Direktheit und das politische Engagement des Gedichts.
Die vierte Strophe stellt eine Zäsur dar, indem sie die Reaktion des erzählenden Ichs auf das bisher Gehörte thematisiert. Der Erzähler zeigt Mitgefühl für die Noth und lehnt es ab, die Geschichte fortzusetzen, wenn sich an ihrer Situation nichts ändert. Diese Reaktion deutet auf eine klare moralische Position des Erzählers hin, der sich mit der Noth solidarisiert und die Ungerechtigkeit des Reichtums verurteilt. Diese Pause im Erzählfluss steigert die Spannung und bereitet den Leser auf den Wendepunkt vor.
Die letzte Strophe markiert den unerwarteten und drastischen Schluss: Die Noth tötet ihren Bruder, den Reichthum. Dieser Akt der Gewalt ist eine Reaktion auf die jahrelange Unterdrückung und die fehlende Aussicht auf Besserung. Er ist ein Ausdruck des Zorns und der Verzweiflung, aber auch eine radikale Kritik an der bestehenden Ordnung. Das Gedicht endet mit einer überraschenden Umkehrung der Machtverhältnisse, die jedoch auch eine bittere Wahrheit offenbart: Manchmal scheint Gewalt der einzige Ausweg aus extremer Ungerechtigkeit zu sein. Das Gedicht ist ein eindringliches Plädoyer für soziale Gerechtigkeit und eine Anklage gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.