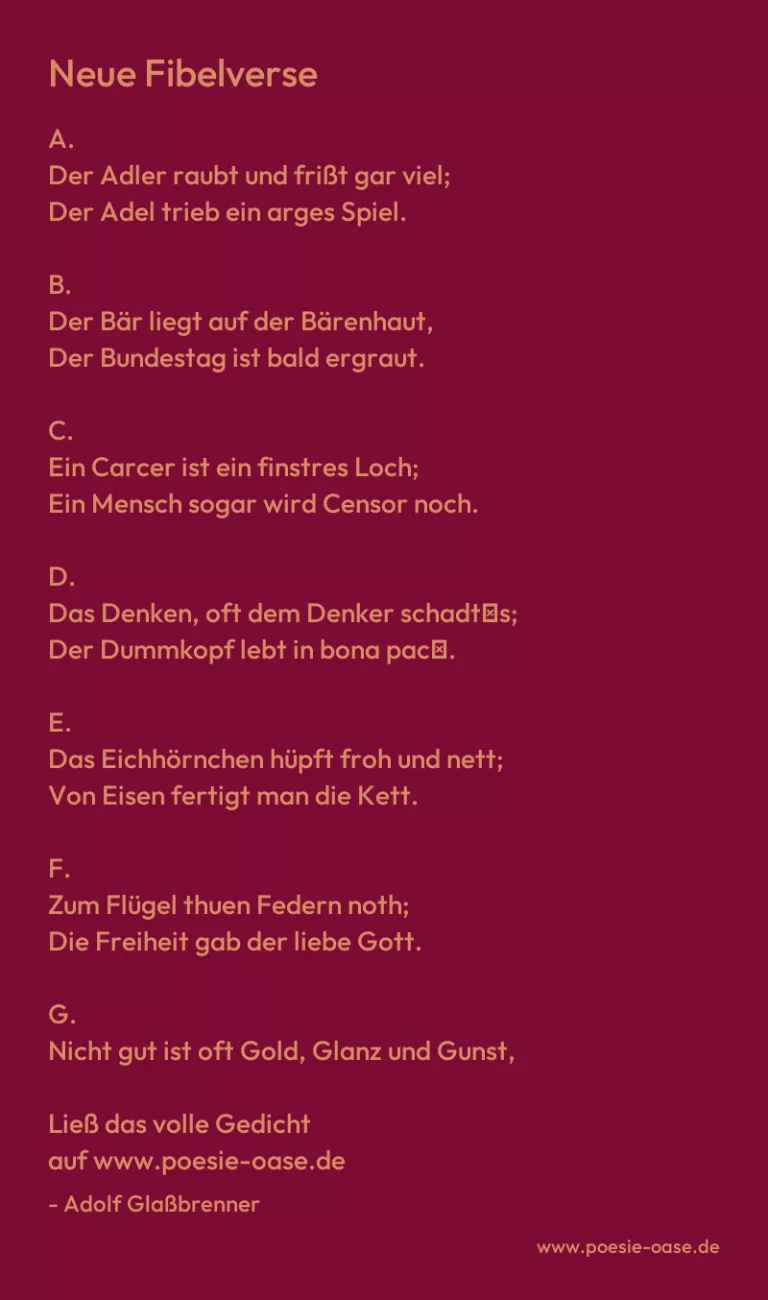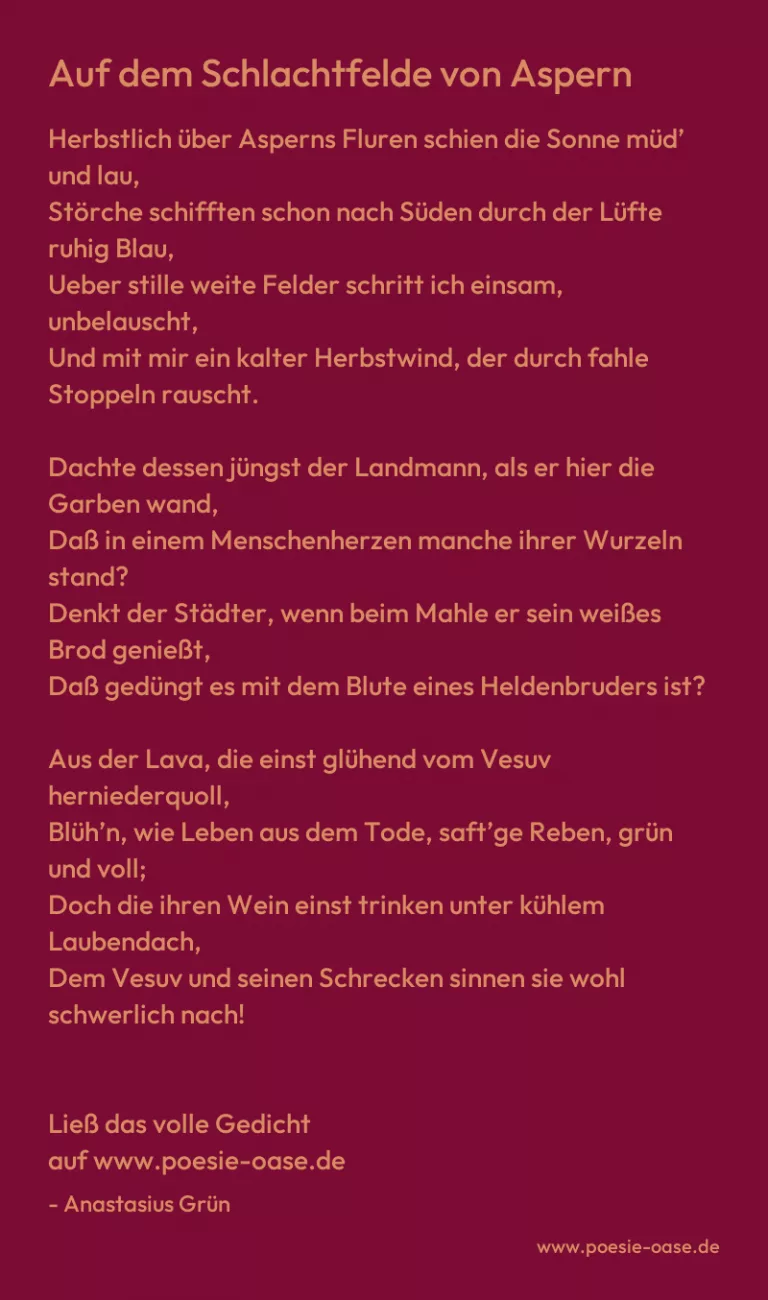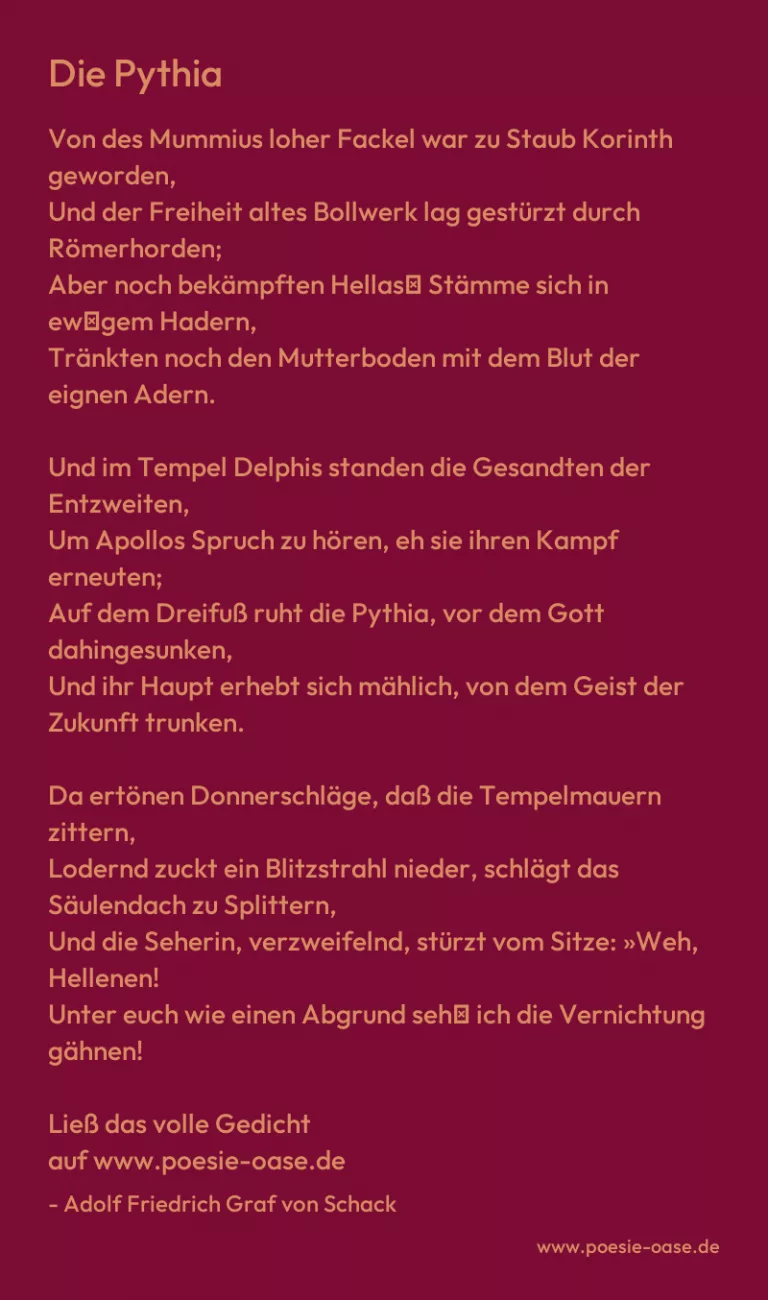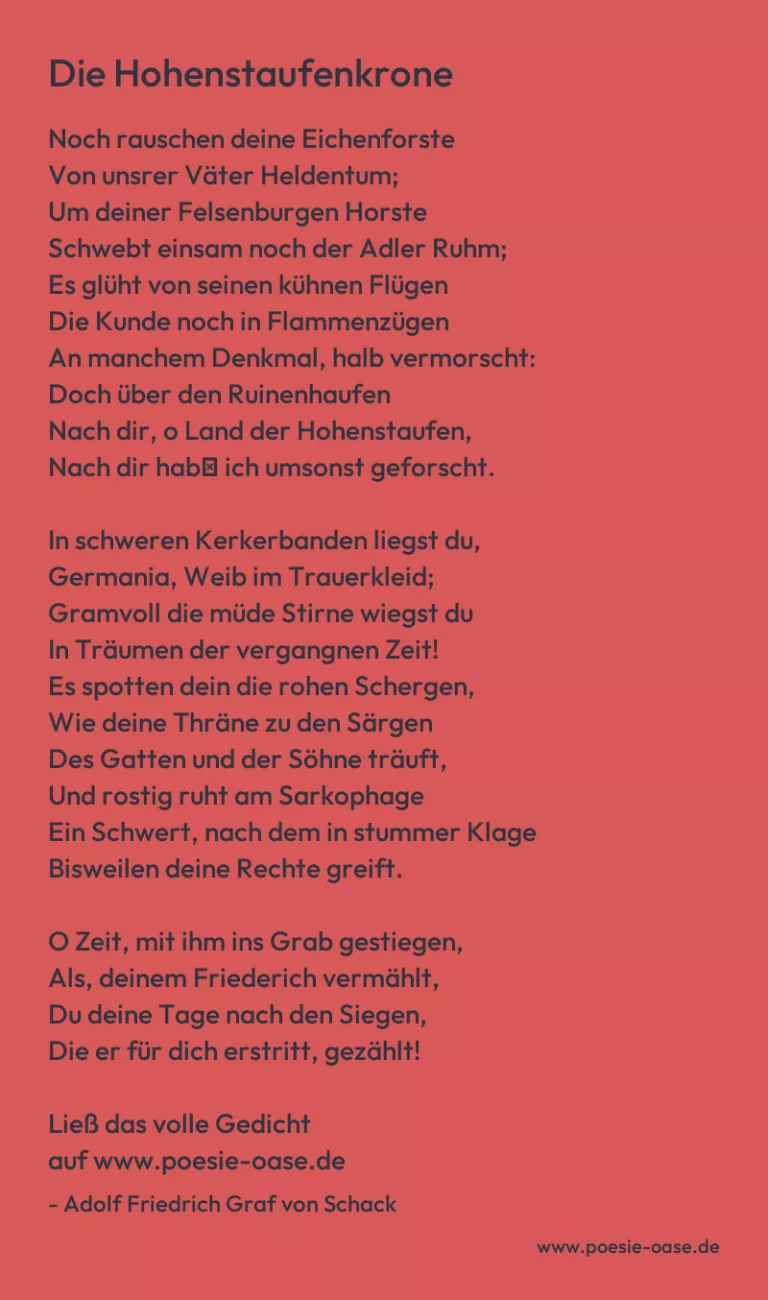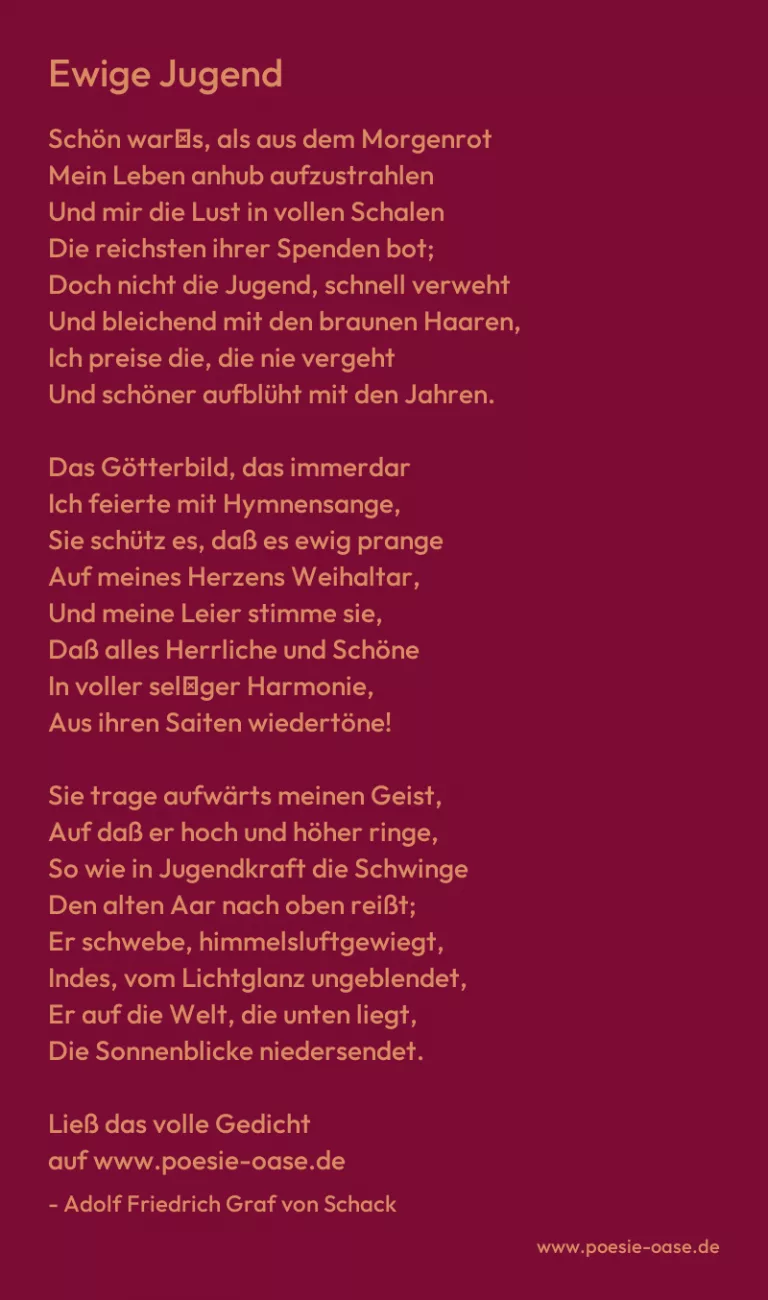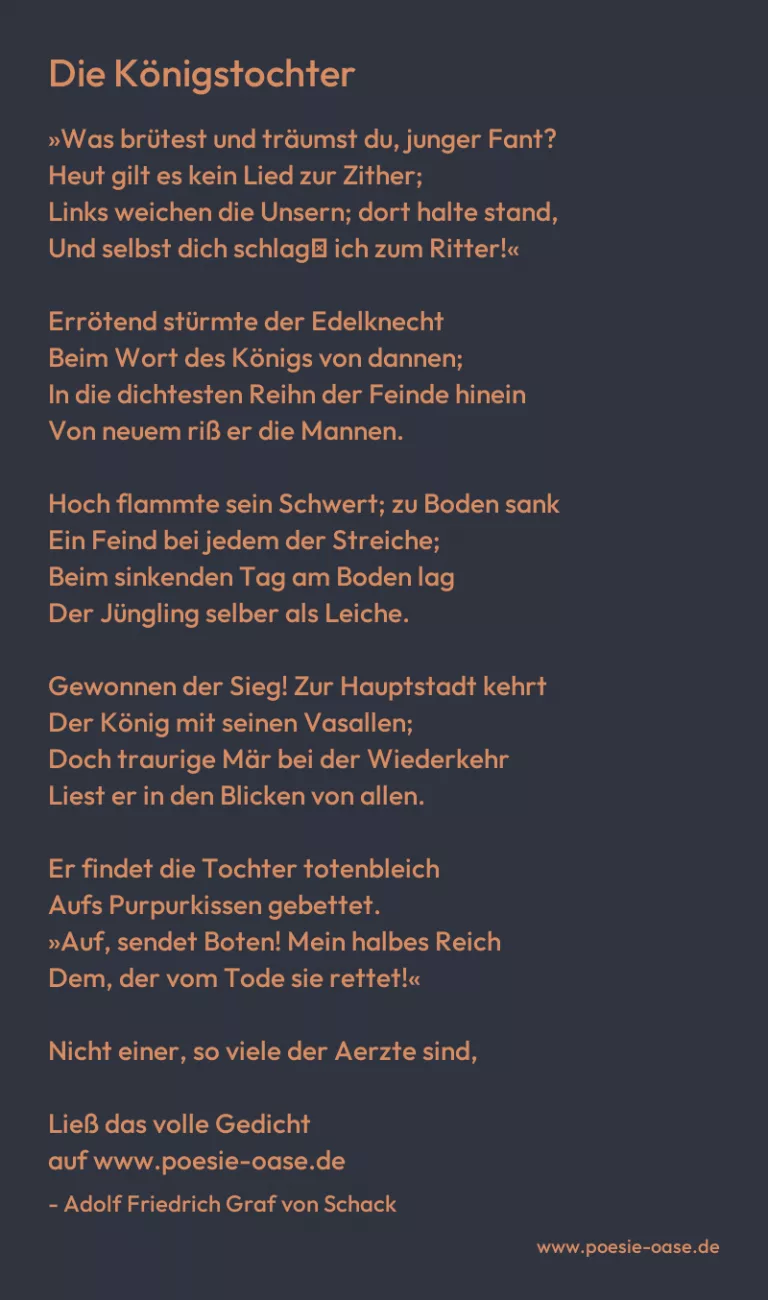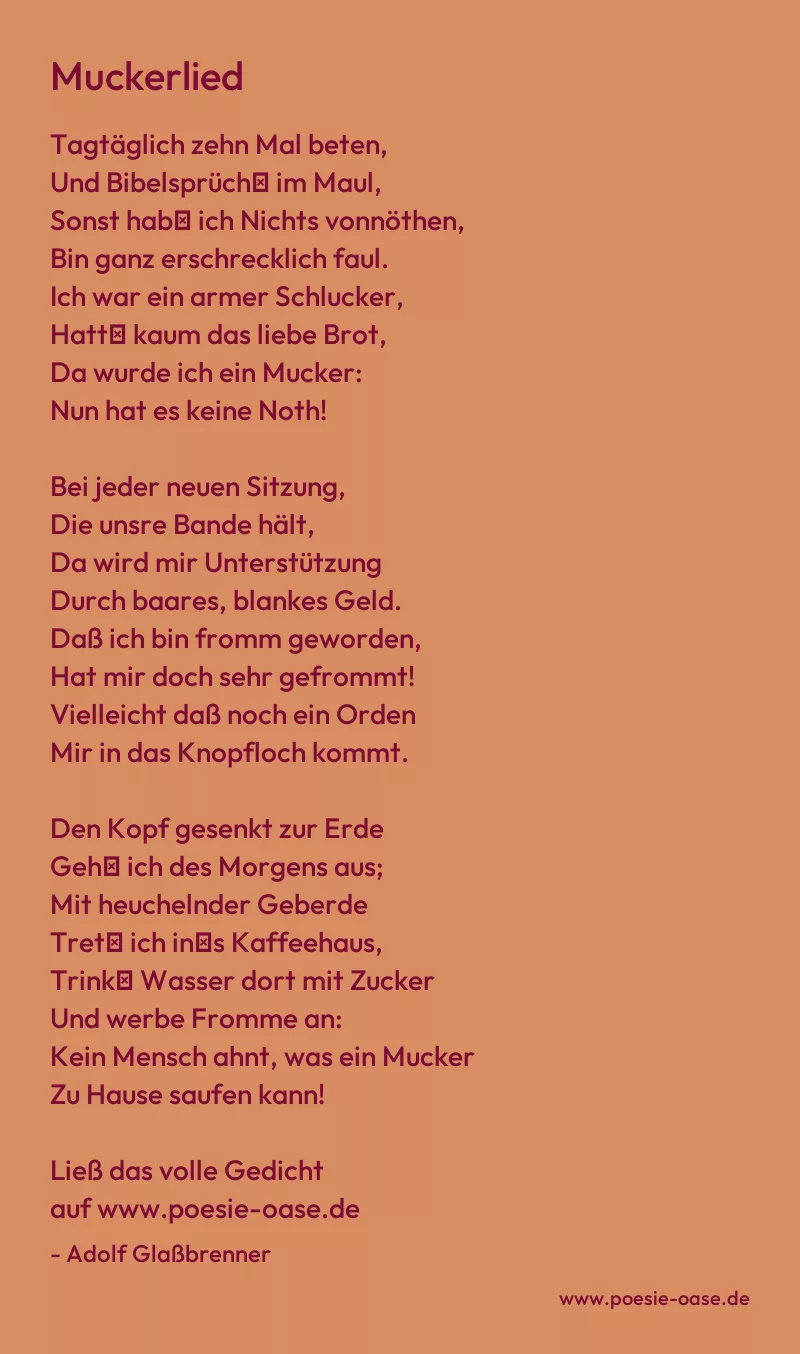Tagtäglich zehn Mal beten,
Und Bibelsprüch′ im Maul,
Sonst hab′ ich Nichts vonnöthen,
Bin ganz erschrecklich faul.
Ich war ein armer Schlucker,
Hatt′ kaum das liebe Brot,
Da wurde ich ein Mucker:
Nun hat es keine Noth!
Bei jeder neuen Sitzung,
Die unsre Bande hält,
Da wird mir Unterstützung
Durch baares, blankes Geld.
Daß ich bin fromm geworden,
Hat mir doch sehr gefrommt!
Vielleicht daß noch ein Orden
Mir in das Knopfloch kommt.
Den Kopf gesenkt zur Erde
Geh′ ich des Morgens aus;
Mit heuchelnder Geberde
Tret′ ich in′s Kaffeehaus,
Trink′ Wasser dort mit Zucker
Und werbe Fromme an:
Kein Mensch ahnt, was ein Mucker
Zu Hause saufen kann!
Zu hohem Zins verleih′ ich,
Was ich beim Muckern spar′,
Und meine Seele weih′ ich
Herrn Jesu immerdar,
Und den Gewinn notir′ ich
Im frommen Liederheft,
Auf diese Weise führ′ ich
In Frieden mein Geschäft.
Des Abends im Theater
Sitz′ ich mit gierem Sinn,
Und schmunzle wie ein Kater
Nach jeder Tänzerin;
Mit meinem Operngucker
Schau′ ich nach Wad′ und Brust;
Ach lieber Gott! ein Mucker
Hat auch so seine Lust!
Dann schleich′ ich still zur Klause,
Da, wo mich Niemand sieht,
Und nach dem Abendschmause
Sing′ ich ein frommes Lied,
Recht laut: von heil′ger Stätte,
Von Jesu, Glanz und Thron!
Daweile macht mein Bette
Die kleine Köchin schon.
Ich preise die Regierung,
Ich finde Alles gut;
Ich fluche der Verführung
Durch jetz′ge Freiheitsbrut;
So leb′ ich armer Schlucker
Ganz heiter, Gott sei Dank!
Und das Geschäft als Mucker
Treib′ ich mein Lebenlang.