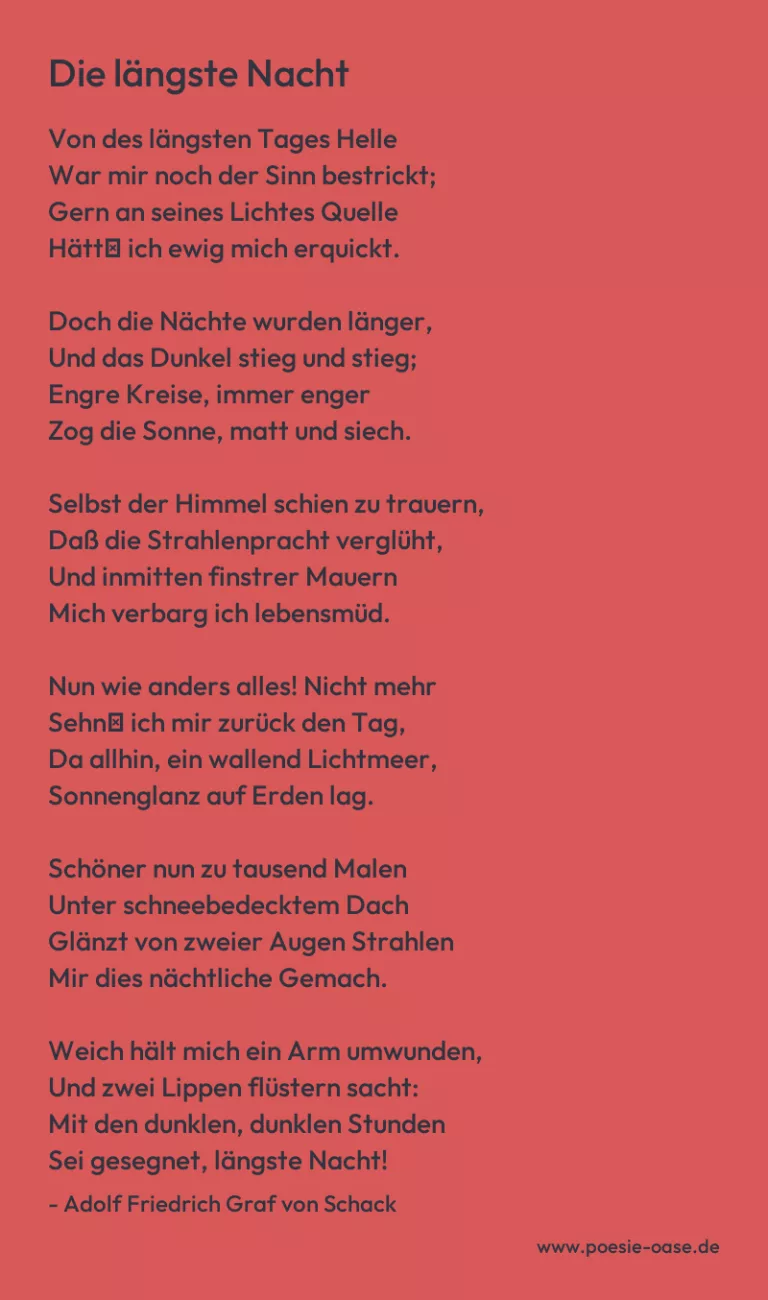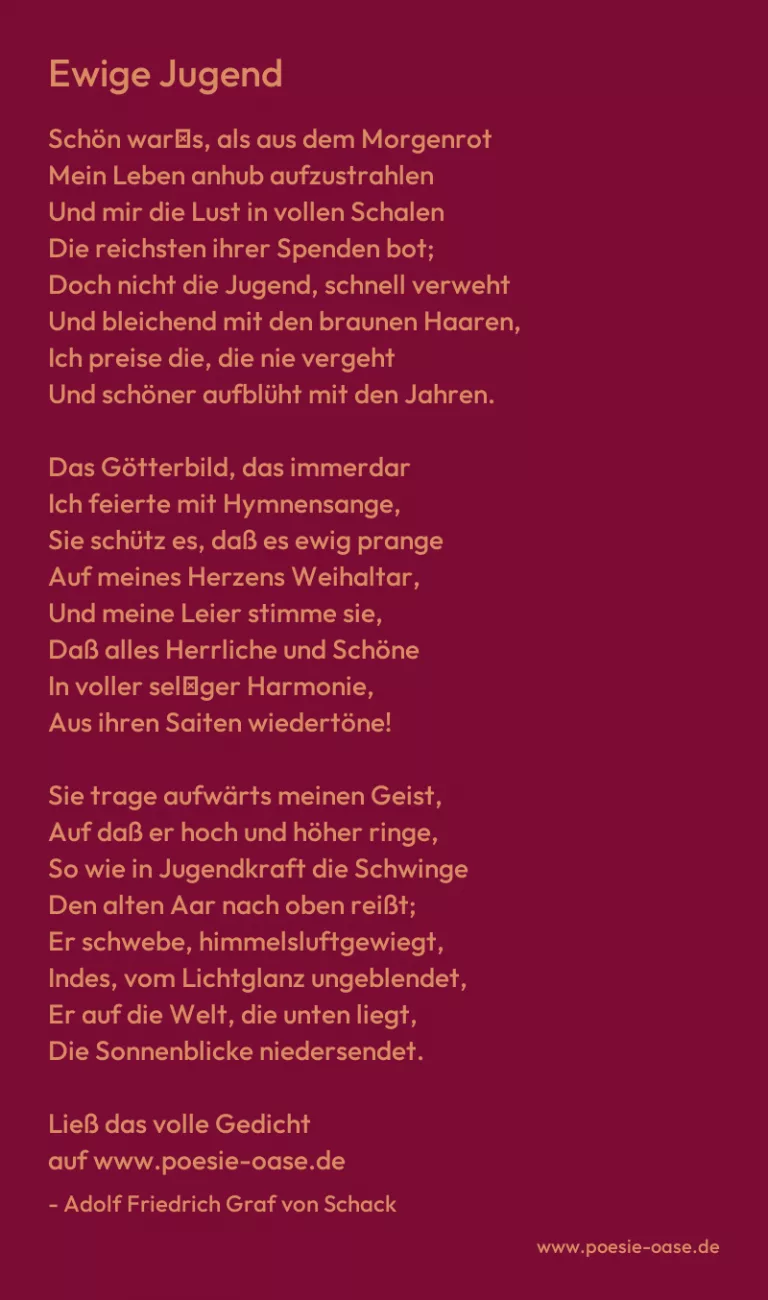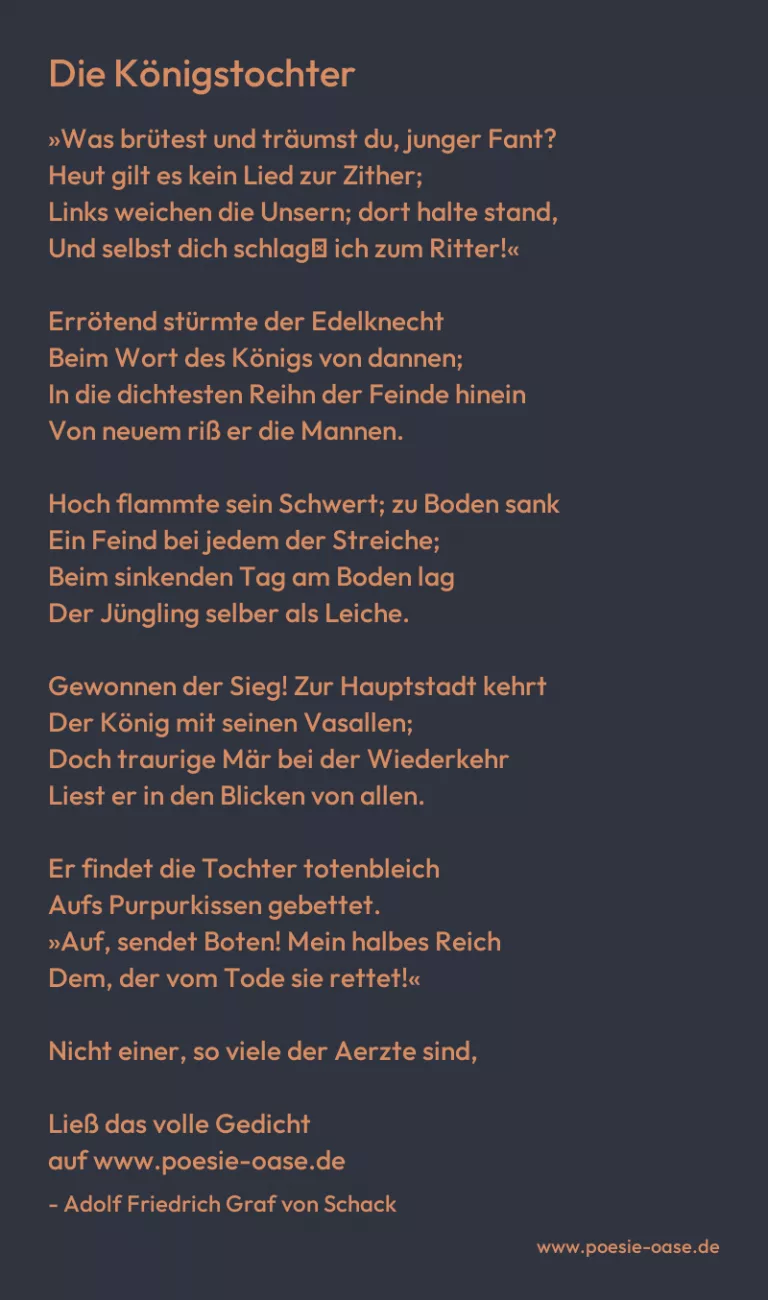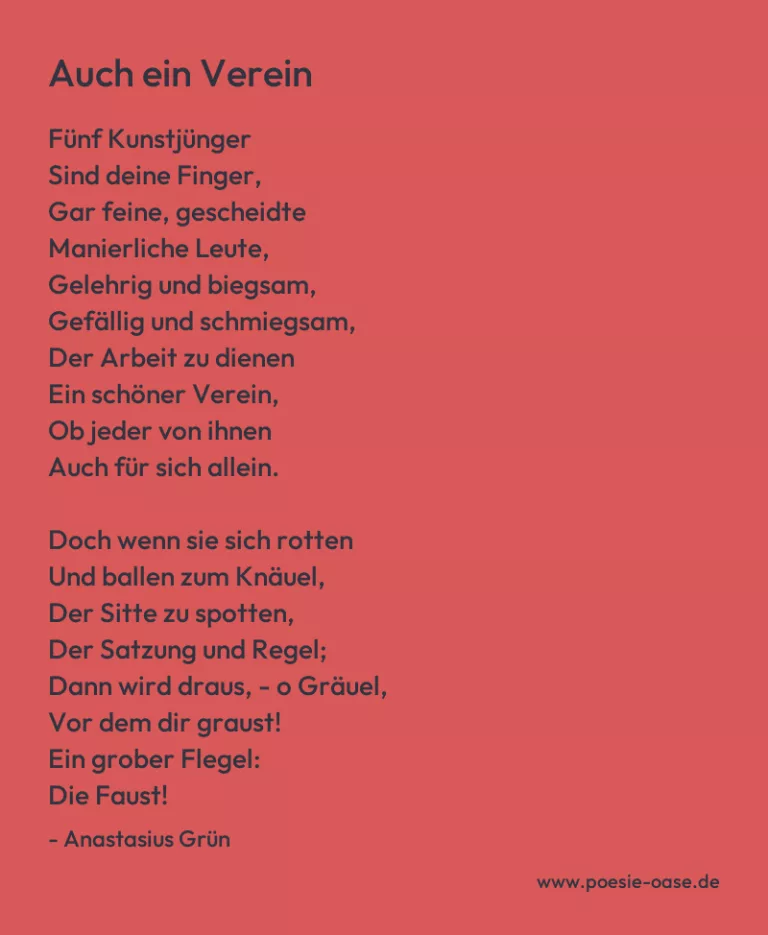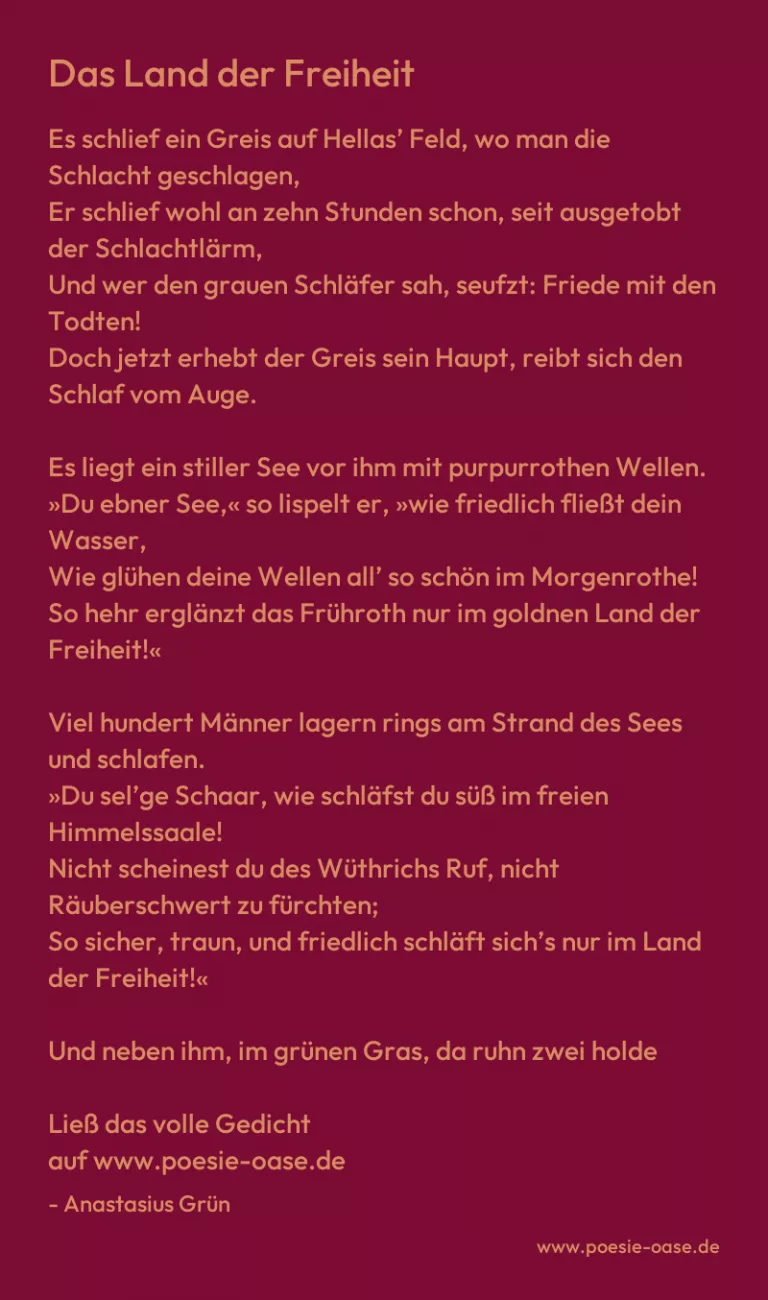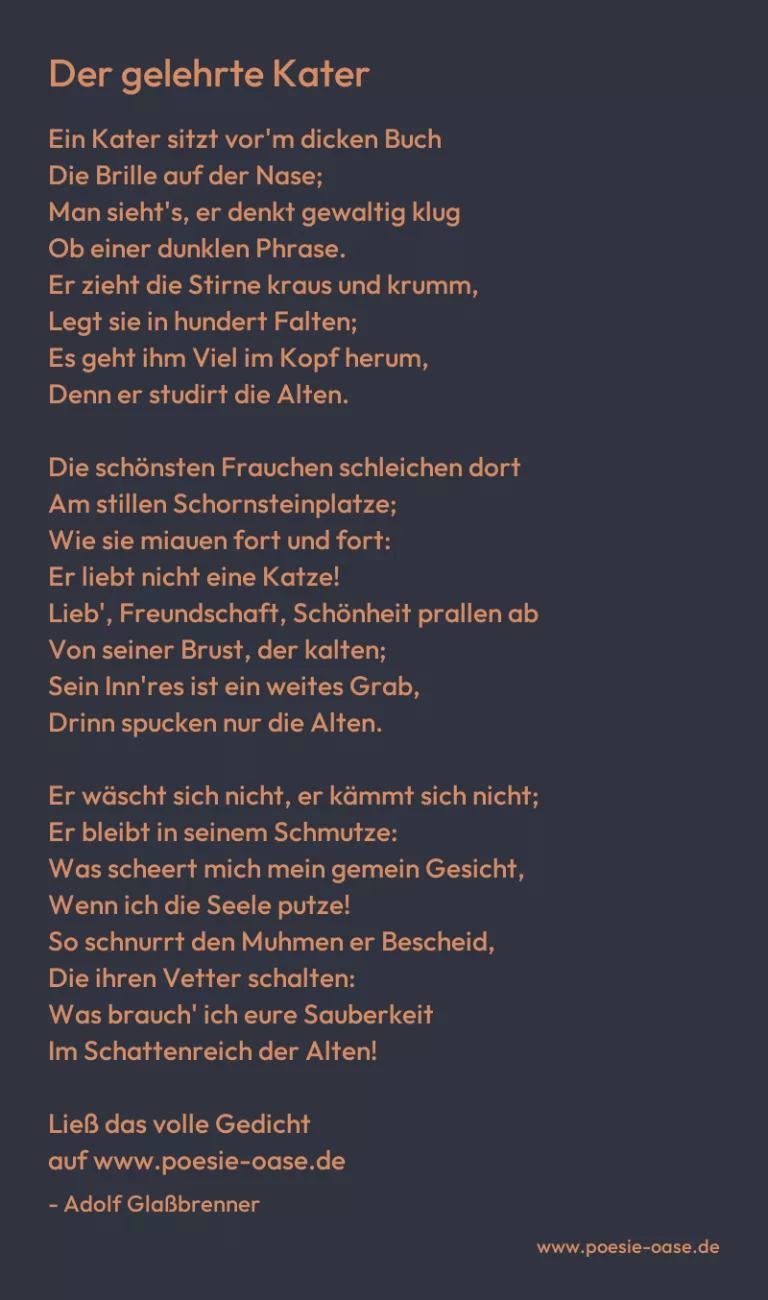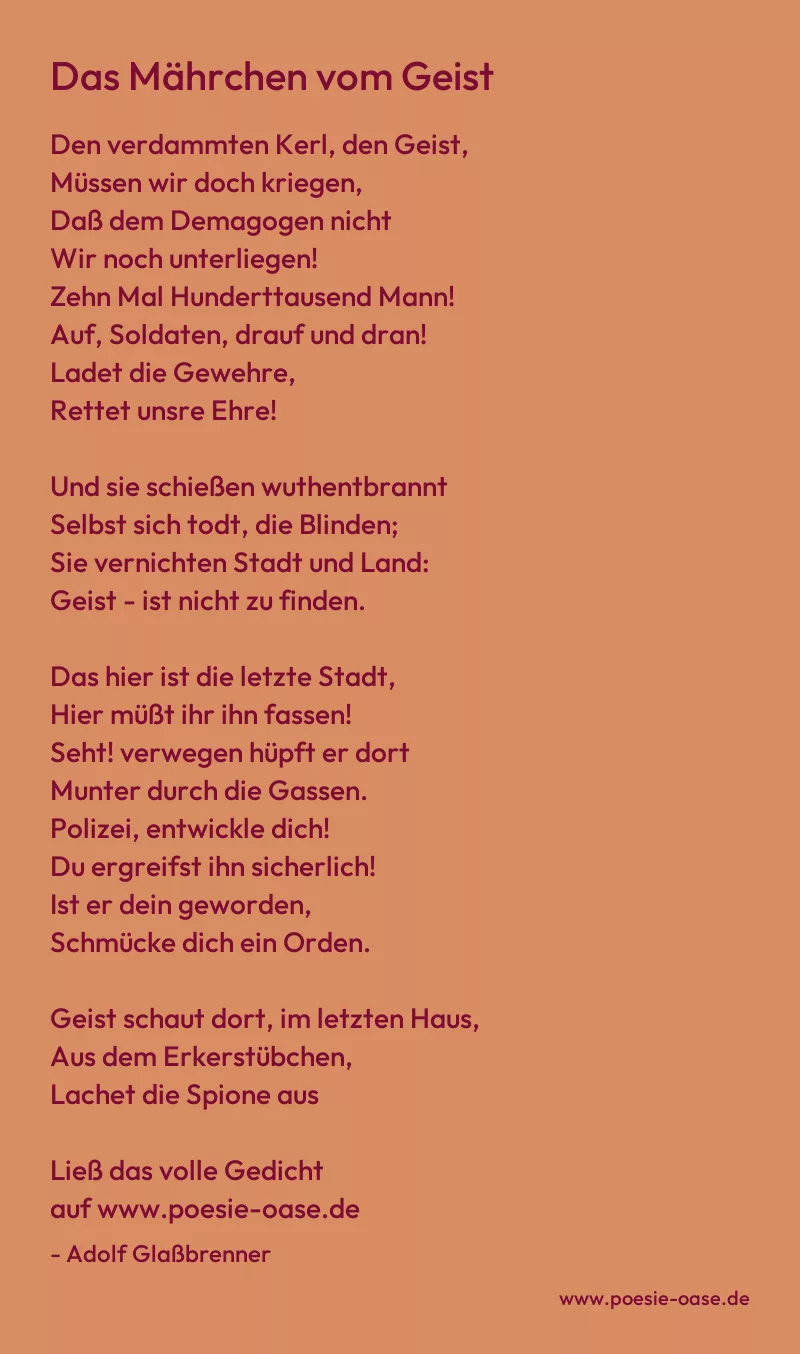Den verdammten Kerl, den Geist,
Müssen wir doch kriegen,
Daß dem Demagogen nicht
Wir noch unterliegen!
Zehn Mal Hunderttausend Mann!
Auf, Soldaten, drauf und dran!
Ladet die Gewehre,
Rettet unsre Ehre!
Und sie schießen wuthentbrannt
Selbst sich todt, die Blinden;
Sie vernichten Stadt und Land:
Geist – ist nicht zu finden.
Das hier ist die letzte Stadt,
Hier müßt ihr ihn fassen!
Seht! verwegen hüpft er dort
Munter durch die Gassen.
Polizei, entwickle dich!
Du ergreifst ihn sicherlich!
Ist er dein geworden,
Schmücke dich ein Orden.
Geist schaut dort, im letzten Haus,
Aus dem Erkerstübchen,
Lachet die Spione aus
Und schabt ihnen Rübchen.
Jetzt entwischt er uns nicht mehr,
Jetzt ist er gefangen!
Morgen soll der Bösewicht
Schon am Galgen hangen.
Schnell die Stufen hier hinauf!
Hurtig, sprengt die Thüre auf!
Greift den Kerl, da sitzt er!
Aus den Augen blitzt er!
Geist schlüpft in ein kleines Buch,
Deckt sich zu mit Lettern;
Sicher ist er da genug,
Wie sie spähn und blättern.
Schließt das Buch und bindet’s zu!
Ohne zu bekennen
Soll er auf dem Markt sogleich
Mit dem Buch verbrennen!
Richtet mir den Holzstoß her!
Auf, Soldaten, in’s Gewehr!
Lodert, lodert, Flammen!
Gott soll ihn verdammen!
Wundersame Melodien
Hört die stumme Menge,
Und in alle Herzen ziehn
Jene Zauberklänge.
Plötzlich donnert’s durch den Dampf
Wie ein fern Gewitter;
Lichtumflossen steigt empor
Draus ein goldner Ritter.
Auf, ihr Völker! ruft er laut,
Auf zum Freiheitskriege!
Wer dem ew’gen Geist vertraut,
Den führt er zum Siege!
Moral:
Wie sie martern ihn und wie
Trachten nach dem Leben:
Gott der Herr wird nun und nie
Seinen Geist aufgeben.