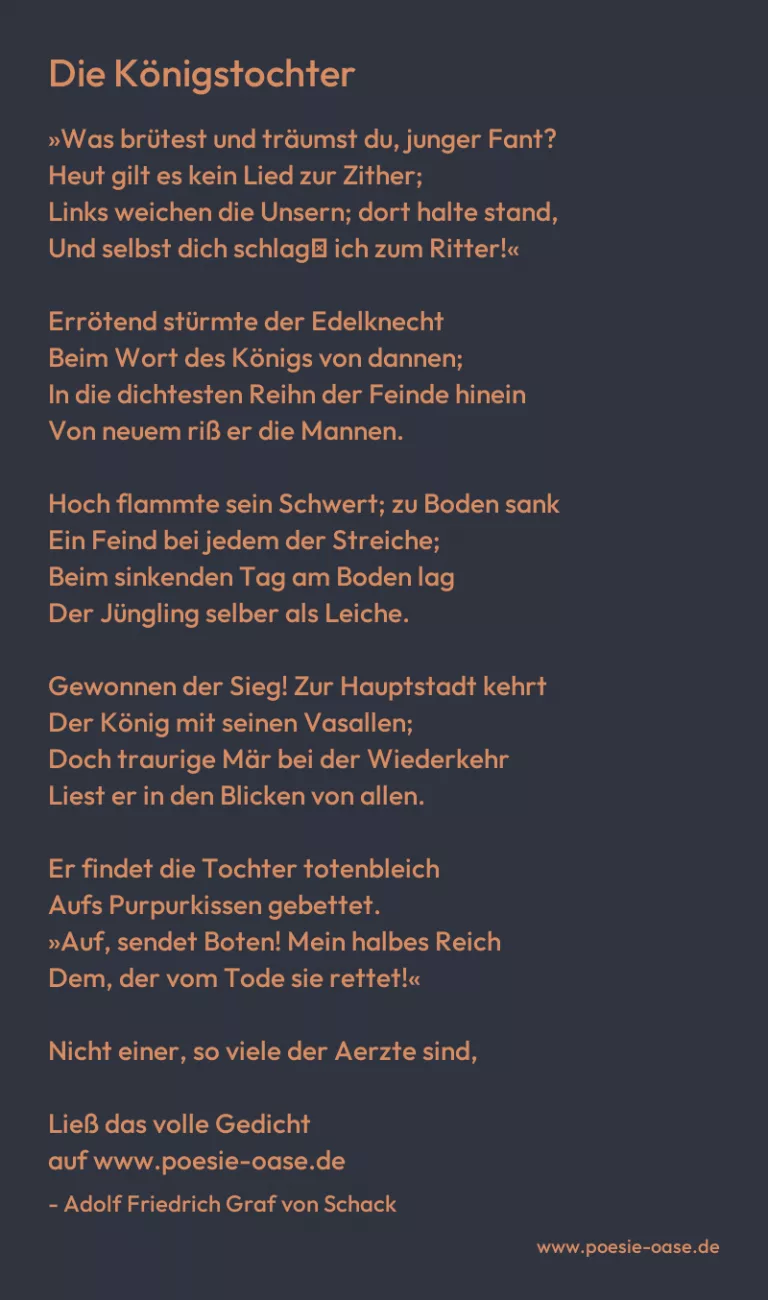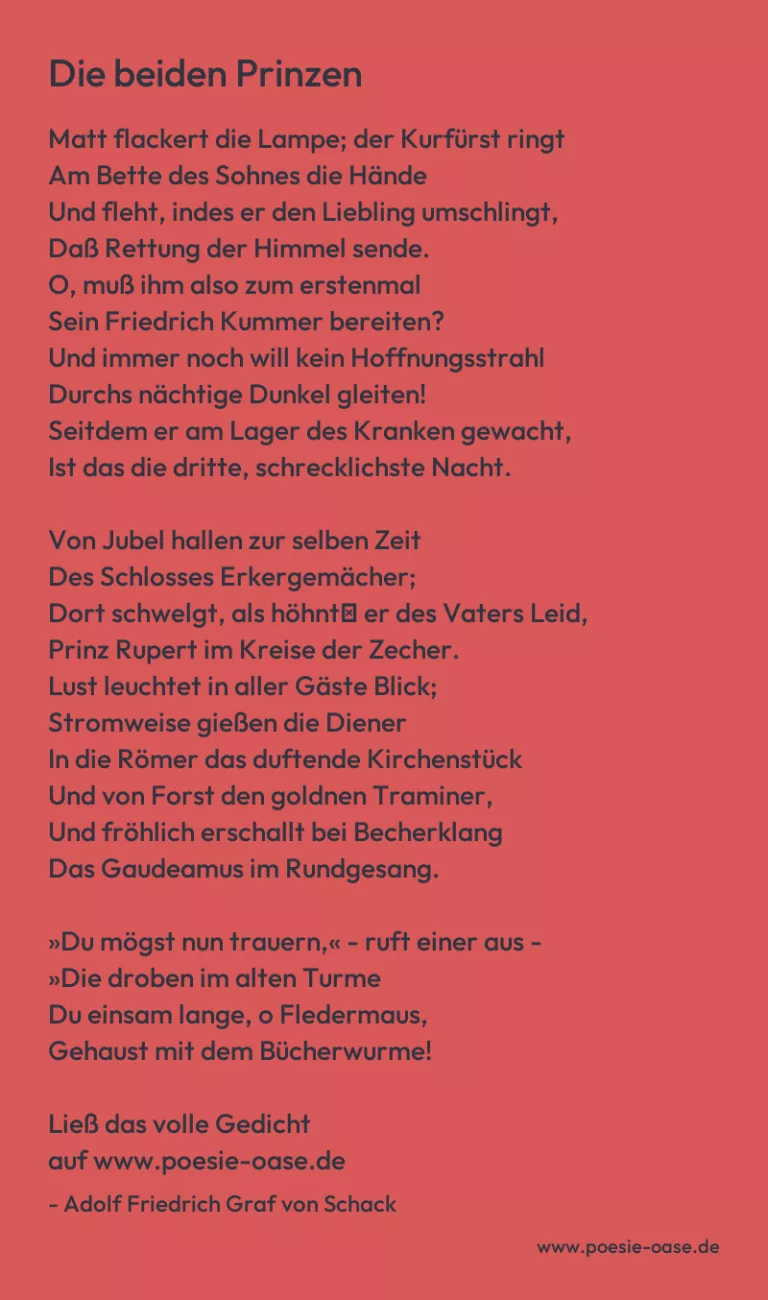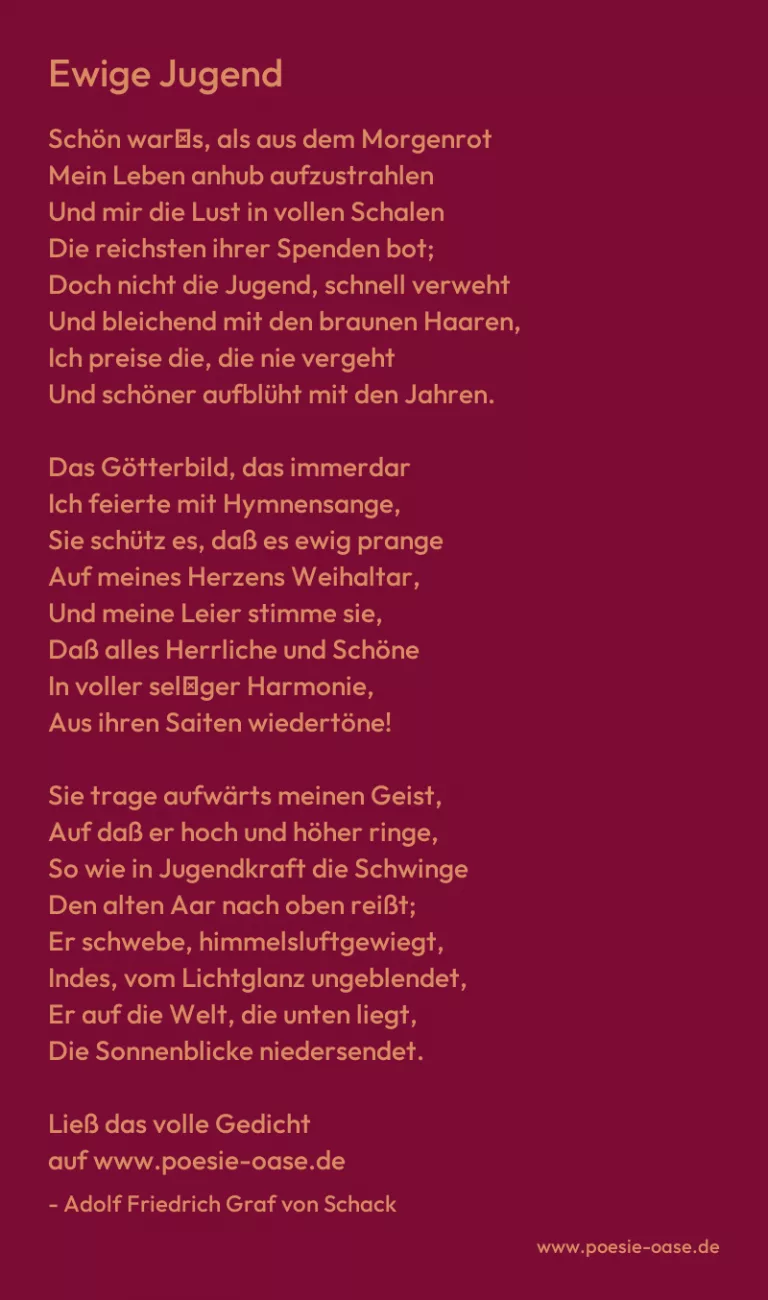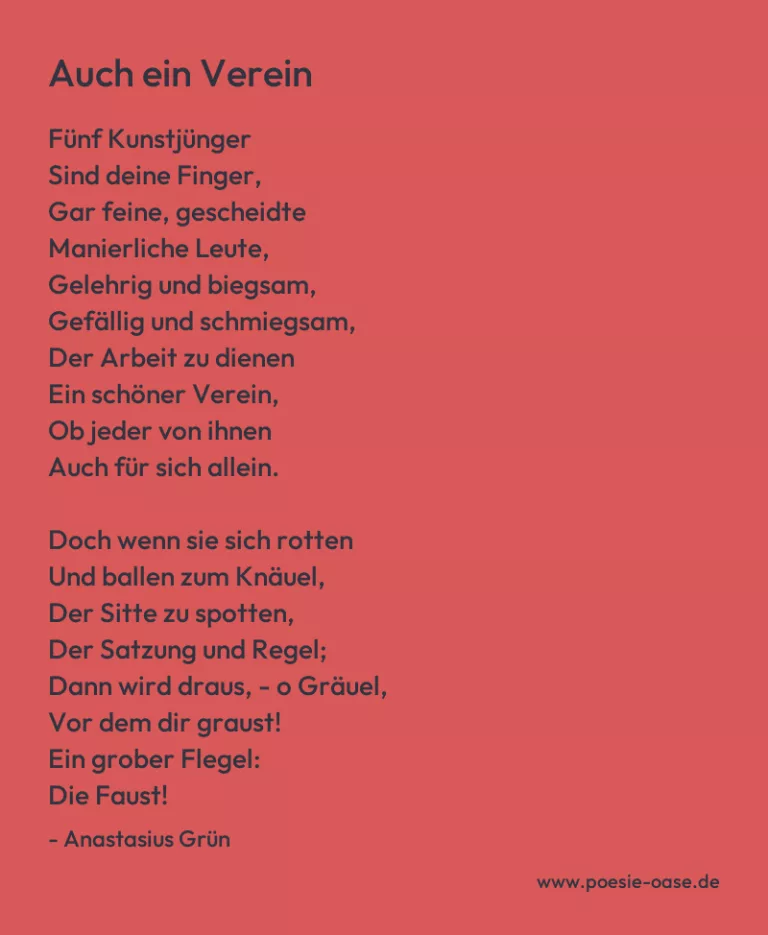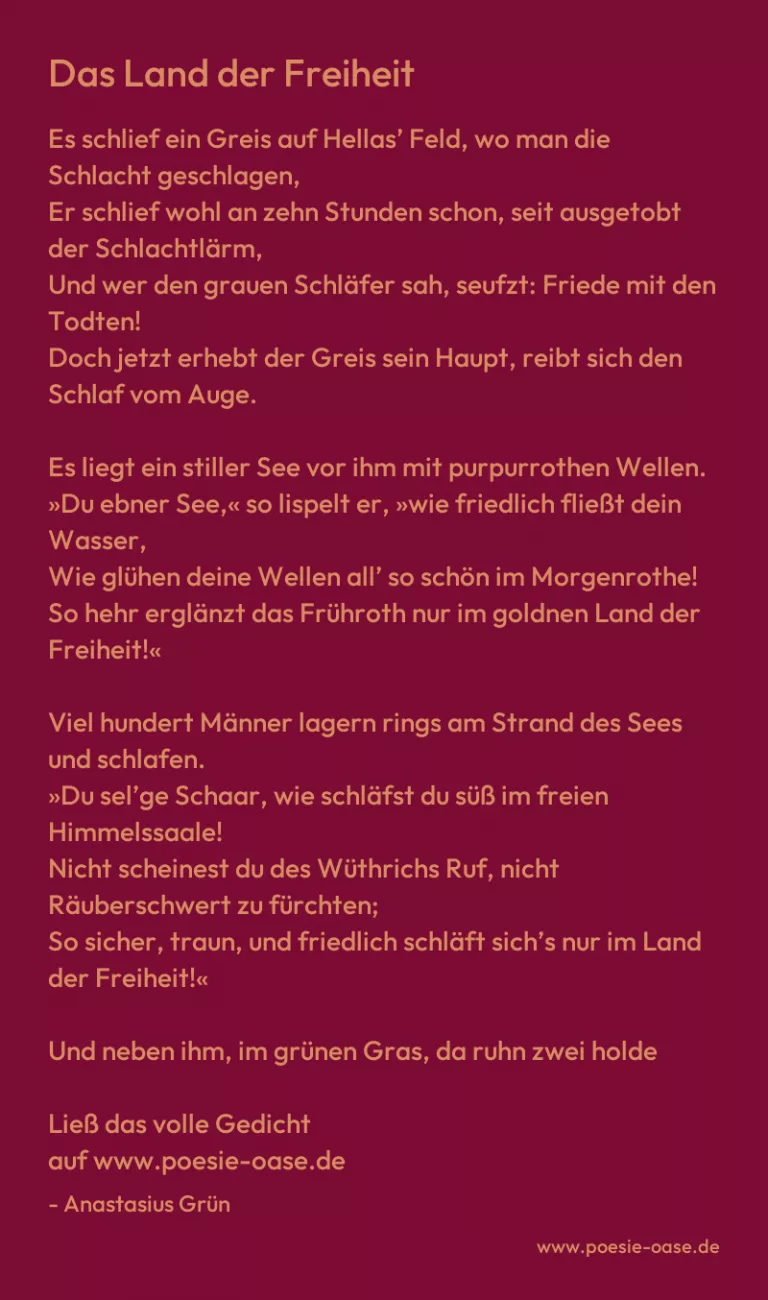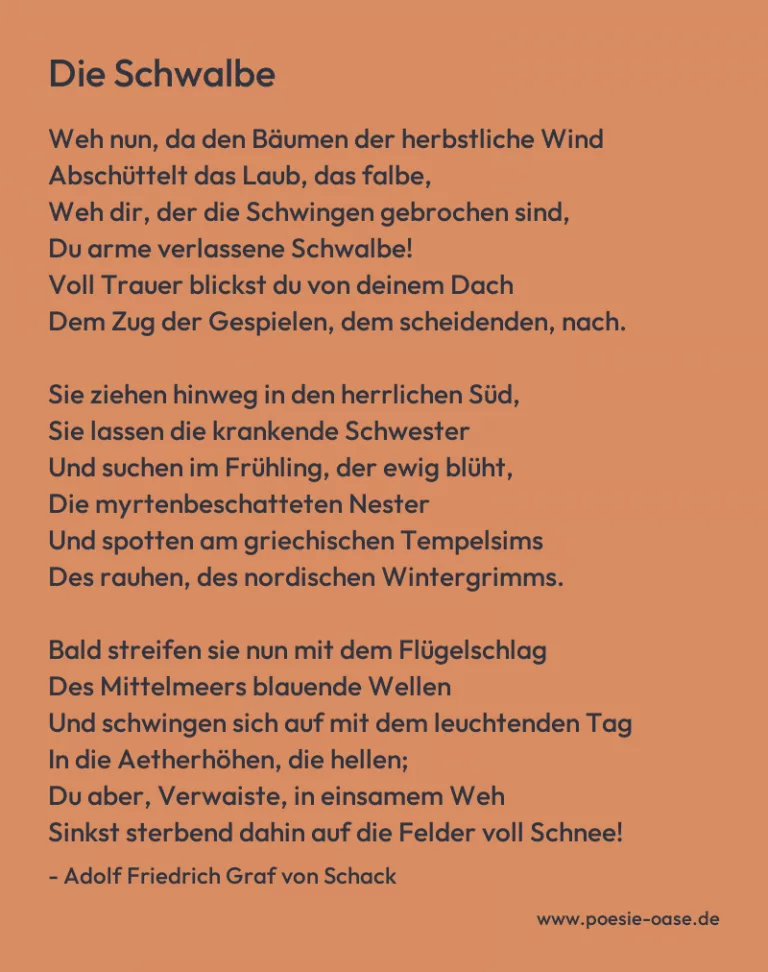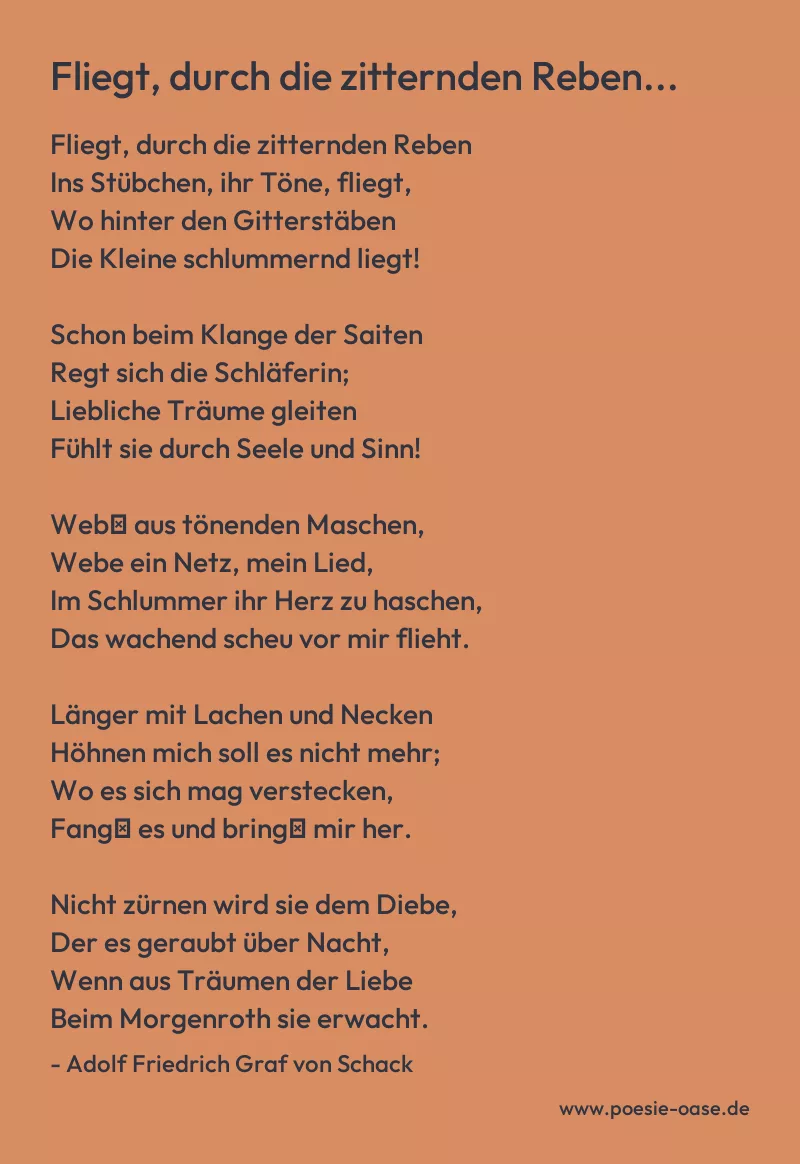Fliegt, durch die zitternden Reben…
Fliegt, durch die zitternden Reben
Ins Stübchen, ihr Töne, fliegt,
Wo hinter den Gitterstäben
Die Kleine schlummernd liegt!
Schon beim Klange der Saiten
Regt sich die Schläferin;
Liebliche Träume gleiten
Fühlt sie durch Seele und Sinn!
Web′ aus tönenden Maschen,
Webe ein Netz, mein Lied,
Im Schlummer ihr Herz zu haschen,
Das wachend scheu vor mir flieht.
Länger mit Lachen und Necken
Höhnen mich soll es nicht mehr;
Wo es sich mag verstecken,
Fang′ es und bring′ mir her.
Nicht zürnen wird sie dem Diebe,
Der es geraubt über Nacht,
Wenn aus Träumen der Liebe
Beim Morgenroth sie erwacht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
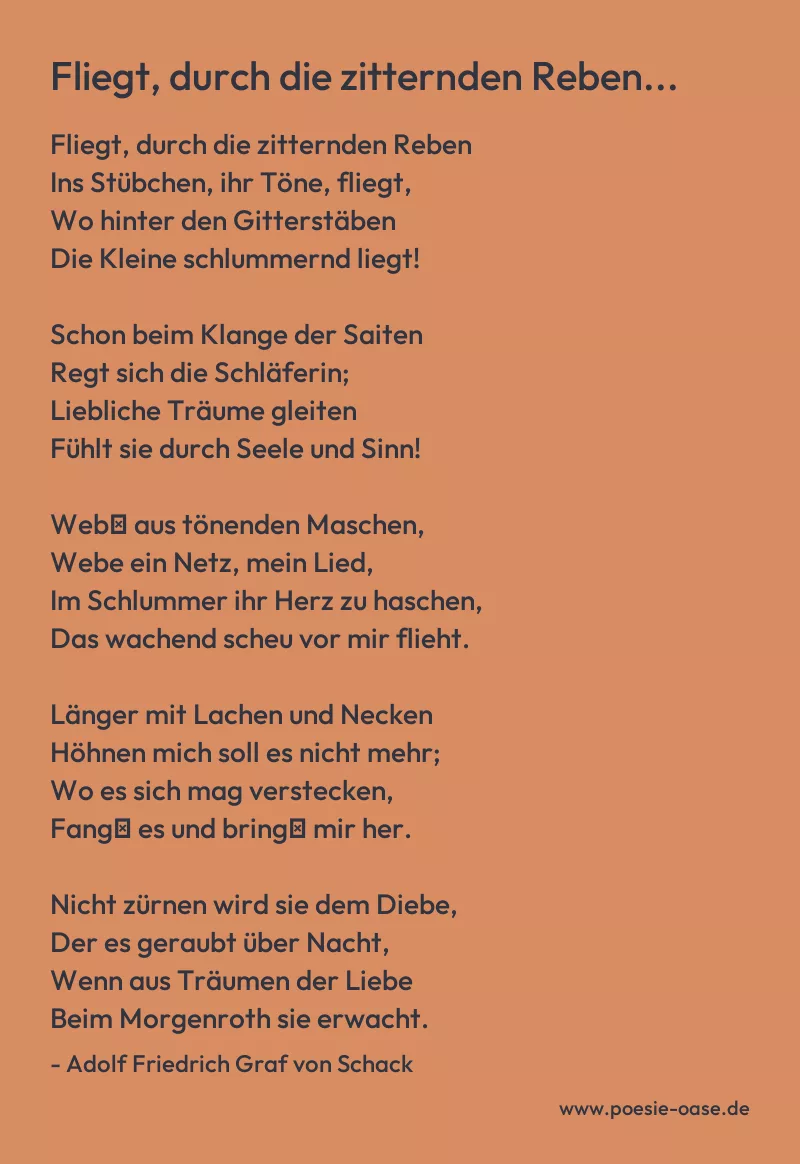
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Fliegt, durch die zitternden Reben…“ von Adolf Friedrich Graf von Schack beschreibt auf lyrische Weise das Werben um die Gunst einer schlafenden Geliebten. Der Sprecher richtet sich an seine „Töne“ – die Musik, die er spielt – und befiehlt ihnen, in das Zimmer der „Kleinen“ zu fliegen, wo sie schläft. Der erste Vers etabliert eine idyllische Szene, in der die Musik wie Vögel durch die Weinreben zum Geliebten eilt, was eine sanfte, romantische Atmosphäre erzeugt. Die Verwendung von Worten wie „zitternden“ deutet bereits auf die subtile Nervosität und Sehnsucht des Sprechers hin.
In der zweiten Strophe wird die Wirkung der Musik auf die Schlafende beschrieben. Beim Klang der Saiten regt sich die Geliebte, und „liebliche Träume“ durchweben ihre Seele und ihren Sinn. Hier wird die Musik als Brücke zu ihren Träumen dargestellt, als Medium, um in ihr Unterbewusstsein einzudringen und ihr Herz zu erobern. Die Träume werden als etwas Schönes und Sanftes beschrieben, was die Intention des Sprechers unterstreicht, einen positiven Einfluss auf sie auszuüben.
Die dritte Strophe nimmt eine etwas aggressivere Wendung. Das Lied wird nun als „Netz“ bezeichnet, das das Herz der Schlafenden „haschen“ soll. Der Sprecher drückt den Wunsch aus, das Herz zu fangen, das im Wachzustand vor ihm flieht. Dies offenbart eine gewisse Verzweiflung und das Bestreben, die Zurückhaltung der Geliebten im Wachzustand zu überwinden, indem er sie in ihren Träumen „überlistet“.
Die letzte Strophe ist von Versöhnlichkeit geprägt. Der Sprecher erwartet keine Wut von der Geliebten, wenn sie am Morgen erwacht und feststellt, dass ihr Herz gestohlen wurde. Er geht davon aus, dass sie die Liebe, die sie in ihren Träumen empfand, akzeptieren und erwidern wird. Die Verwendung des Wortes „Dieb“ ist hier interessant, da es einerseits die heimliche Vorgehensweise des Sprechers betont, aber andererseits auch die romantische Vorstellung des nächtlichen Eroberns unterstreicht. Das Gedicht endet mit einem optimistischen Ausblick, in dem die Liebe der beiden in den Träumen zur Realität werden soll.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.