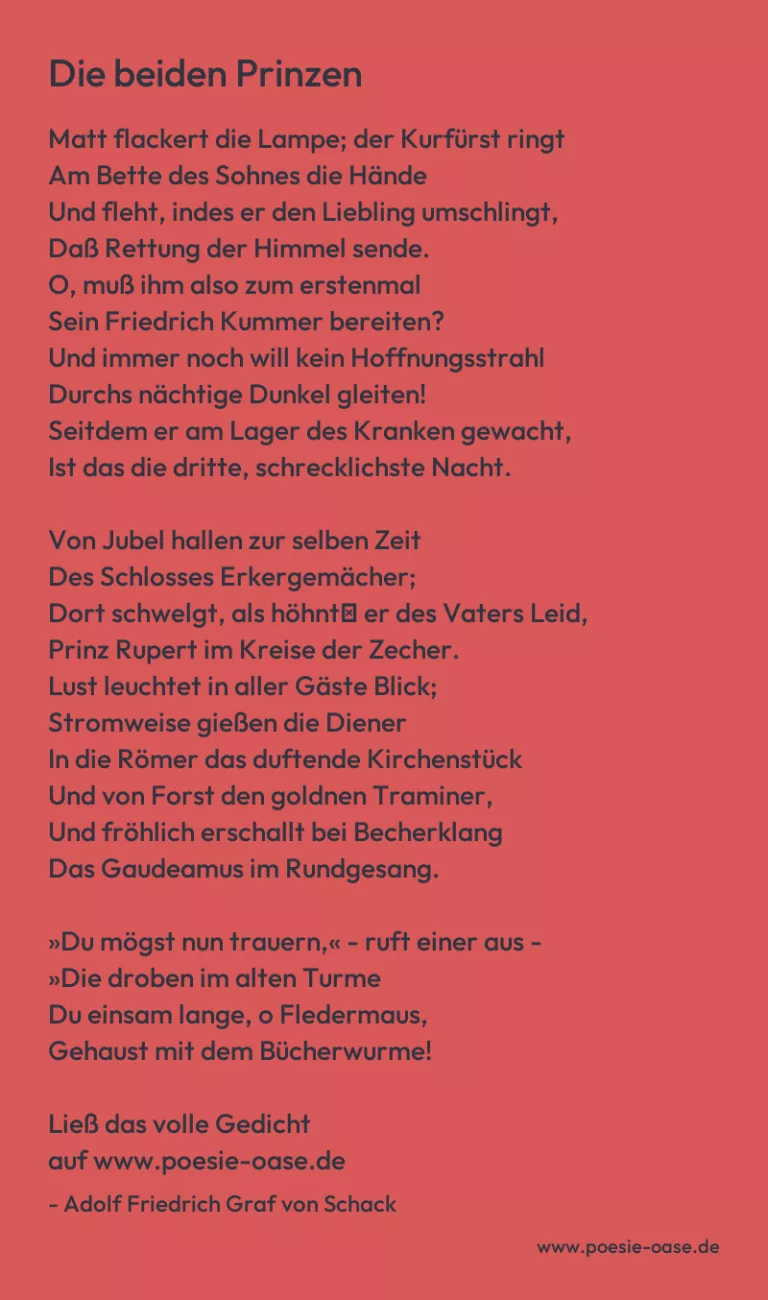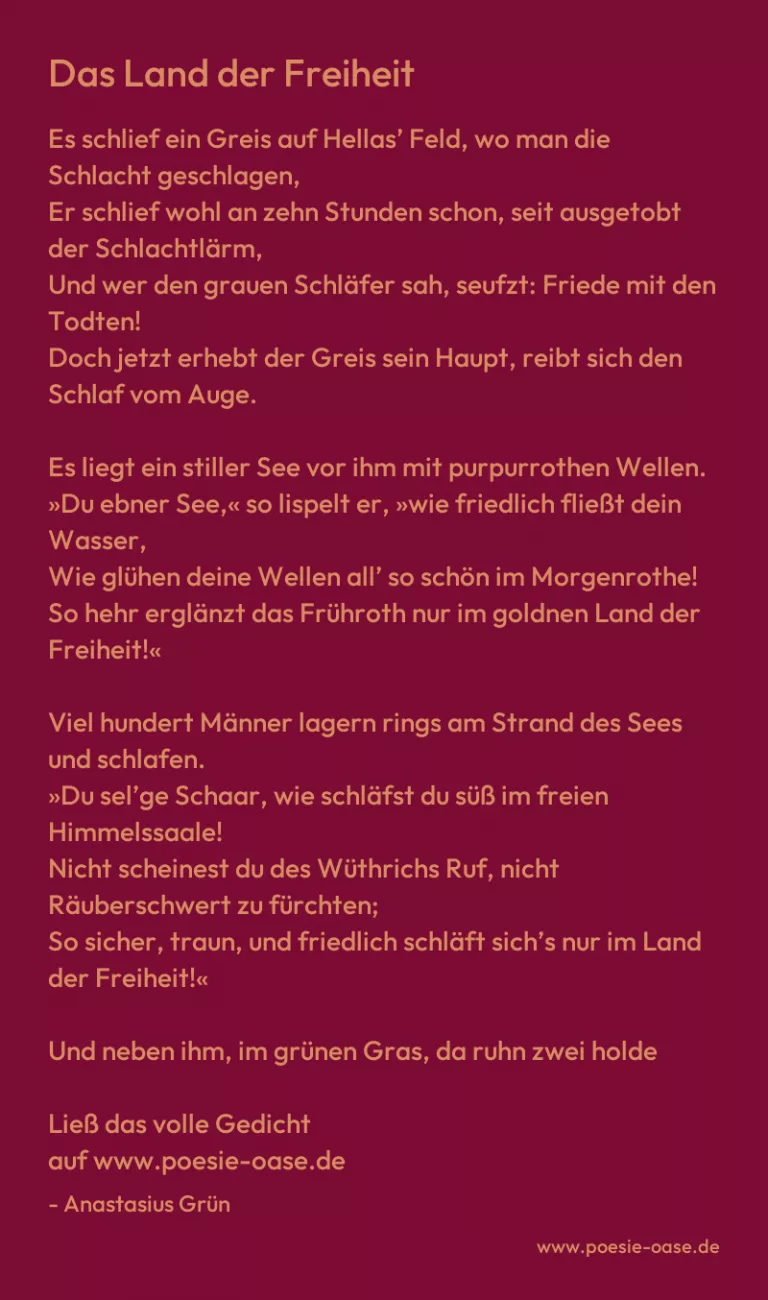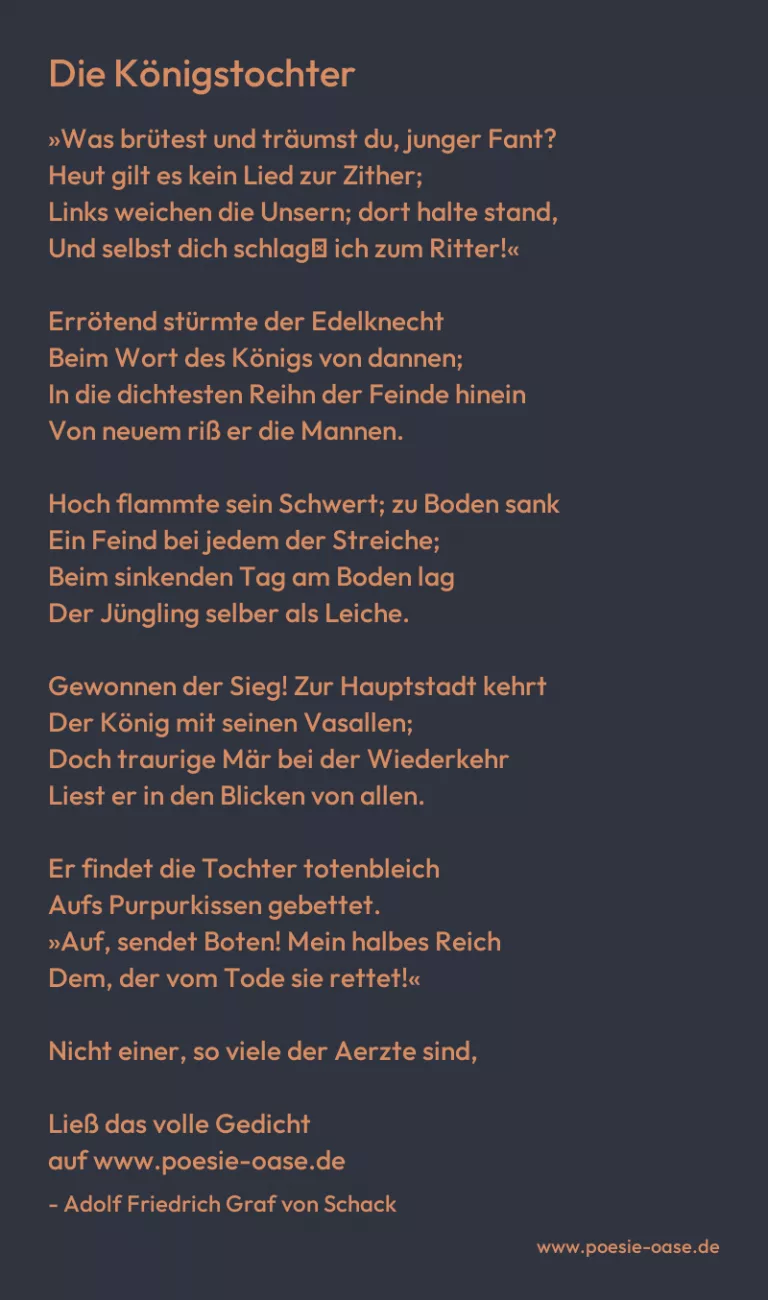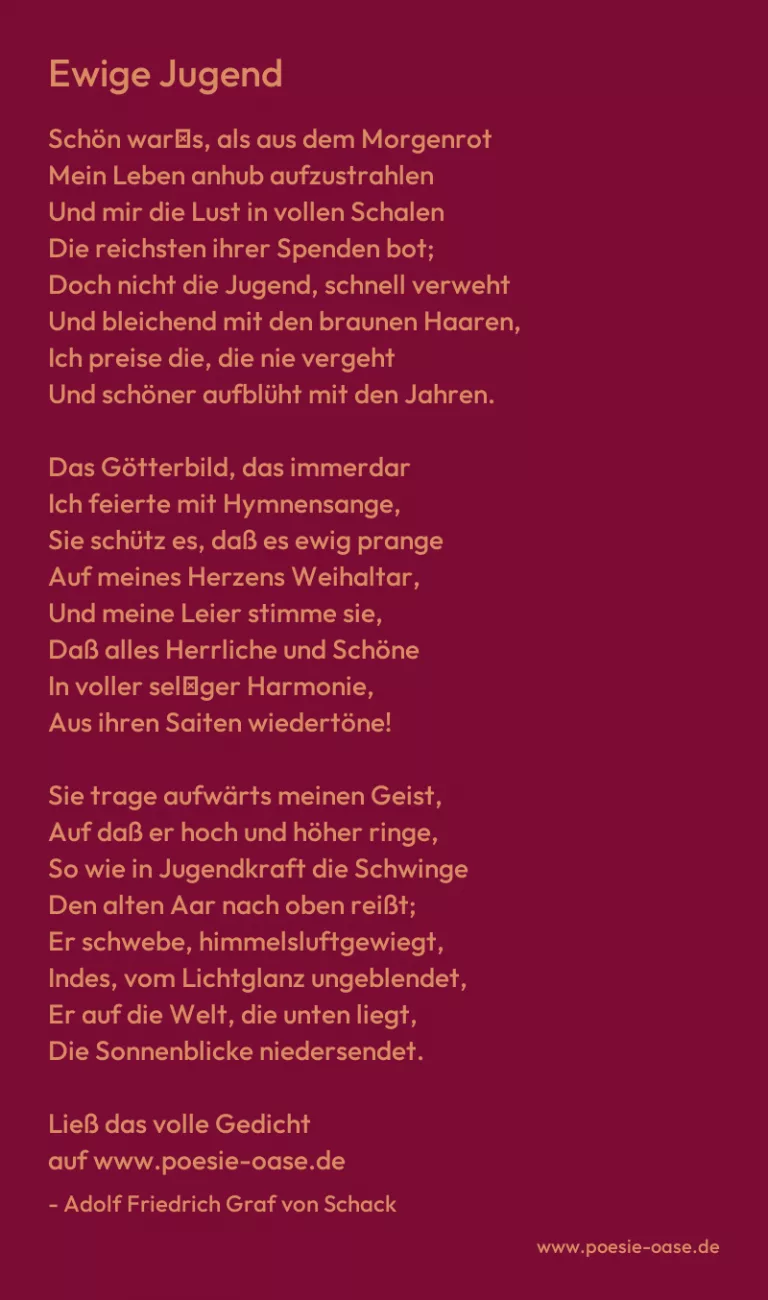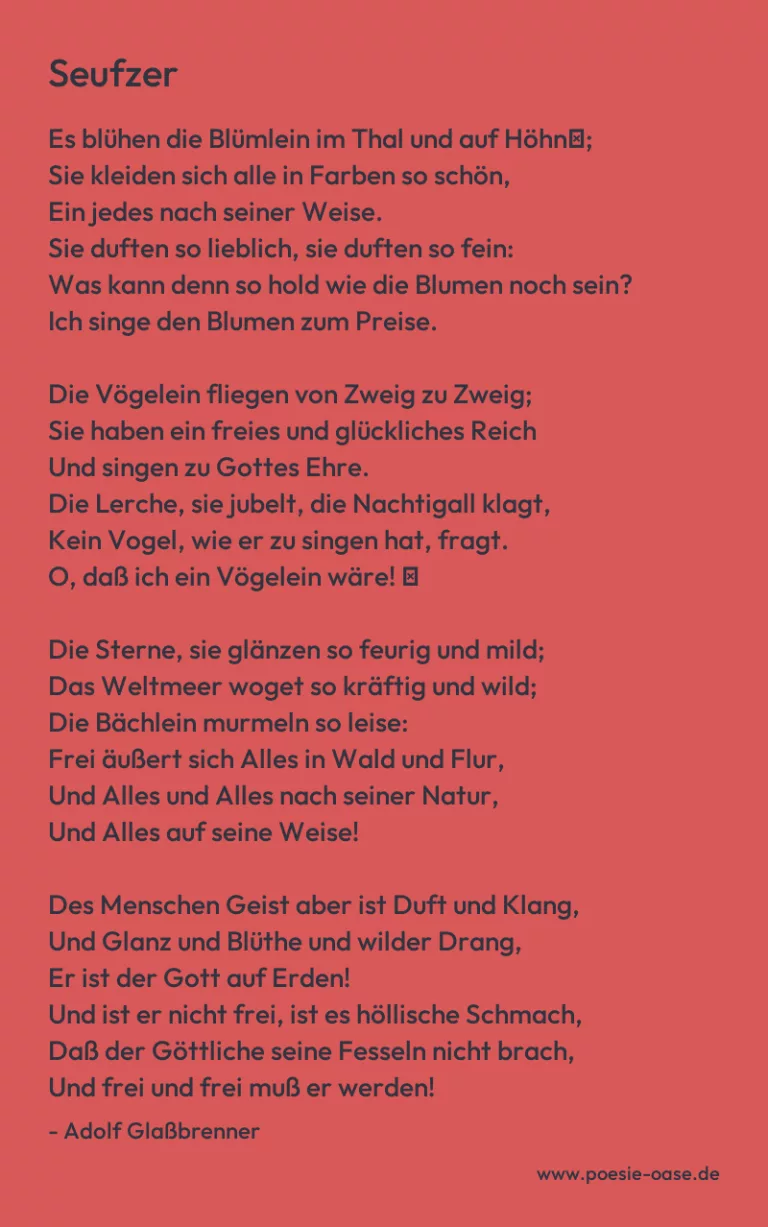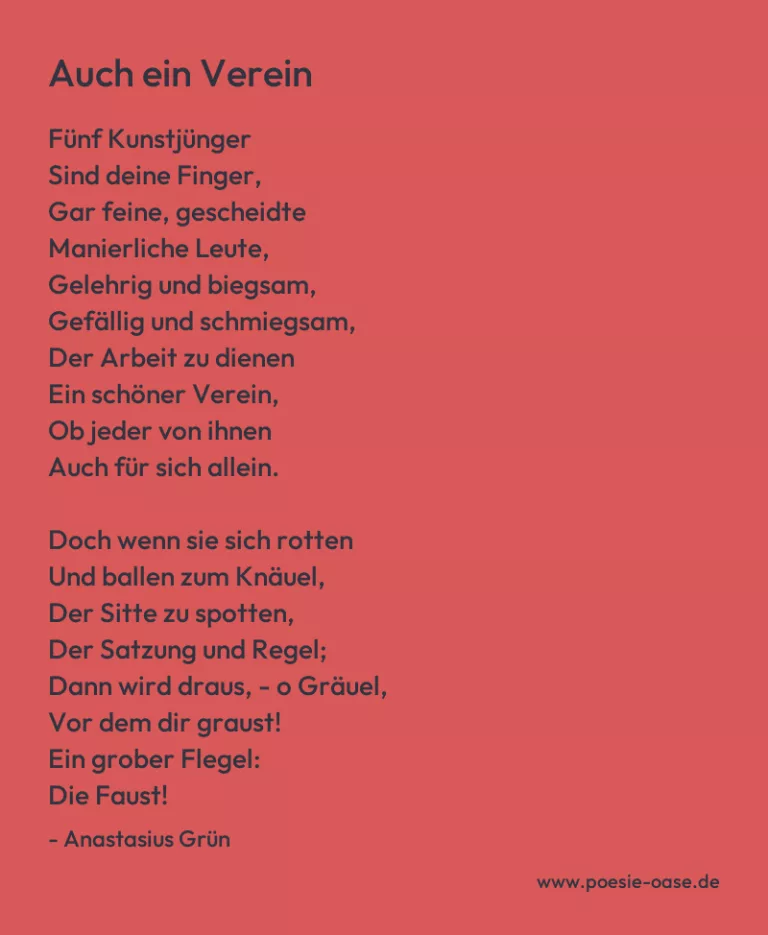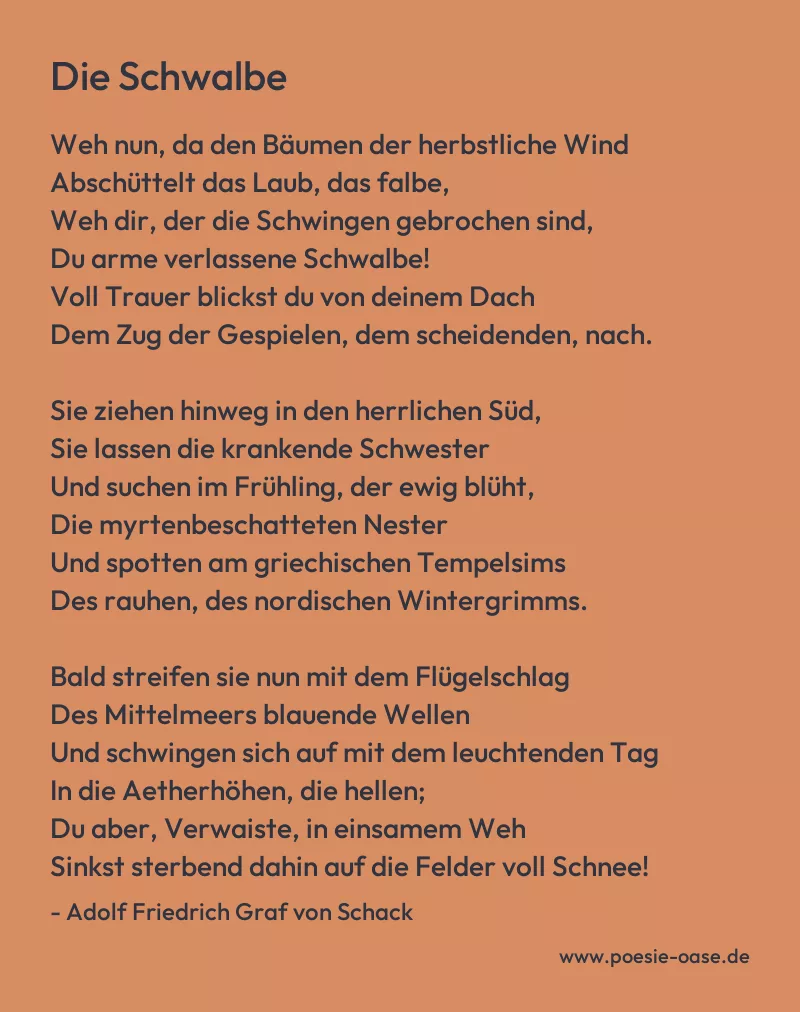Die Schwalbe
Weh nun, da den Bäumen der herbstliche Wind
Abschüttelt das Laub, das falbe,
Weh dir, der die Schwingen gebrochen sind,
Du arme verlassene Schwalbe!
Voll Trauer blickst du von deinem Dach
Dem Zug der Gespielen, dem scheidenden, nach.
Sie ziehen hinweg in den herrlichen Süd,
Sie lassen die krankende Schwester
Und suchen im Frühling, der ewig blüht,
Die myrtenbeschatteten Nester
Und spotten am griechischen Tempelsims
Des rauhen, des nordischen Wintergrimms.
Bald streifen sie nun mit dem Flügelschlag
Des Mittelmeers blauende Wellen
Und schwingen sich auf mit dem leuchtenden Tag
In die Aetherhöhen, die hellen;
Du aber, Verwaiste, in einsamem Weh
Sinkst sterbend dahin auf die Felder voll Schnee!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
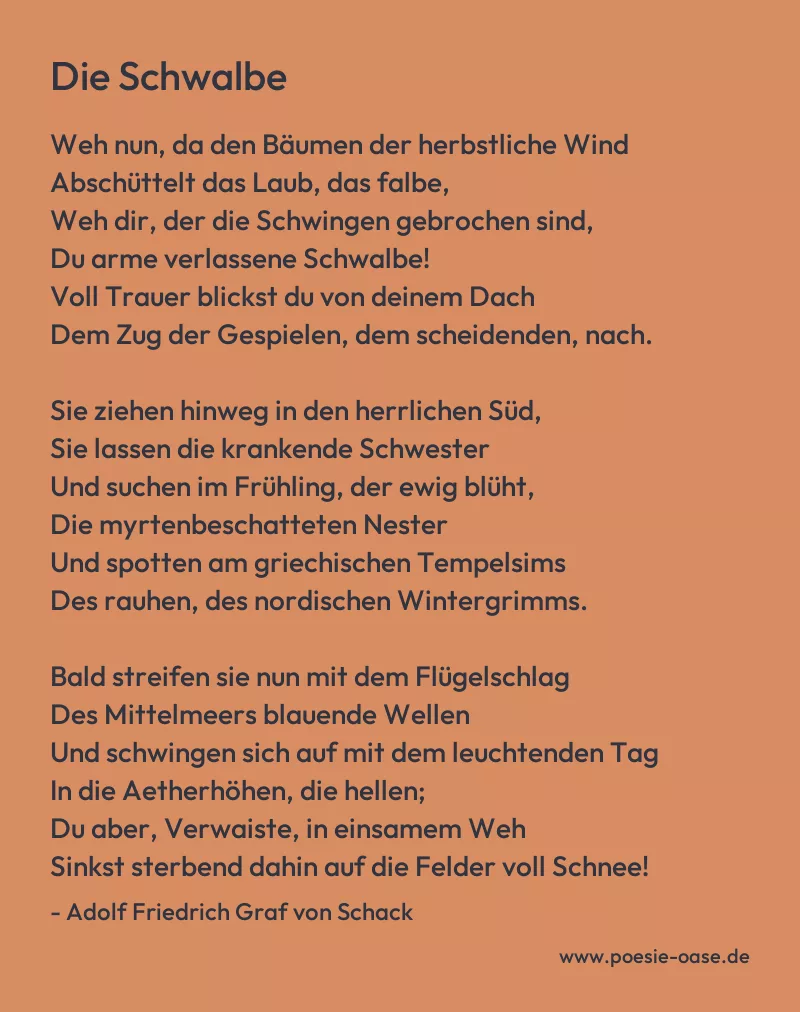
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Schwalbe“ von Adolf Friedrich Graf von Schack ist eine elegische Klage über das Schicksal eines verletzten Vogels, der vom herbstlichen Wind vom Baumlaub getrennt wird. Es ist eine Metapher für die Vergänglichkeit und die Unfähigkeit, dem Lauf der Natur zu entkommen. Die Schwalbe, Symbol für Sommer und Lebensfreude, ist unfähig, mit ihrem Schwarm in den Süden zu ziehen, und muss stattdessen den herannahenden Winter und den Tod ertragen.
Der Dichter verwendet eine einfache, aber eindringliche Sprache, um die Emotionen des Verlusts und der Einsamkeit zu vermitteln. Der erste Vers „Weh nun, da den Bäumen der herbstliche Wind / Abschüttelt das Laub, das falbe“ setzt sofort den Ton der Trauer. Das Bild des Herbstes, der das Laub abwirft, symbolisiert den Verfall und das Ende des Sommers, und damit auch den nahenden Tod der Schwalbe. Die Verwendung von Adjektiven wie „falbe“ (blass, fahl) verstärkt das Gefühl von Verfall und Verlassenheit. Die Schwalbe wird als „arme verlassene Schwalbe“ bezeichnet, was das Mitleid des Dichters mit ihrem Schicksal unterstreicht.
Das Gedicht kontrastiert das Schicksal der einsamen Schwalbe mit dem Glück ihrer Artgenossen, die in den sonnigen Süden ziehen und dort in der ewigen Blüte des Frühlings verweilen. Die Beschreibung des Südens mit „herrlichen“ Orten, „myrtenbeschatteten Nestern“ und dem „griechischen Tempelsims“ evoziert Bilder von Schönheit und Lebensfreude. Diese Bilder verstärken die Trauer der Schwalbe, die durch ihre Verletzung von diesem Paradies ausgeschlossen ist und dem rauen, kalten Winter ausgesetzt ist. Die Ironie liegt darin, dass die Schwalben im Süden das „nordische Wintergrimm“ verspotten, während die verletzte Schwalbe unter diesem leiden muss.
Im letzten Abschnitt des Gedichts wird das Schicksal der Schwalbe besiegelt. Während die anderen Schwalben über das Mittelmeer fliegen und sich in den „Aetherhöhen, die hellen“ erheben, sinkt die verlassene Schwalbe „sterbend dahin auf die Felder voll Schnee“. Der Kontrast zwischen dem hellen, sonnigen Süden und der eisigen Einsamkeit des Todesfeldes ist unübersehbar und verstärkt die tragische Wirkung des Gedichts. Das Gedicht ist eine Reflexion über die Unbarmherzigkeit des Lebens und die Akzeptanz des unvermeidlichen Todes.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.