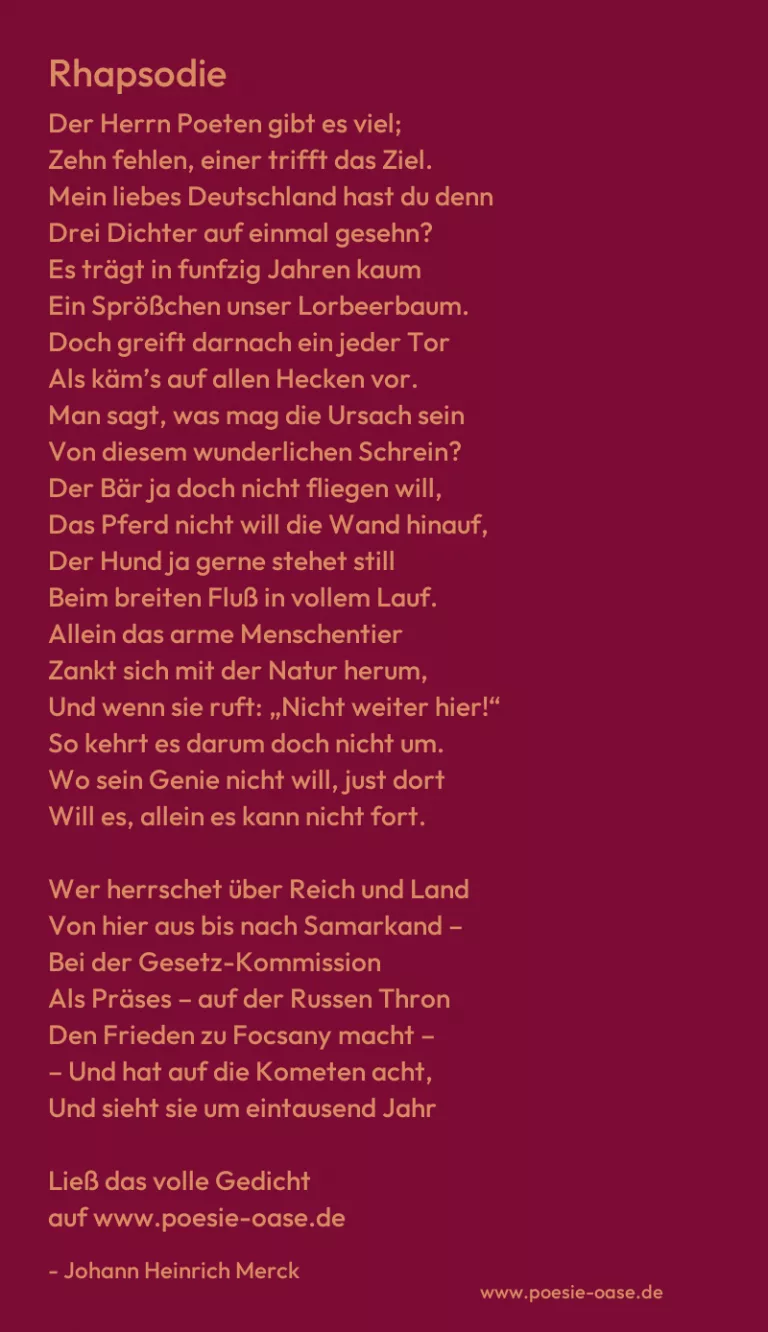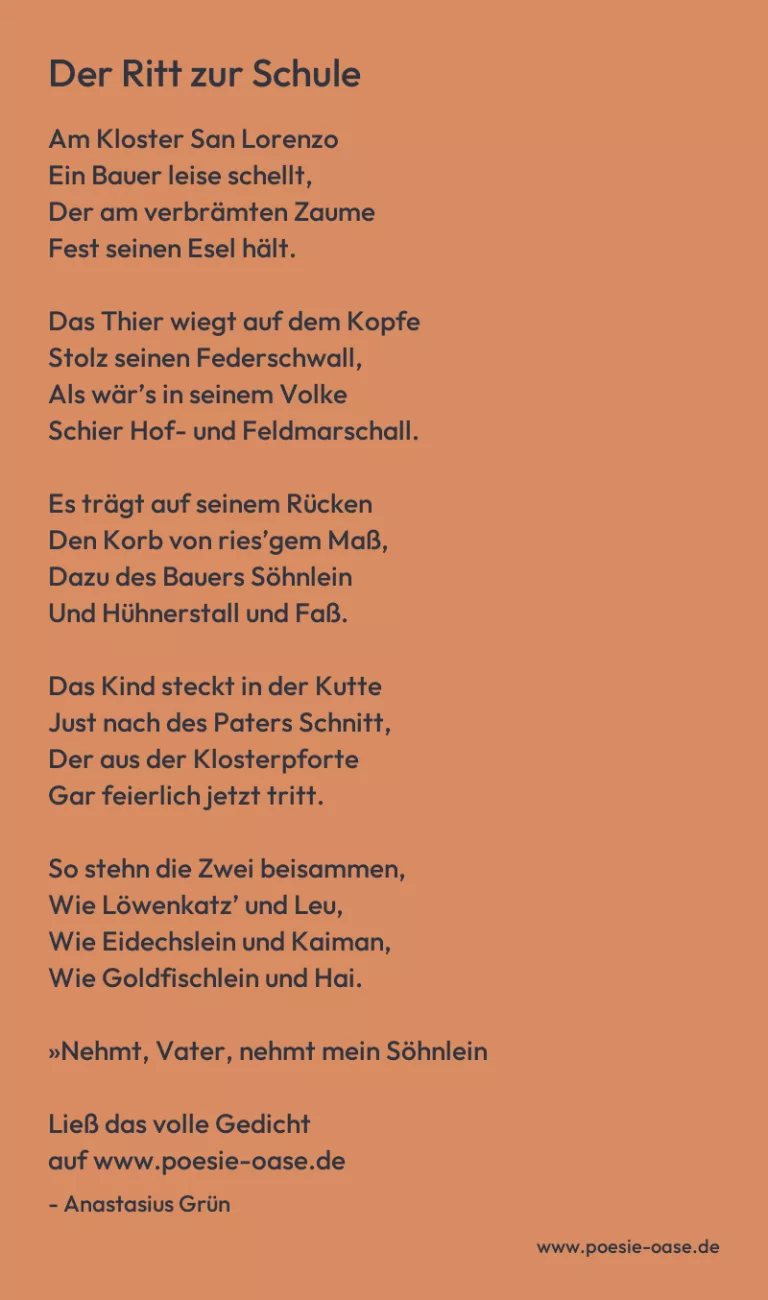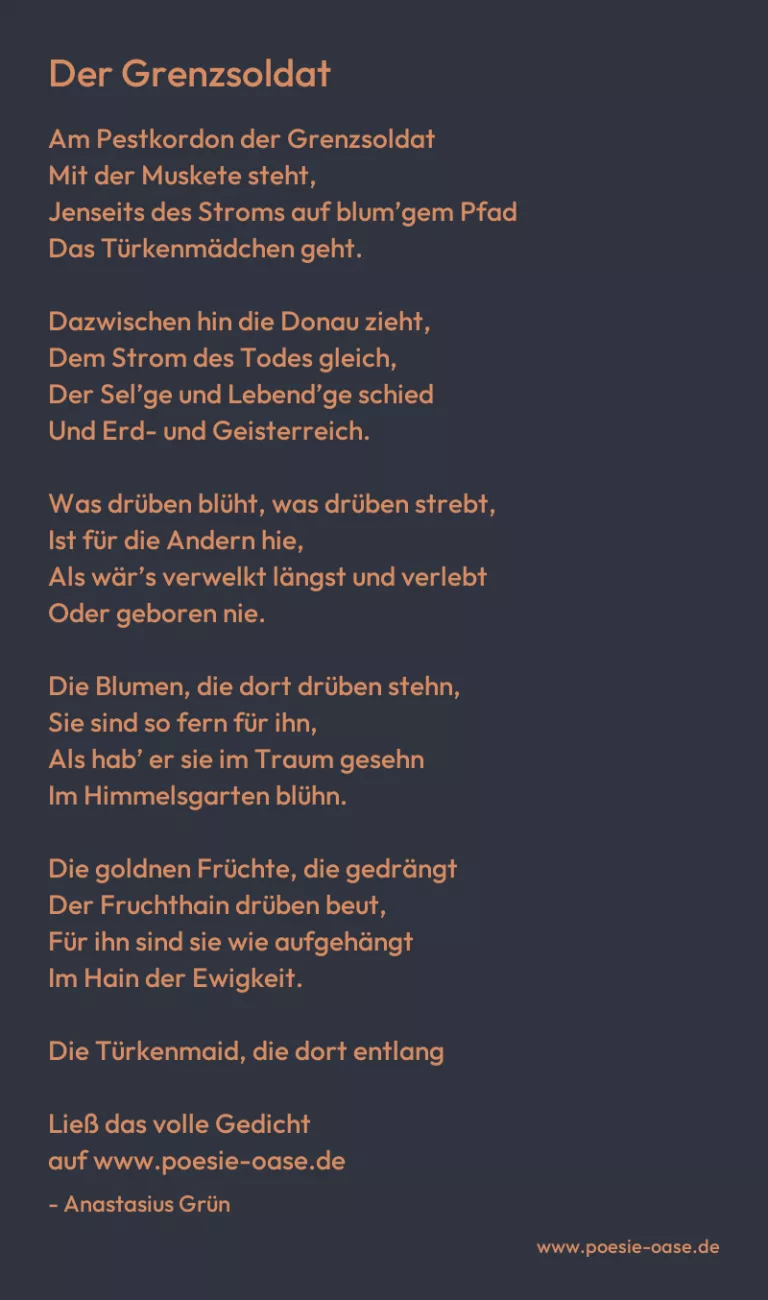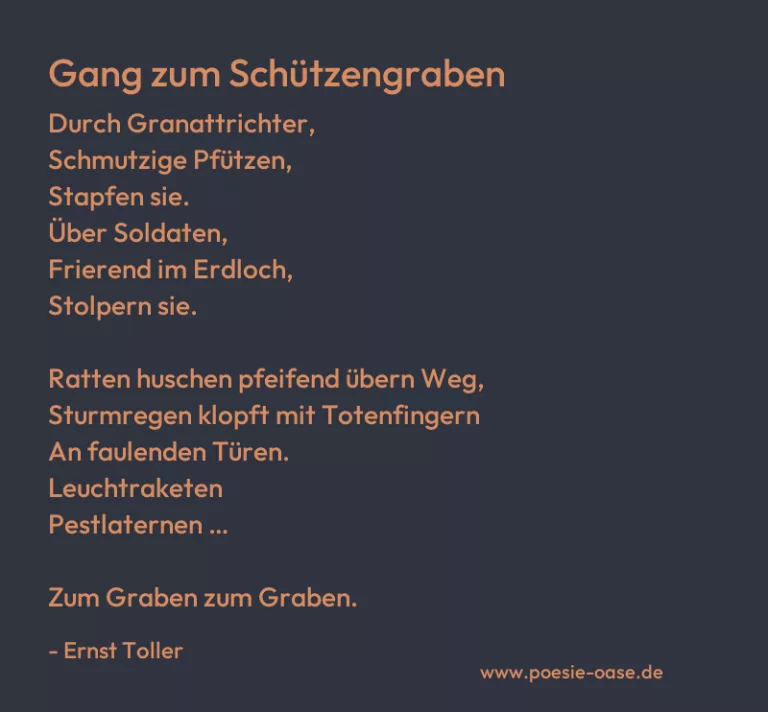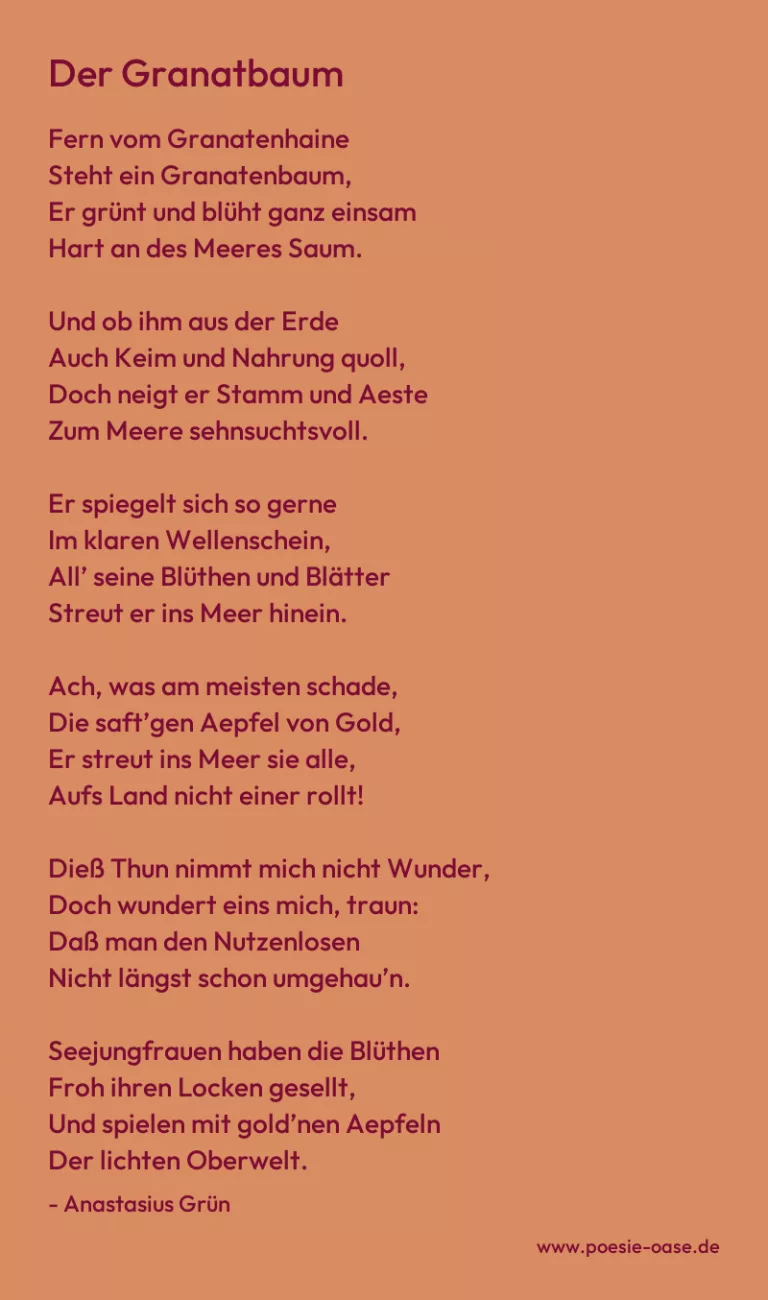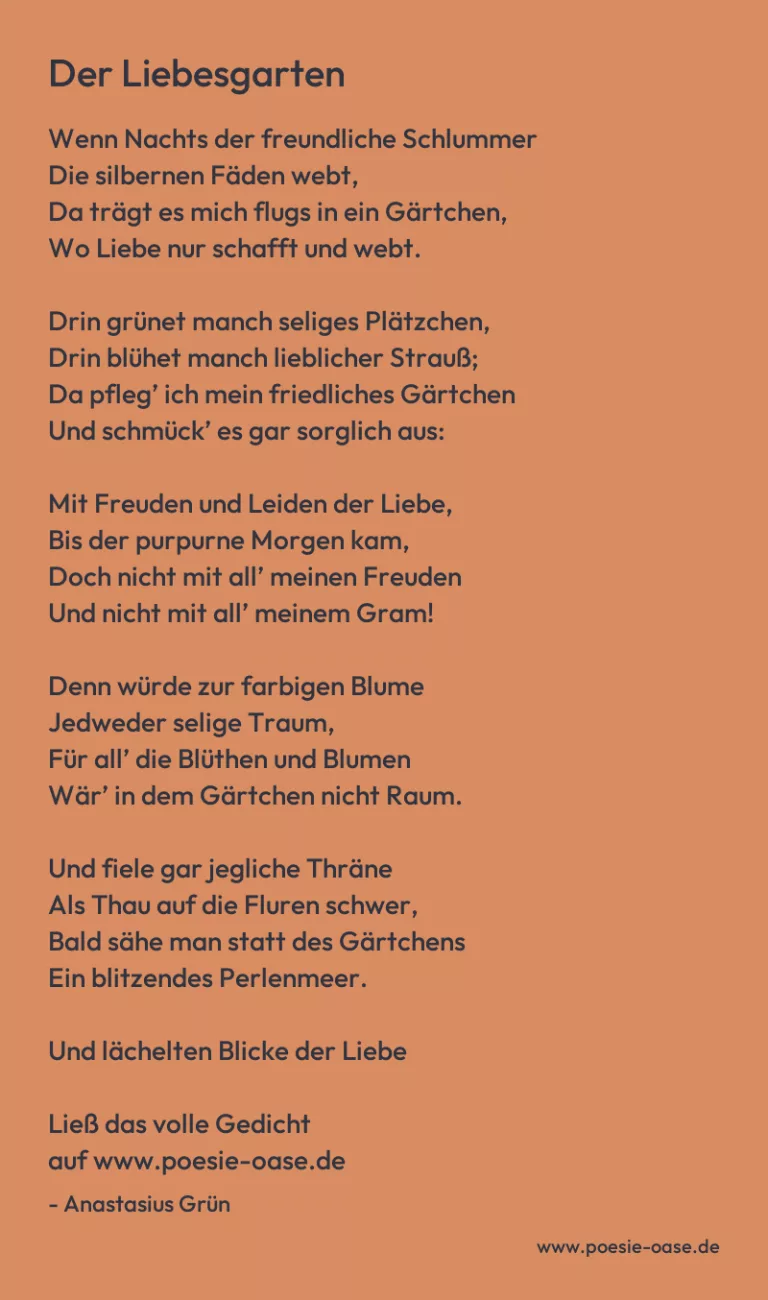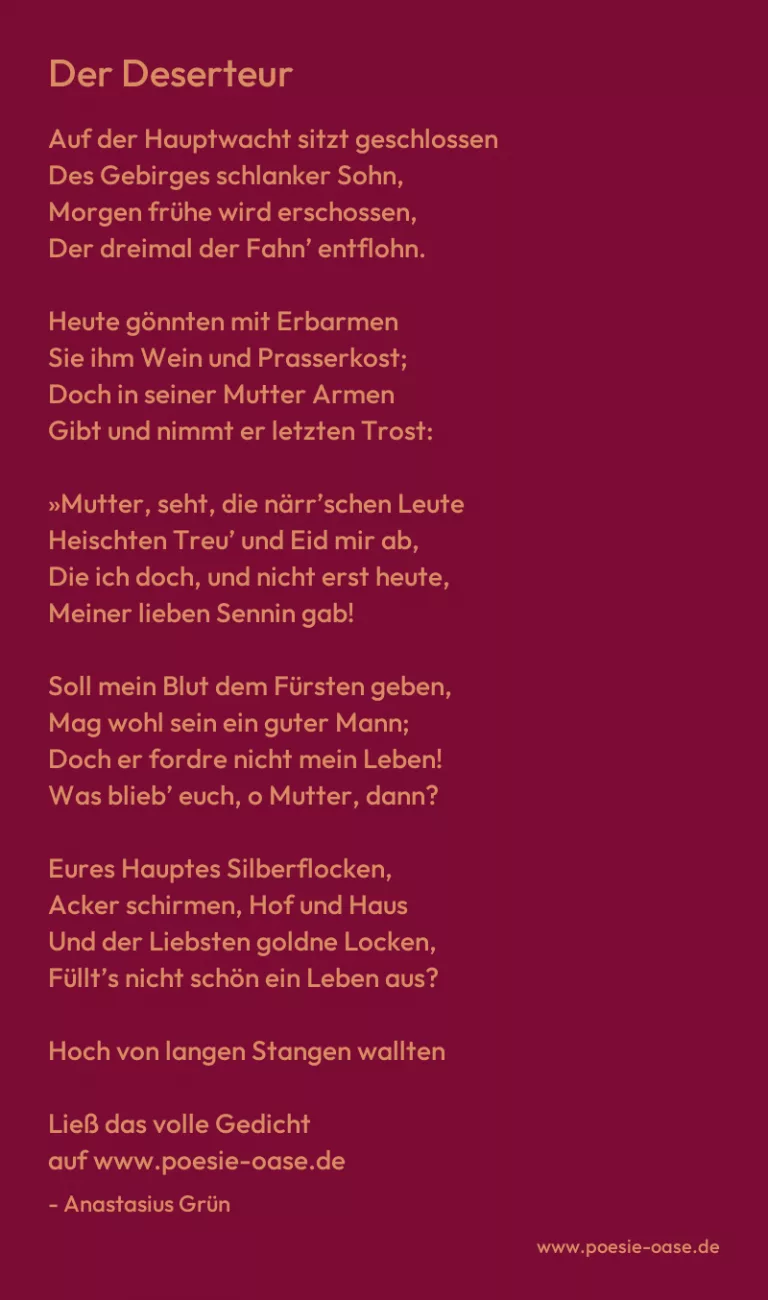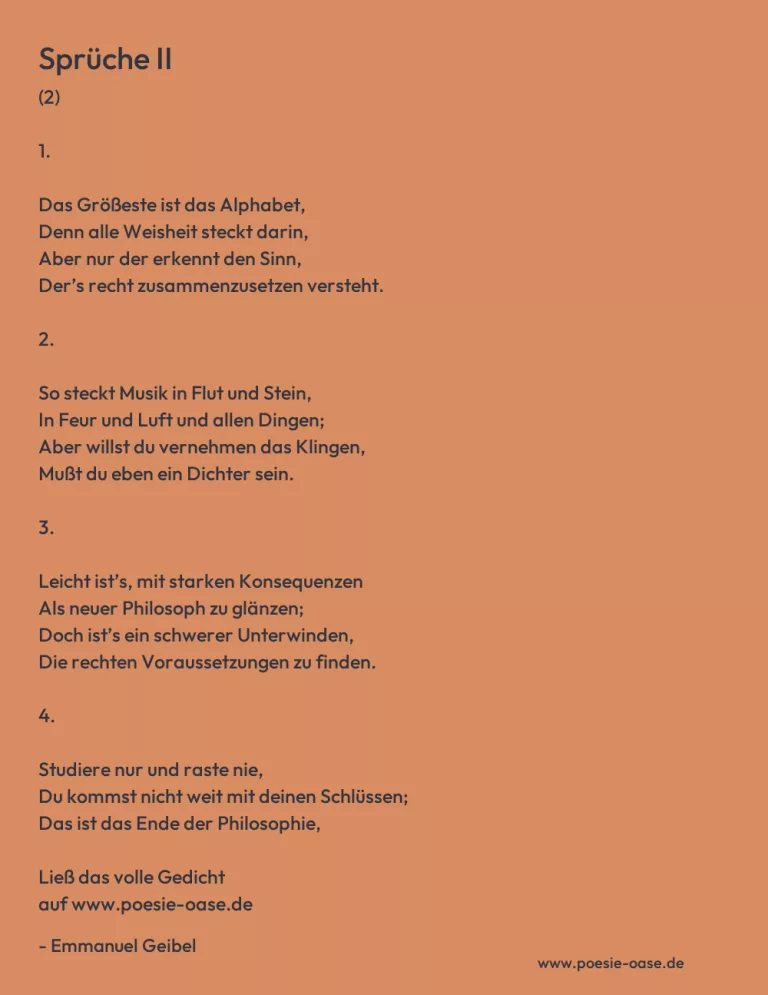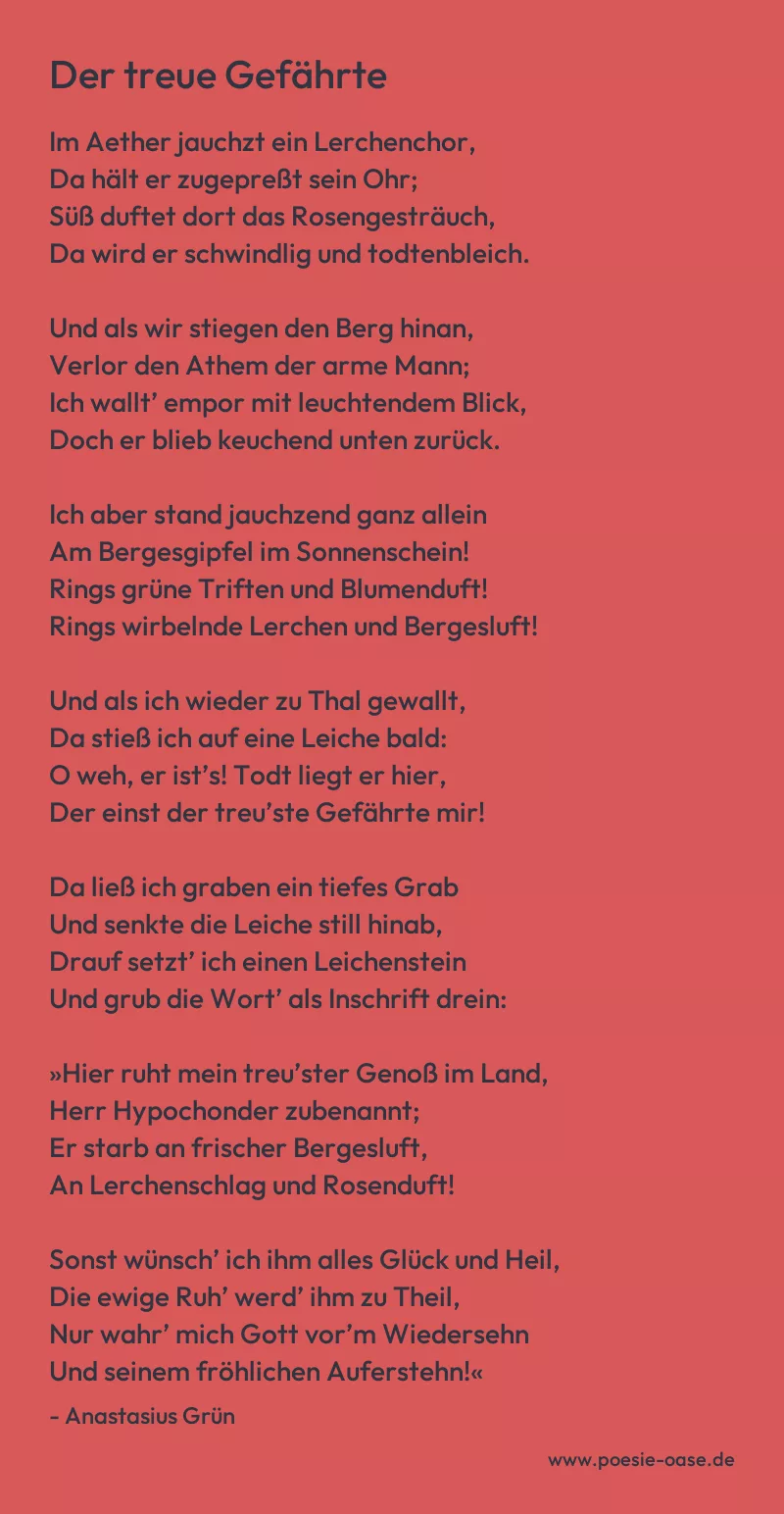Der treue Gefährte
Im Aether jauchzt ein Lerchenchor,
Da hält er zugepreßt sein Ohr;
Süß duftet dort das Rosengesträuch,
Da wird er schwindlig und todtenbleich.
Und als wir stiegen den Berg hinan,
Verlor den Athem der arme Mann;
Ich wallt’ empor mit leuchtendem Blick,
Doch er blieb keuchend unten zurück.
Ich aber stand jauchzend ganz allein
Am Bergesgipfel im Sonnenschein!
Rings grüne Triften und Blumenduft!
Rings wirbelnde Lerchen und Bergesluft!
Und als ich wieder zu Thal gewallt,
Da stieß ich auf eine Leiche bald:
O weh, er ist’s! Todt liegt er hier,
Der einst der treu’ste Gefährte mir!
Da ließ ich graben ein tiefes Grab
Und senkte die Leiche still hinab,
Drauf setzt’ ich einen Leichenstein
Und grub die Wort’ als Inschrift drein:
»Hier ruht mein treu’ster Genoß im Land,
Herr Hypochonder zubenannt;
Er starb an frischer Bergesluft,
An Lerchenschlag und Rosenduft!
Sonst wünsch’ ich ihm alles Glück und Heil,
Die ewige Ruh’ werd’ ihm zu Theil,
Nur wahr’ mich Gott vor’m Wiedersehn
Und seinem fröhlichen Auferstehn!«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
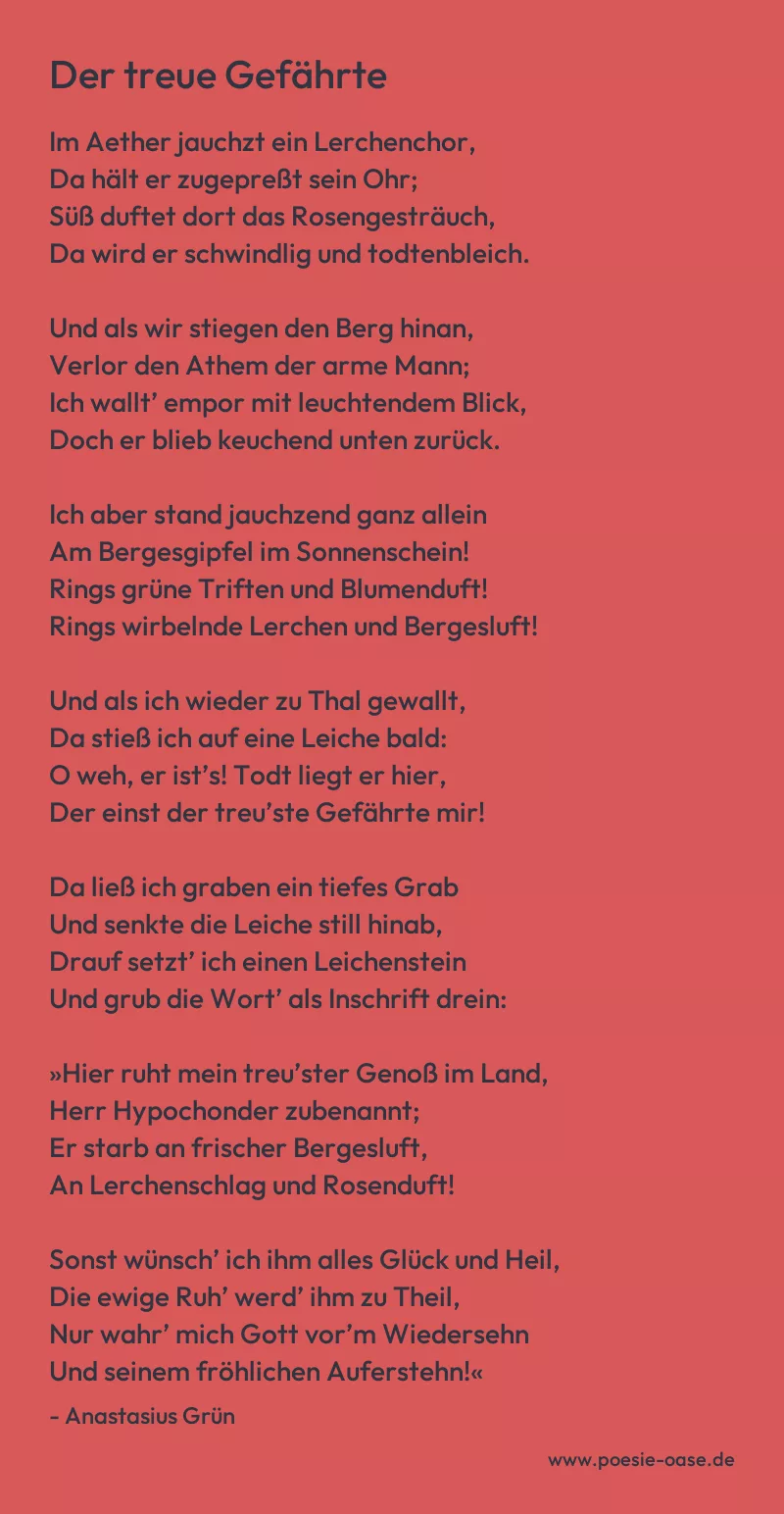
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der treue Gefährte“ von Anastasius Grün ist eine ironische Auseinandersetzung mit der Hypochondrie und dem Tod. Der Text präsentiert die Geschichte eines lyrischen Ichs und seines „treuesten Gefährten“, der anscheinend an den Freuden der Natur, wie Gesang der Lerchen, Rosenduft und frischer Bergluft, stirbt. Das Gedicht ist in fünf Strophen unterteilt, wobei die ersten drei die Reise und die Freude des Ichs am Gipfel beschreiben, während die letzten beiden die Entdeckung des Todes des Gefährten und die ironische Grabinschrift beinhalten.
Die Ironie des Gedichts offenbart sich in der Kontrastierung von Leben und Tod, Freude und Leid. Während das lyrische Ich die Natur in vollen Zügen genießt, wird der Gefährte von diesen vermeintlich positiven Einflüssen krank und stirbt schließlich. Die im Titel versprochene „Treue“ des Gefährten wird ad absurdum geführt, da er nicht in der Lage ist, die Reise zu überstehen und somit das Ich nicht begleiten kann. Die Verwendung von Begriffen wie „zugepreßt sein Ohr“, „schwindlig und todtenbleich“ und „keuchend“ unterstreicht die gesundheitlichen Probleme des Gefährten und verstärkt den komödiantischen Effekt.
Die Grabinschrift, die vom Ich verfasst wird, ist der Höhepunkt der Ironie. Sie bezeichnet den Verstorbenen als „Herr Hypochonder zubenannt“, womit die Ursache des Todes, die übertriebene Sorge um die eigene Gesundheit, direkt benannt wird. Die Aufzählung der Faktoren, an denen er gestorben ist – „frischer Bergesluft, An Lerchenschlag und Rosenduft!“ – verdeutlicht die Absurdität der Situation. Der Wunsch des Ichs, vor einem „Wiedersehn“ mit seinem Gefährten verschont zu bleiben, unterstreicht schließlich die Distanz und den Hohn, der zwischen den beiden besteht, und deutet an, dass das Ich die Hypochondrie des Gefährten nie ernst nahm.
Anastasius Grün nutzt in diesem Gedicht sprachliche Mittel wie Reime, um die Leichtigkeit und den humorvollen Ton zu erzeugen. Die einfache Sprache und der Erzählstil erleichtern den Zugang zum Gedicht und verstärken gleichzeitig die ironische Wirkung. Die Verwendung von Adjektiven wie „schwindlig“ und „todtenbleich“ sowie die detaillierten Beschreibungen der Natur dienen dazu, die Kontraste zu verdeutlichen und die komische Wirkung zu verstärken. Das Gedicht ist somit eine satirische Auseinandersetzung mit der Hypochondrie, die gleichzeitig die Unfähigkeit des Ichs zur Empathie offenbart.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.