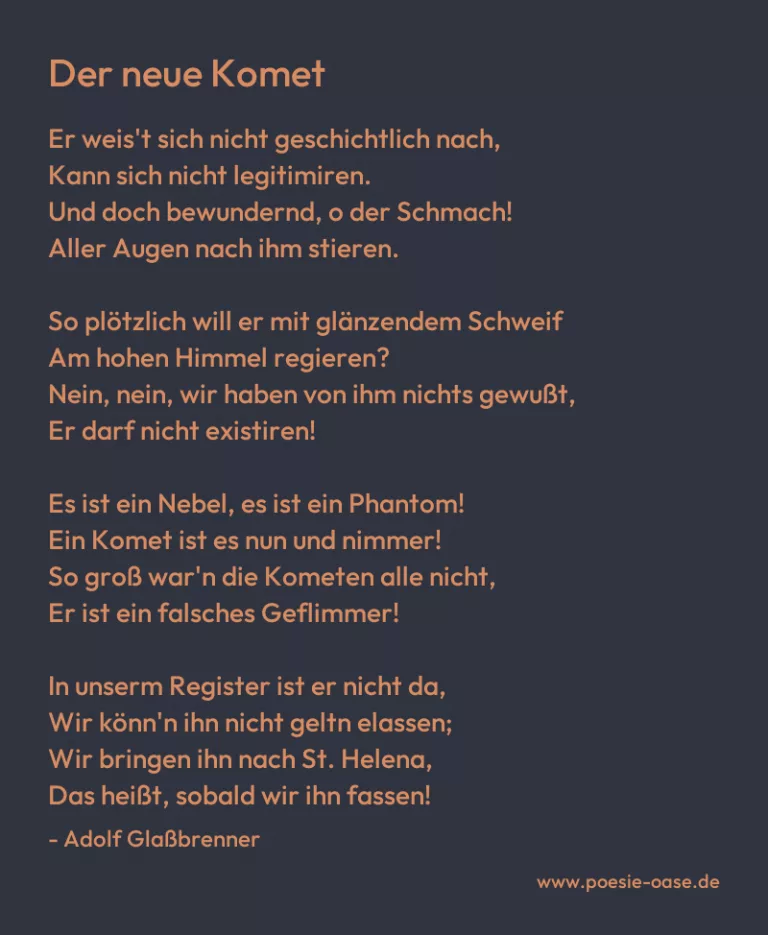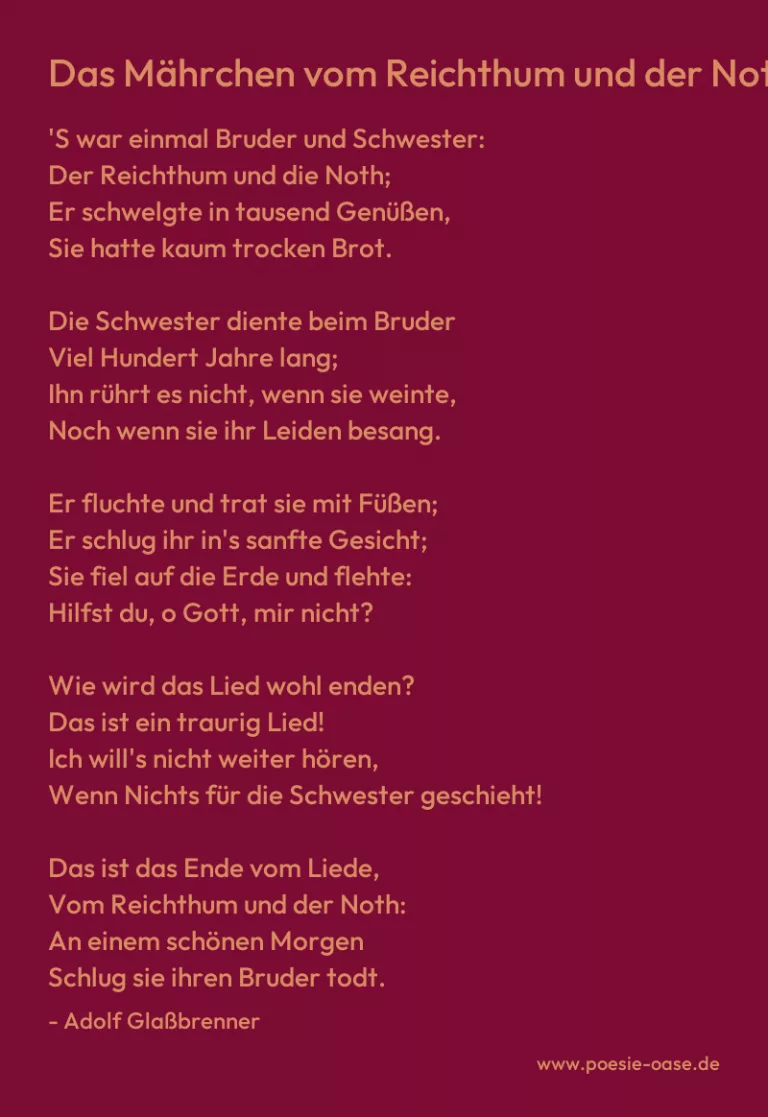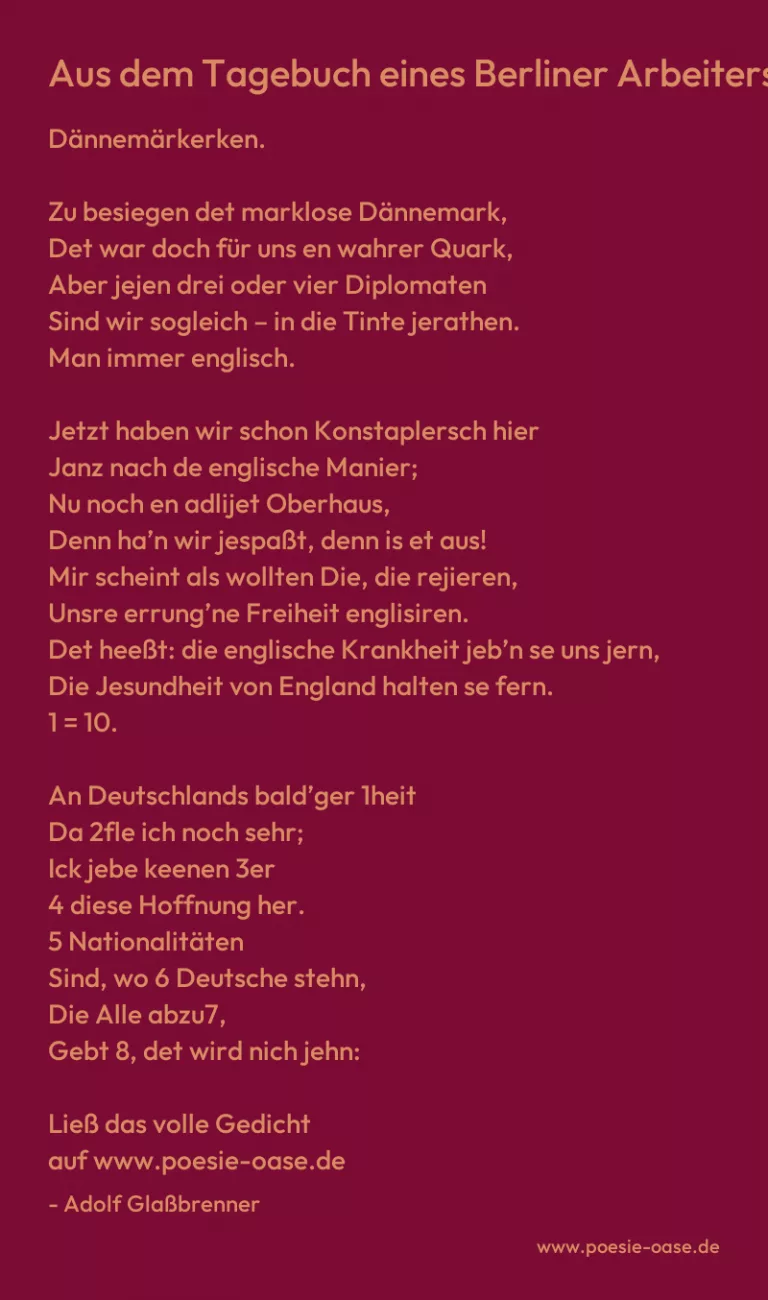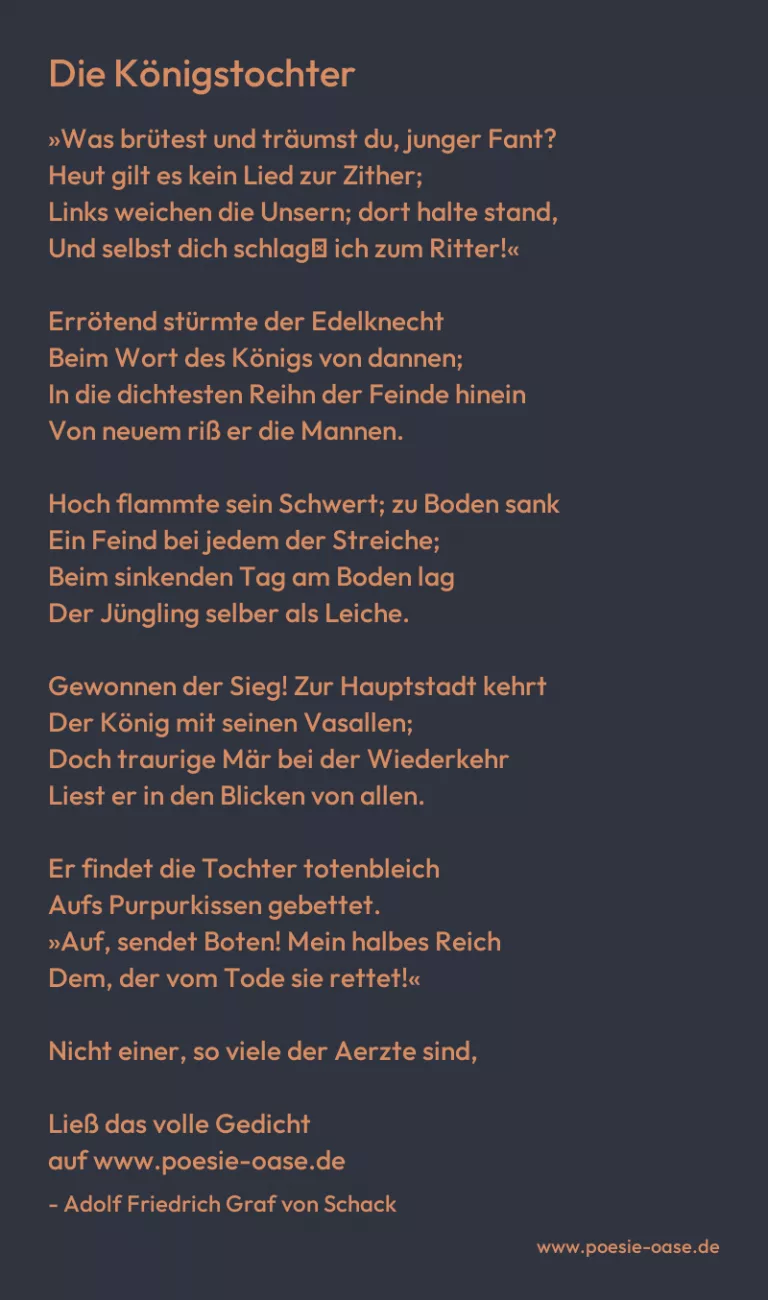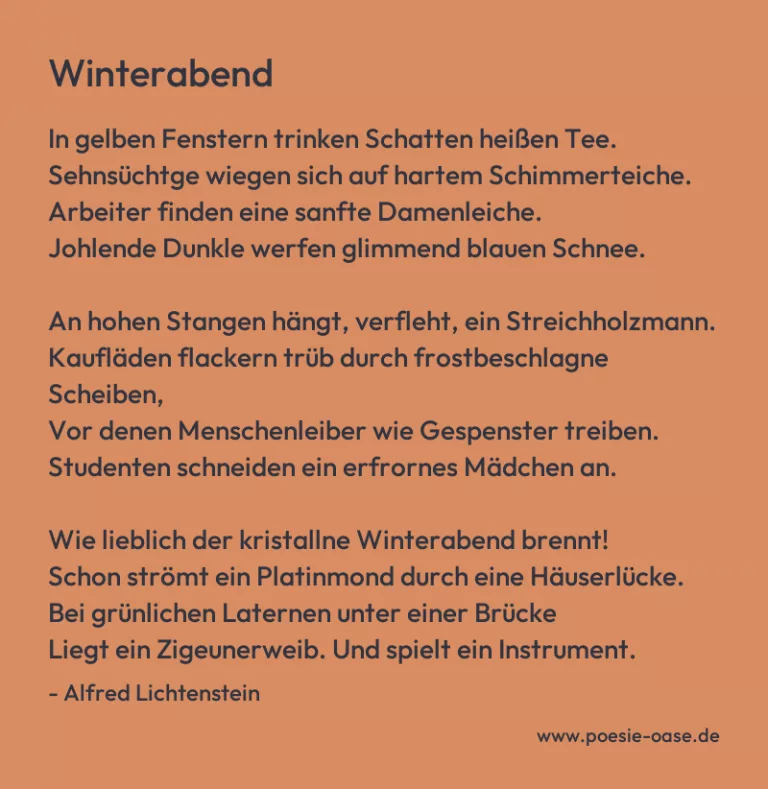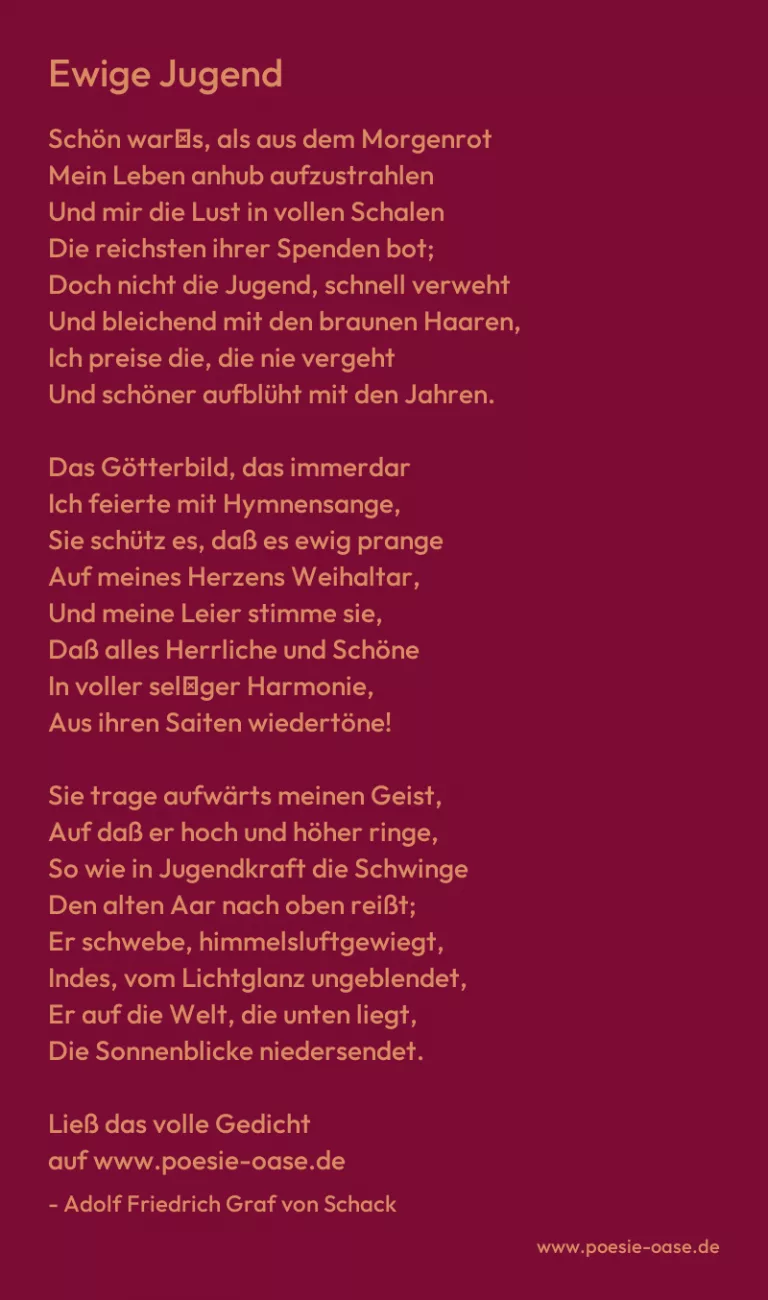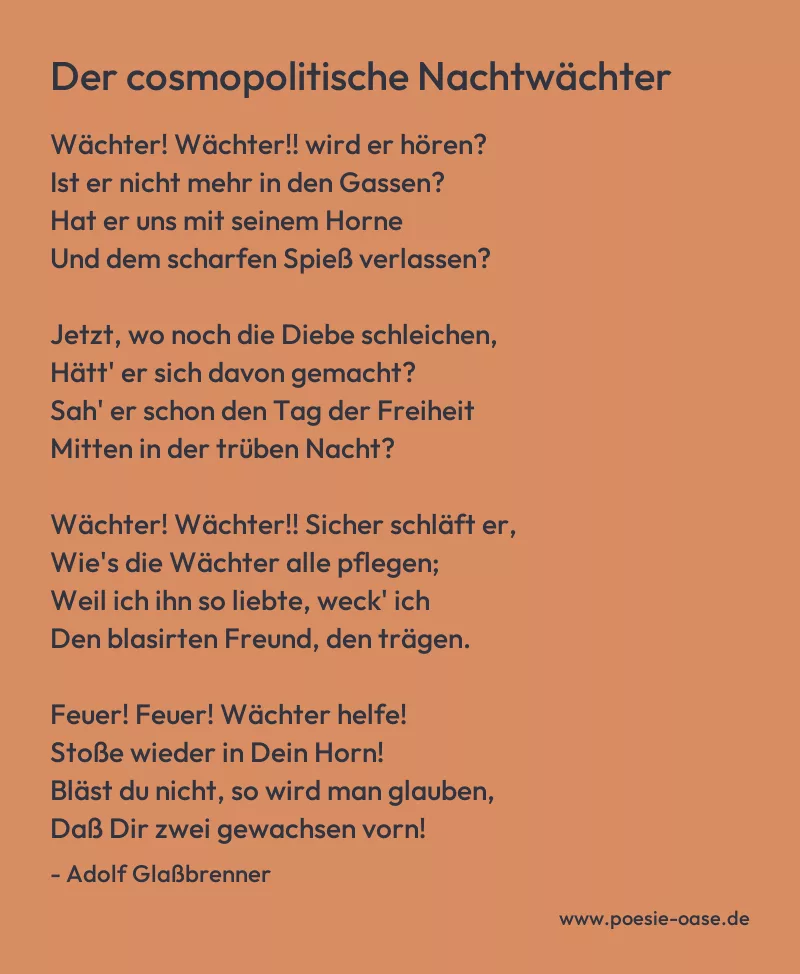Der cosmopolitische Nachtwächter
Wächter! Wächter!! wird er hören?
Ist er nicht mehr in den Gassen?
Hat er uns mit seinem Horne
Und dem scharfen Spieß verlassen?
Jetzt, wo noch die Diebe schleichen,
Hätt‘ er sich davon gemacht?
Sah‘ er schon den Tag der Freiheit
Mitten in der trüben Nacht?
Wächter! Wächter!! Sicher schläft er,
Wie’s die Wächter alle pflegen;
Weil ich ihn so liebte, weck‘ ich
Den blasirten Freund, den trägen.
Feuer! Feuer! Wächter helfe!
Stoße wieder in Dein Horn!
Bläst du nicht, so wird man glauben,
Daß Dir zwei gewachsen vorn!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
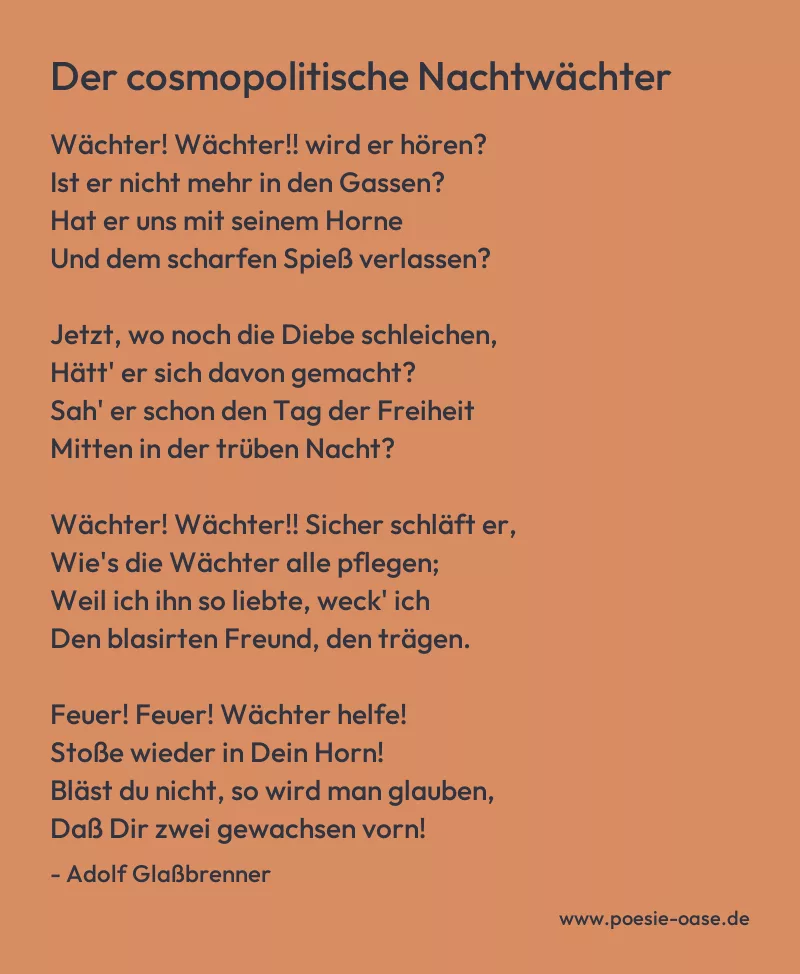
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der cosmopolitische Nachtwächter“ von Adolf Glaßbrenner ist eine humorvolle Kritik an der Trägheit und dem Desinteresse des Nachtwächters und, im übertragenen Sinne, an der scheinbaren Teilnahmslosigkeit der Obrigkeit. Der Dichter nutzt eine direkte Ansprache und ironische Fragen, um die Abwesenheit des Wächters in einer Situation hervorzuheben, in der er eigentlich gebraucht wird – insbesondere in der Nacht, wenn Diebe ihr Unwesen treiben. Der Titel „cosmopolitisch“ deutet bereits auf eine Ironie hin, da ein kosmopolitischer Nachtwächter, der sich um die Belange der Welt kümmern sollte, hier eher als untätig dargestellt wird.
Das Gedicht beginnt mit einer direkten Anrufung des Wächters, gefolgt von bohrenden Fragen, die seine Abwesenheit und mögliche Gründe dafür hinterfragen. Die rhetorischen Fragen wie „Ist er nicht mehr in den Gassen?“ und „Hat er uns mit seinem Horne Und dem scharfen Spieß verlassen?“ erzeugen eine Atmosphäre der Ungläubigkeit und des Verdachts. Die zweite Strophe setzt diesen Gedanken fort, indem sie die Befürchtung äußert, der Wächter könnte sich davongemacht haben, vielleicht sogar, weil er bereits den Anbruch eines neuen, freien Tages sieht. Diese Formulierung enthält einen subversiven Unterton, der auf eine Sehnsucht nach Veränderung und einer besseren Gesellschaft hindeutet.
In der dritten Strophe wird die Situation auf humorvolle Weise auf den Punkt gebracht. Die Vermutung, dass der Wächter schläft, wie es „die Wächter alle pflegen“, ist eine klare Anspielung auf die allgemeine Trägheit und mangelnde Einsatzbereitschaft. Der Dichter bezeichnet den Wächter als „blasirten Freund, den trägen“, was die Ironie verstärkt und die Distanz zwischen dem Erzähler und dem Wächter betont. Die Formulierung „Weil ich ihn so liebte, weck‘ ich“ deutet auf eine sarkastische Zuneigung hin, da der Wunsch nach dem Erwecken des Wächters eher dem dringenden Bedarf nach Sicherheit entspringt als echter Liebe.
Der Höhepunkt des Gedichts ist der Ruf „Feuer! Feuer! Wächter helfe!“. Dieser Notruf, kombiniert mit der Aufforderung, das Horn zu stoßen, unterstreicht die Dringlichkeit der Situation. Der letzte Vers, „Bläst du nicht, so wird man glauben, Dass Dir zwei gewachsen vorn!“, ist ein humorvoller, fast schon frecher Kommentar. Er deutet an, dass, wenn der Wächter sein Horn nicht bläst, was seine Aufgabe ist, er möglicherweise untauglich für seinen Dienst ist. Diese Zeile, zusammen mit den anderen Elementen des Gedichts, erzeugt eine humorvolle, aber gleichzeitig kritische Reflexion über Pflicht, Verantwortung und die Rolle der Obrigkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.