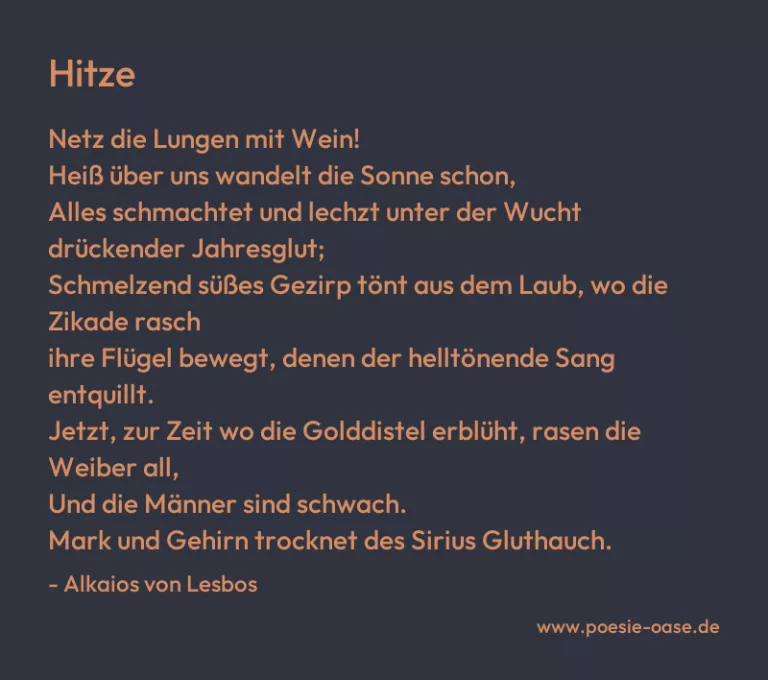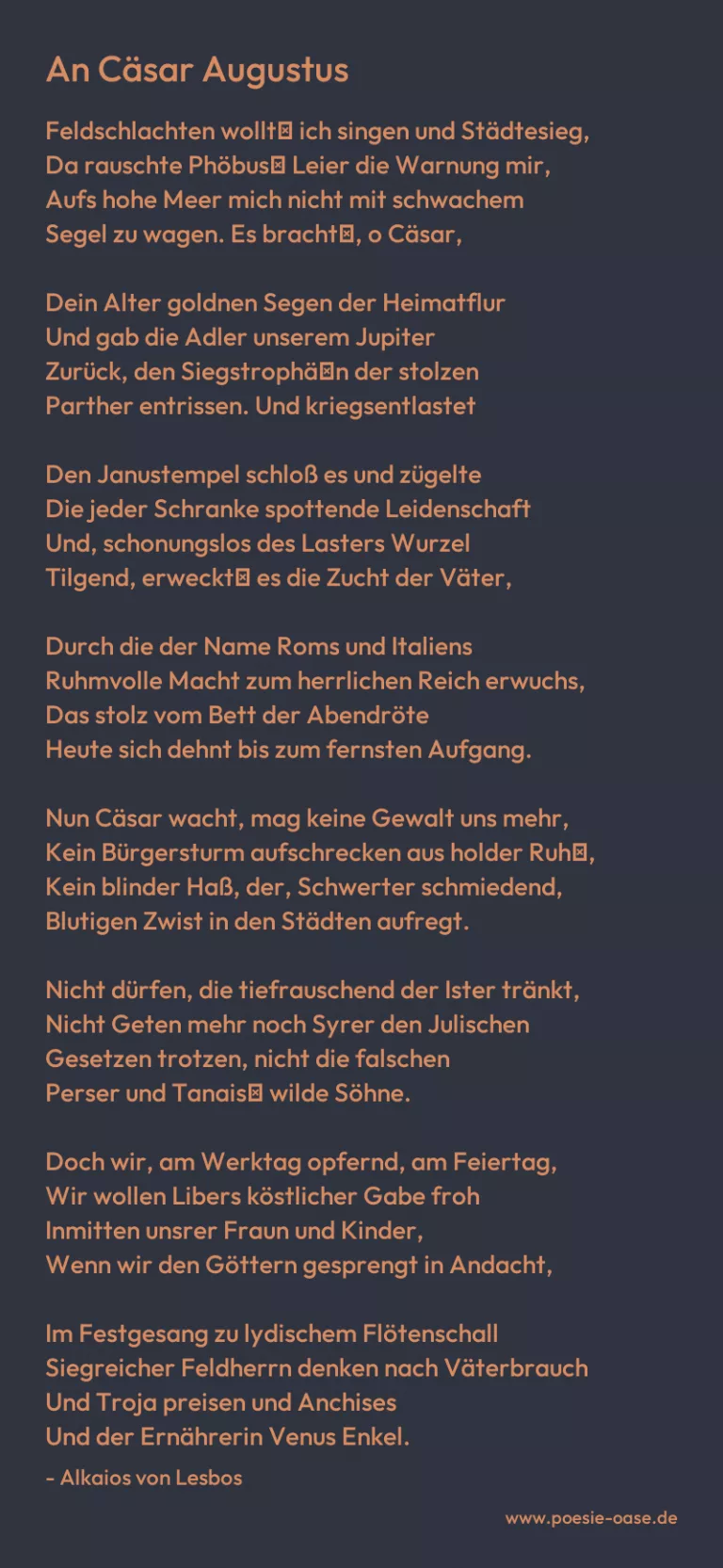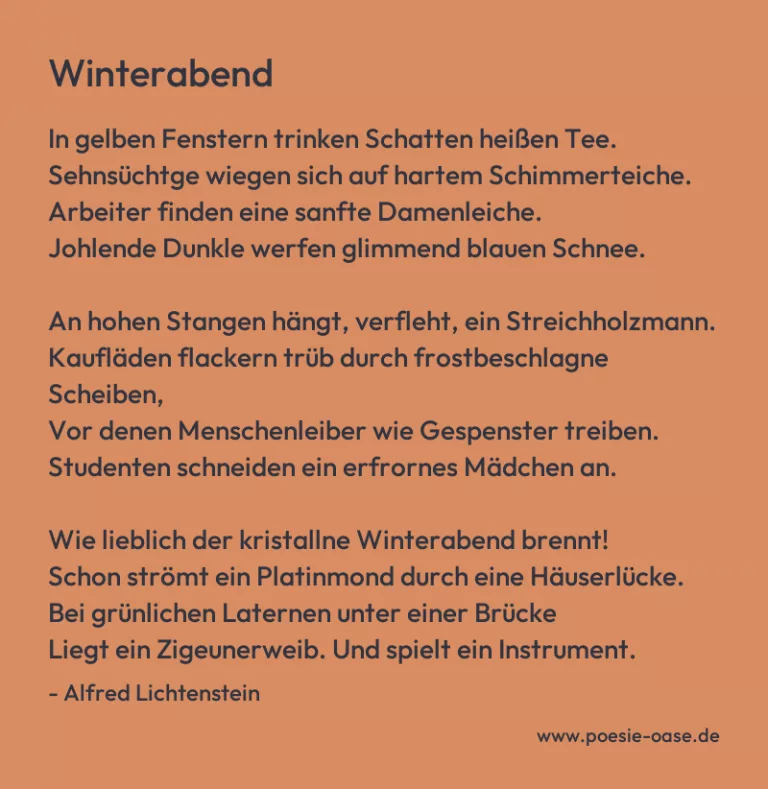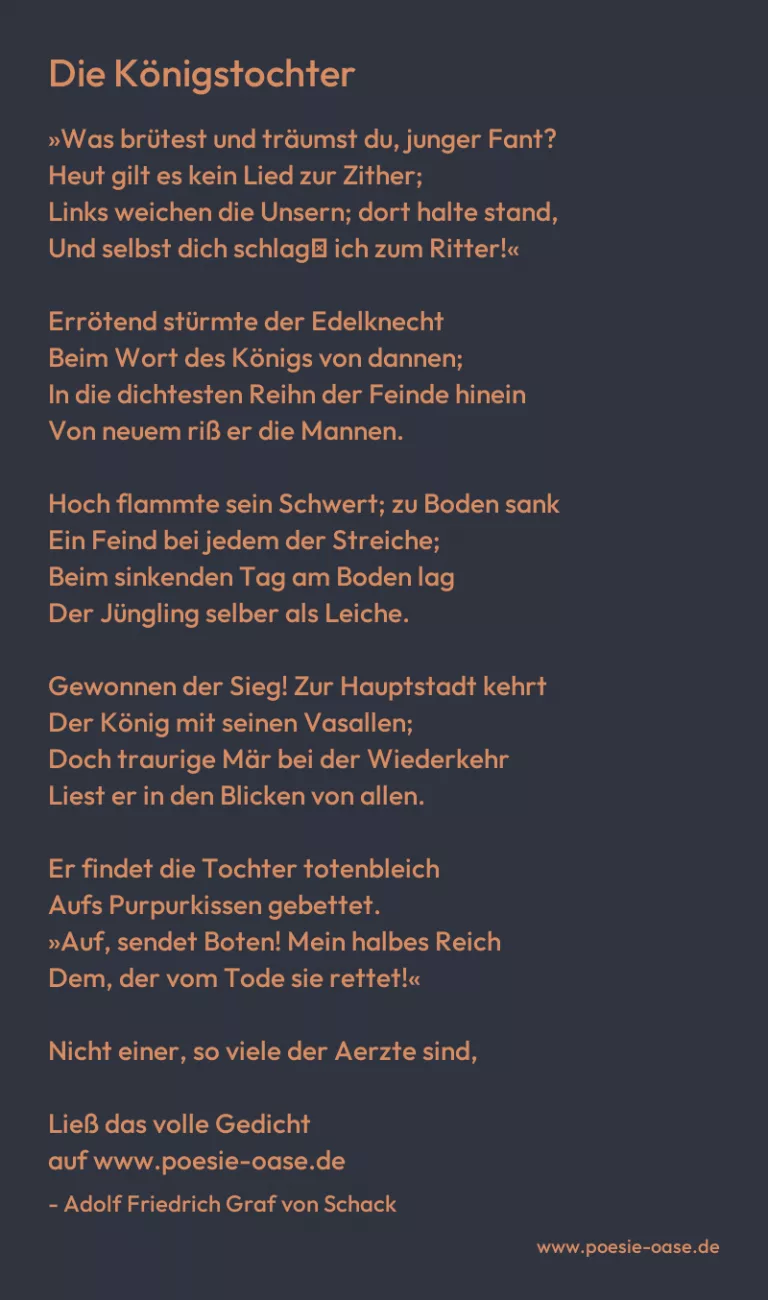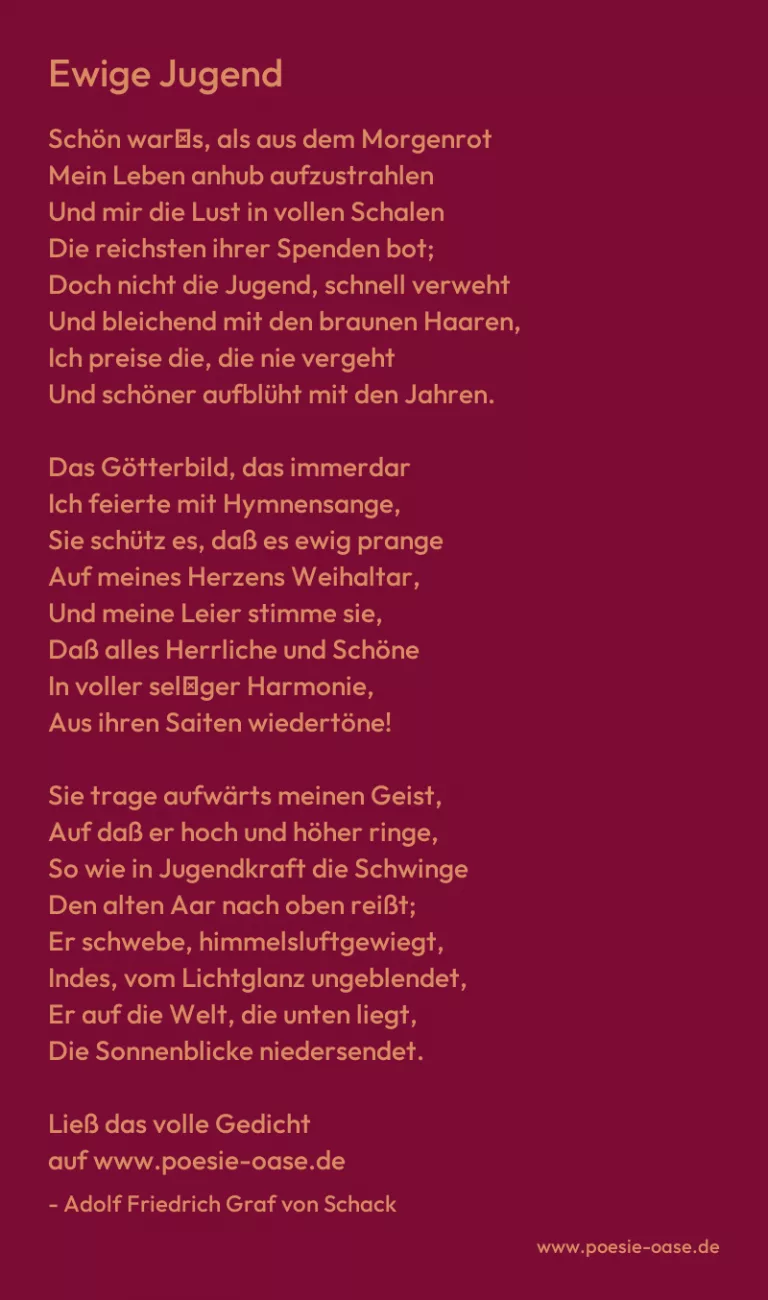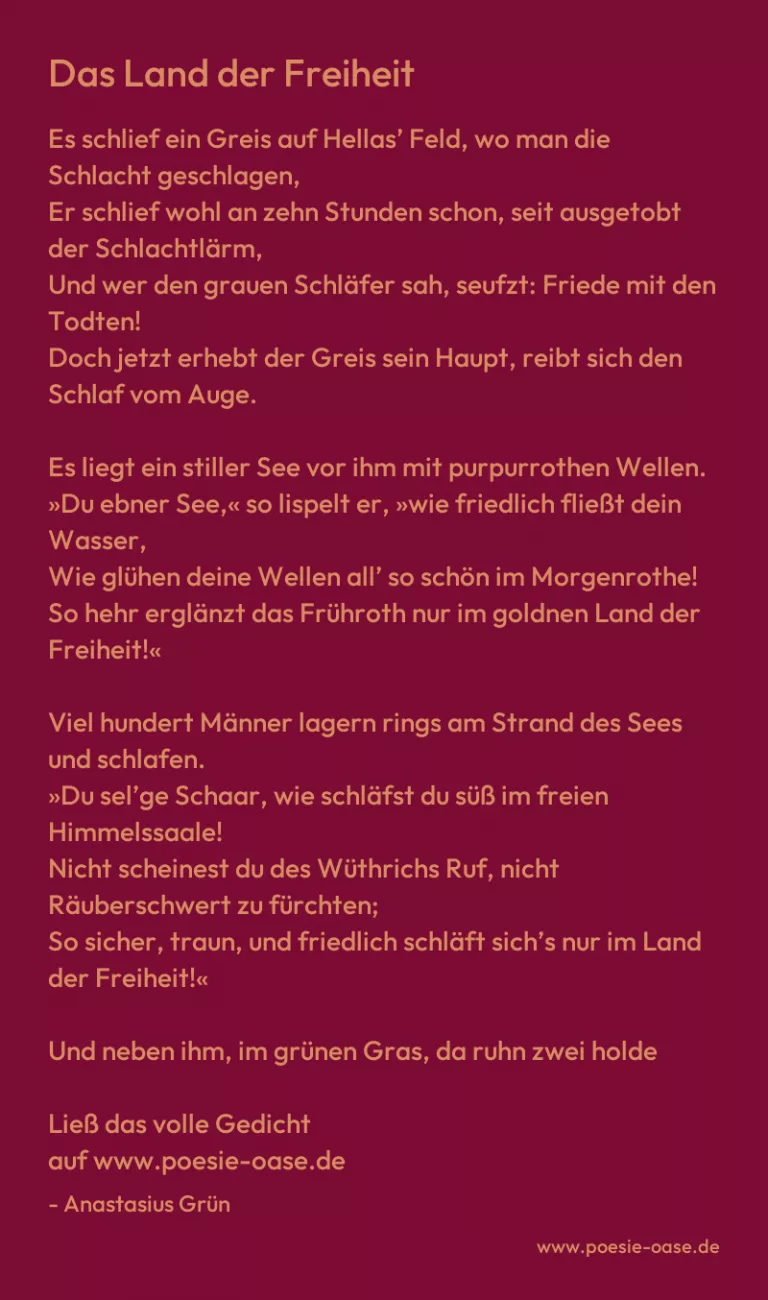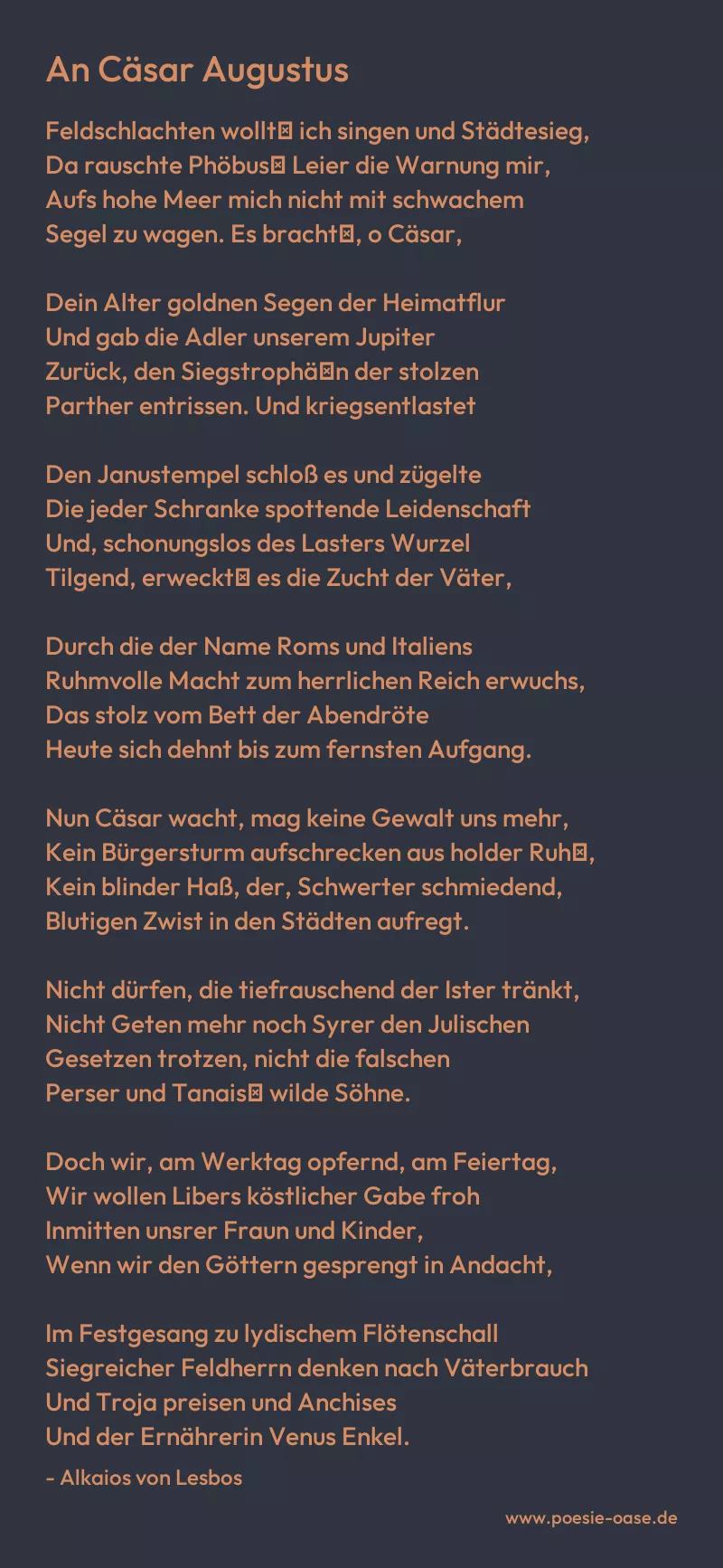Feldschlachten wollt′ ich singen und Städtesieg,
Da rauschte Phöbus′ Leier die Warnung mir,
Aufs hohe Meer mich nicht mit schwachem
Segel zu wagen. Es bracht′, o Cäsar,
Dein Alter goldnen Segen der Heimatflur
Und gab die Adler unserem Jupiter
Zurück, den Siegstrophä′n der stolzen
Parther entrissen. Und kriegsentlastet
Den Janustempel schloß es und zügelte
Die jeder Schranke spottende Leidenschaft
Und, schonungslos des Lasters Wurzel
Tilgend, erweckt′ es die Zucht der Väter,
Durch die der Name Roms und Italiens
Ruhmvolle Macht zum herrlichen Reich erwuchs,
Das stolz vom Bett der Abendröte
Heute sich dehnt bis zum fernsten Aufgang.
Nun Cäsar wacht, mag keine Gewalt uns mehr,
Kein Bürgersturm aufschrecken aus holder Ruh′,
Kein blinder Haß, der, Schwerter schmiedend,
Blutigen Zwist in den Städten aufregt.
Nicht dürfen, die tiefrauschend der Ister tränkt,
Nicht Geten mehr noch Syrer den Julischen
Gesetzen trotzen, nicht die falschen
Perser und Tanais′ wilde Söhne.
Doch wir, am Werktag opfernd, am Feiertag,
Wir wollen Libers köstlicher Gabe froh
Inmitten unsrer Fraun und Kinder,
Wenn wir den Göttern gesprengt in Andacht,
Im Festgesang zu lydischem Flötenschall
Siegreicher Feldherrn denken nach Väterbrauch
Und Troja preisen und Anchises
Und der Ernährerin Venus Enkel.