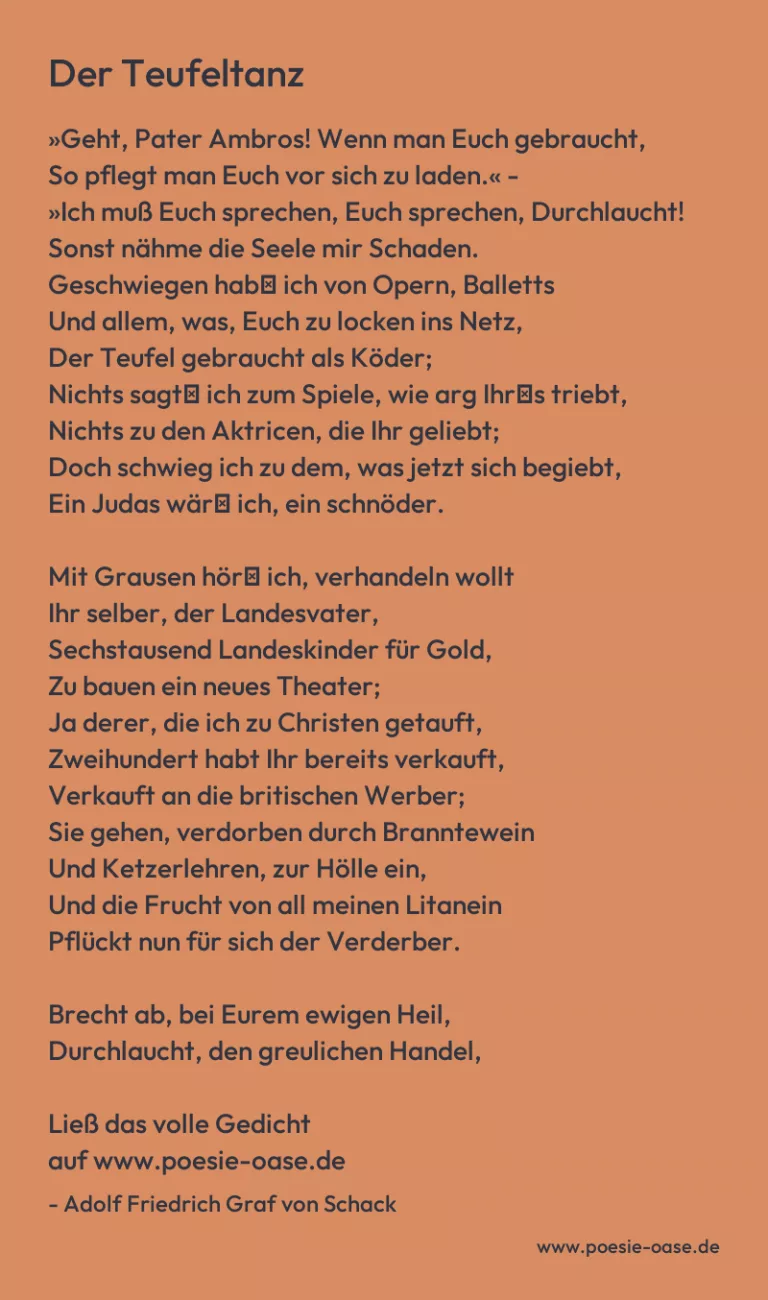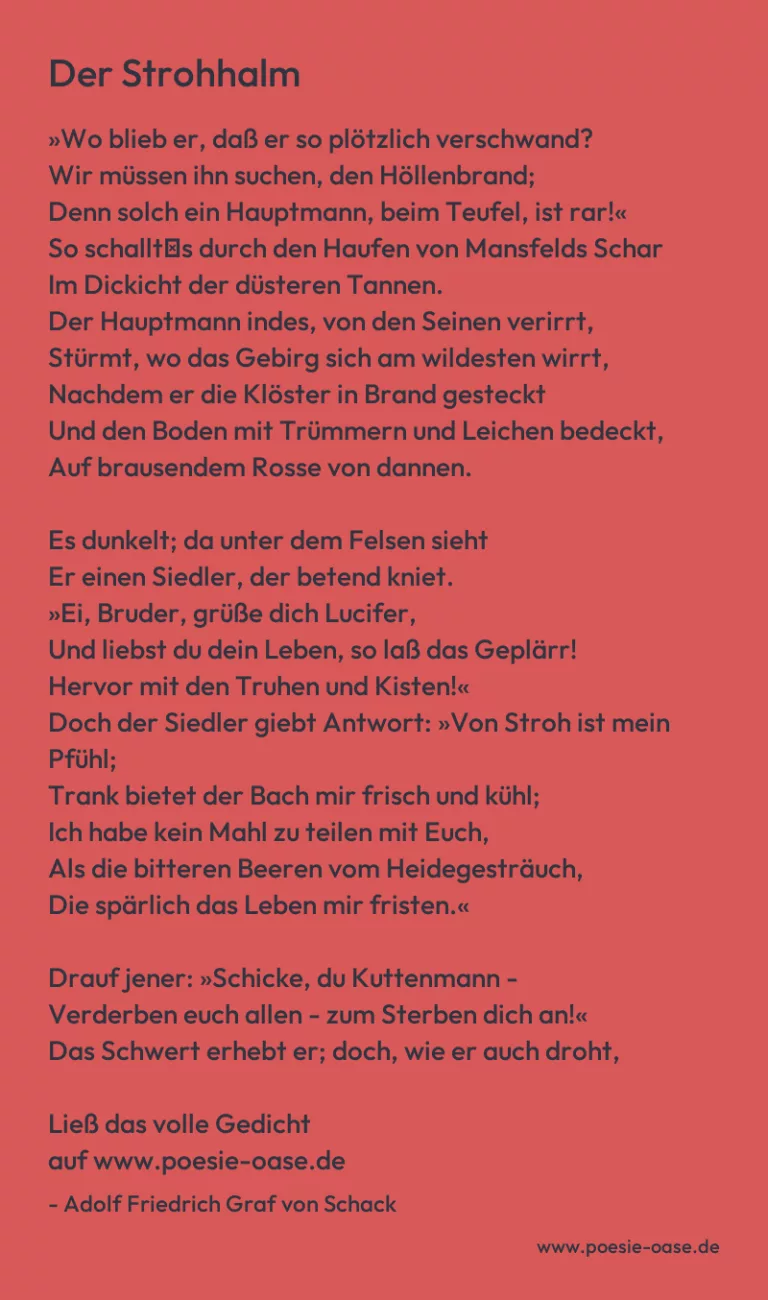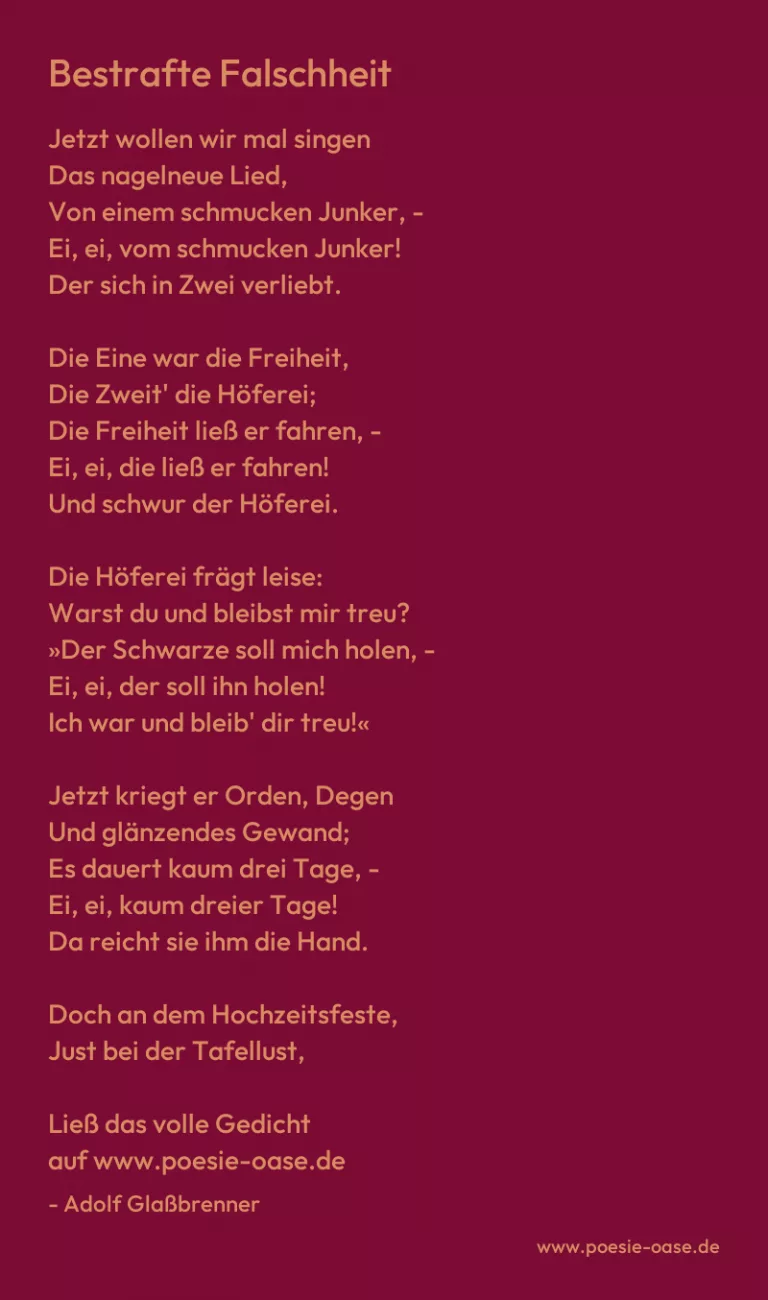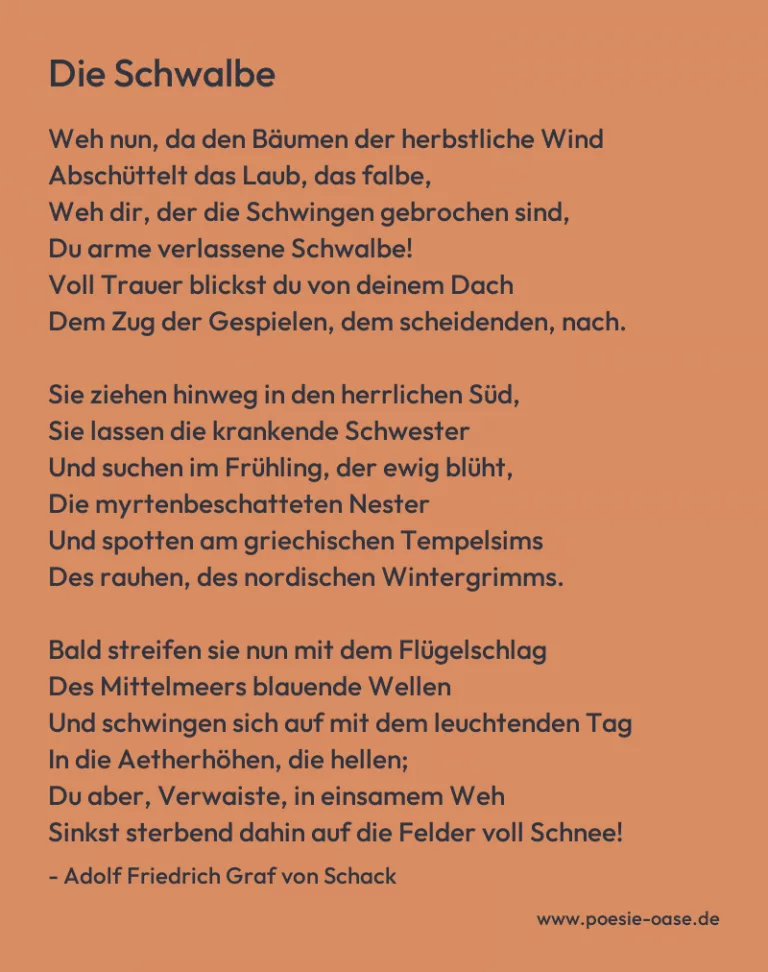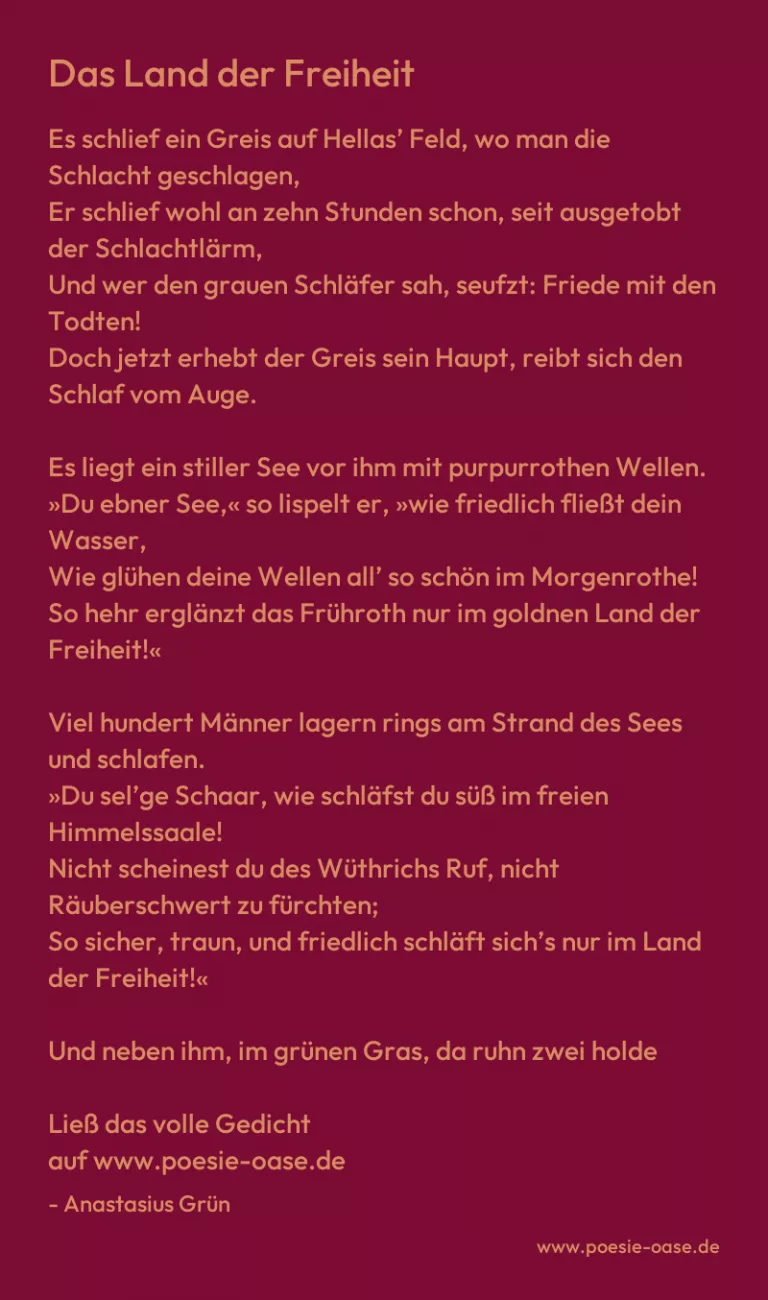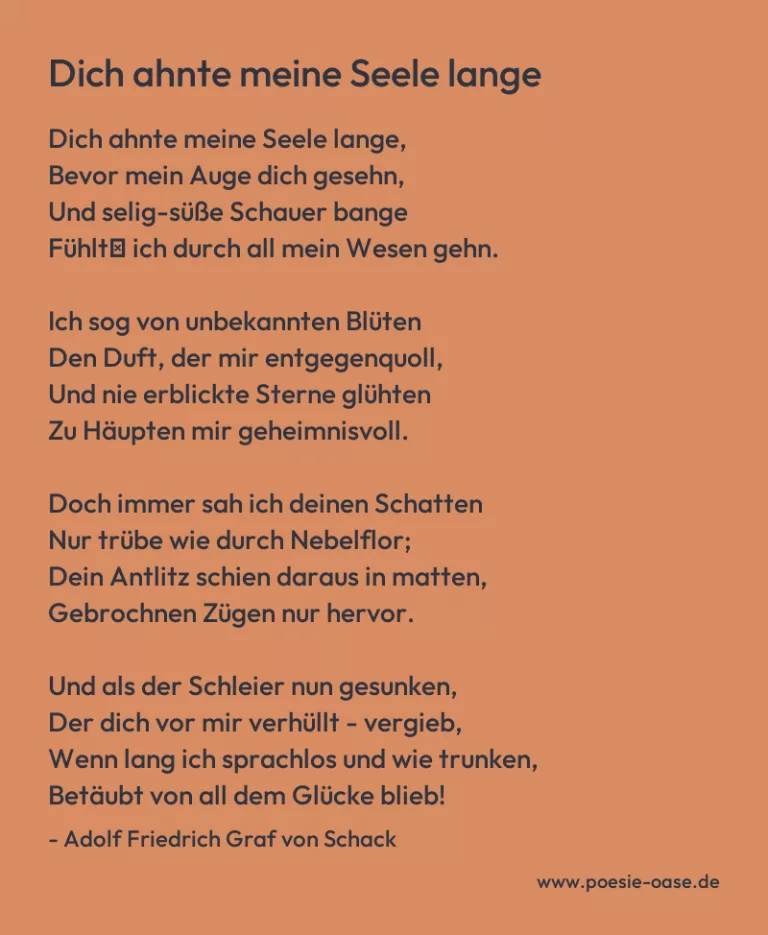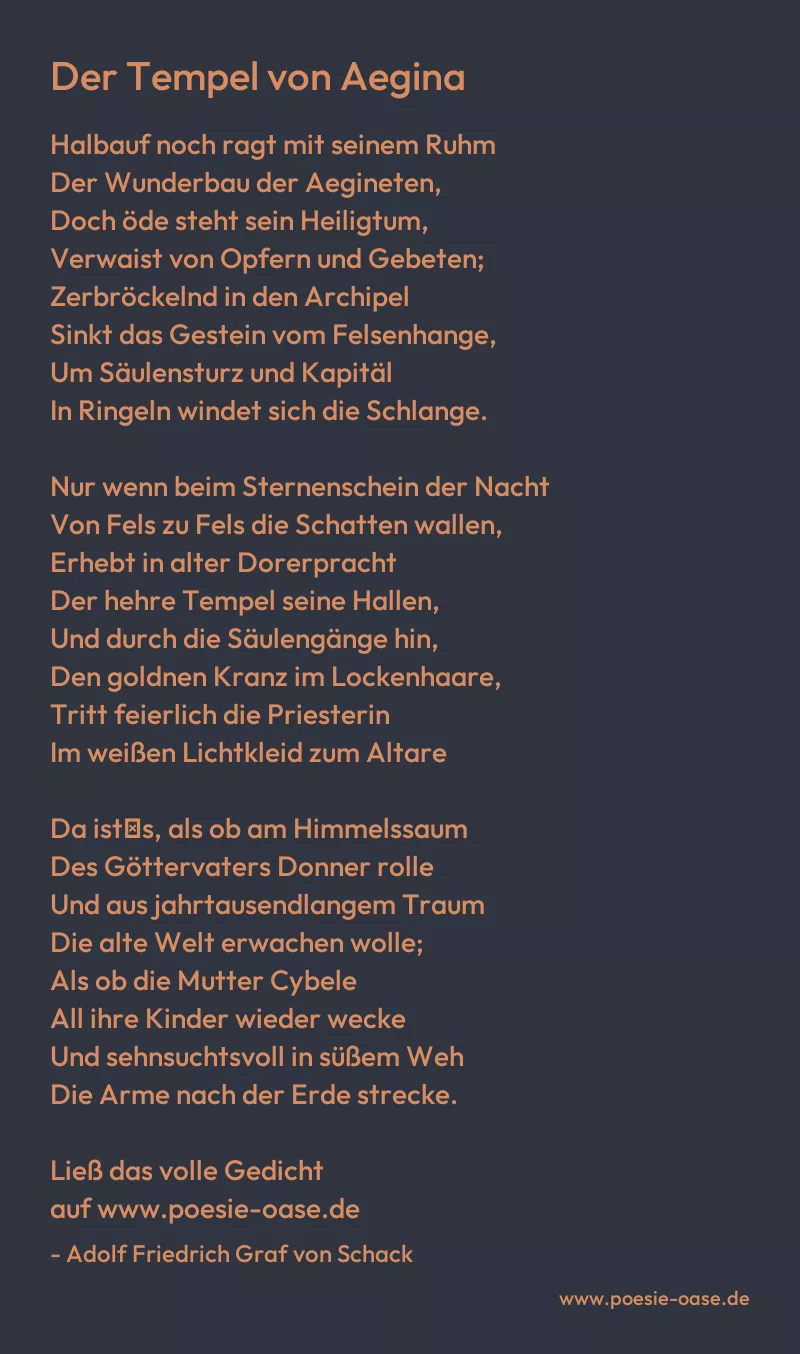Angst, Berge & Täler, Frieden, Griechenland, Heldenmut, Herbst, Himmel & Wolken, Identität, Kriegsgeschichte, Natur, Sagen, Tiere, Wälder & Bäume, Zauber, Zerstörung
Der Tempel von Aegina
Halbauf noch ragt mit seinem Ruhm
Der Wunderbau der Aegineten,
Doch öde steht sein Heiligtum,
Verwaist von Opfern und Gebeten;
Zerbröckelnd in den Archipel
Sinkt das Gestein vom Felsenhange,
Um Säulensturz und Kapitäl
In Ringeln windet sich die Schlange.
Nur wenn beim Sternenschein der Nacht
Von Fels zu Fels die Schatten wallen,
Erhebt in alter Dorerpracht
Der hehre Tempel seine Hallen,
Und durch die Säulengänge hin,
Den goldnen Kranz im Lockenhaare,
Tritt feierlich die Priesterin
Im weißen Lichtkleid zum Altare
Da ist′s, als ob am Himmelssaum
Des Göttervaters Donner rolle
Und aus jahrtausendlangem Traum
Die alte Welt erwachen wolle;
Als ob die Mutter Cybele
All ihre Kinder wieder wecke
Und sehnsuchtsvoll in süßem Weh
Die Arme nach der Erde strecke.
Und horch! Ein Regen auf der Flur,
Ein Rauschen um die Uferklippen!
Noch einmal öffnet die Natur
Aufjubelnd ihre bleichen Lippen;
In kühler Grotten Dämmerglanz
Und an den hallenden Gestaden
Schlingt sich der Nymphen Reigentanz;
Im Walde flüstern die Dryaden.
Und wie Gesänge des Homer
Tönt es durch das Geroll der Wogen;
Auf silbernem Gewölk daher
Kommt leuchtend Artemis gezogen;
Anbetend gießt die Priesterin
Das Opfer aus der Weiheschale –
Doch neu in Schweigen und Ruin
Sinkt alles hin beim Morgenstrahle.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
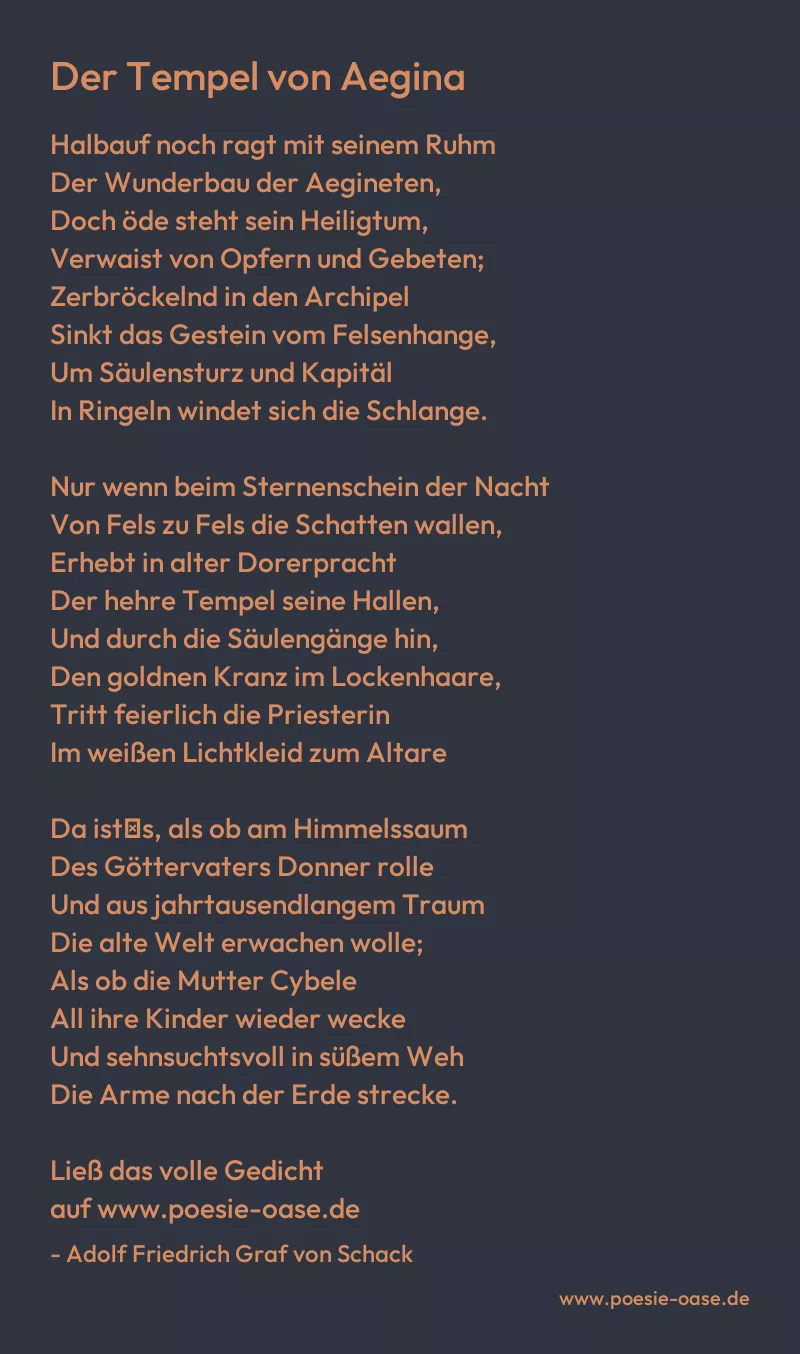
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Tempel von Aegina“ von Adolf Friedrich Graf von Schack beschreibt eine Szene der Verlassenheit und des Verfalls, gleichzeitig aber auch der Wiederauferstehung und der Erinnerung an vergangene Größe. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung des Tempels, der zwar noch in seiner Pracht zu erkennen ist, aber verlassen und dem Verfall preisgegeben ist. Die Natur erobert das Bauwerk zurück, die Schlange windet sich um die zerbröckelnden Säulen, was den Kontrast zwischen der einstigen menschlichen Schöpfung und der unaufhaltsamen Kraft der Natur verdeutlicht.
In der zweiten Strophe erfährt die Szene eine Wendung. Bei Nacht, wenn der Sternenschein die Schatten auf dem Felsen tanzen lässt, erwacht der Tempel zu neuem Leben. Die Priesterin tritt feierlich aus den Säulengängen, wodurch eine Verbindung zur Vergangenheit hergestellt wird. Sie symbolisiert die lebendige Tradition und die Erinnerung an die Götter, die einst in diesem Tempel verehrt wurden. Die Beschreibung der Priesterin, die mit goldenem Kranz im Haar und im weißen Lichtkleid zum Altar tritt, erzeugt ein Bild von Reinheit, Erhabenheit und der Wiederherstellung der alten Rituale.
Die dritte Strophe steigert die Atmosphäre der Wiedergeburt. Es ist, als ob die Götterväter wieder erwachen, und die gesamte Natur erwacht mit ihnen. Cybele, die Mutter aller Götter, scheint ihre Kinder zu rufen. Das Gedicht suggeriert eine tiefe Sehnsucht nach der Vergangenheit und eine Nostalgie nach der alten Welt, in der die Götter präsent waren und die Menschen in Einklang mit der Natur lebten.
Die vierte Strophe beschreibt die lebendige Rückkehr der Natur. Ein Regen fällt, die Wellen rauschen, und die Nymphen und Dryaden tanzen. Die Natur wird zum Leben erweckt und feiert ihre Wiedergeburt. Die Gesänge Homers und die Ankunft der Artemis unterstreichen die Rückkehr der griechischen Mythologie und Kultur. In der fünften Strophe wird die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge betont. Das Opfer wird dargebracht, aber mit dem Morgenstrahl kehrt Stille und Ruin zurück. Alles verschwindet erneut, und die Natur erlangt die Oberhand. Das Gedicht erinnert an die Flüchtigkeit des Lebens und die unaufhaltsame Kraft des Verfalls, während die Erinnerung an die Vergangenheit weiterhin bestehen bleibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.