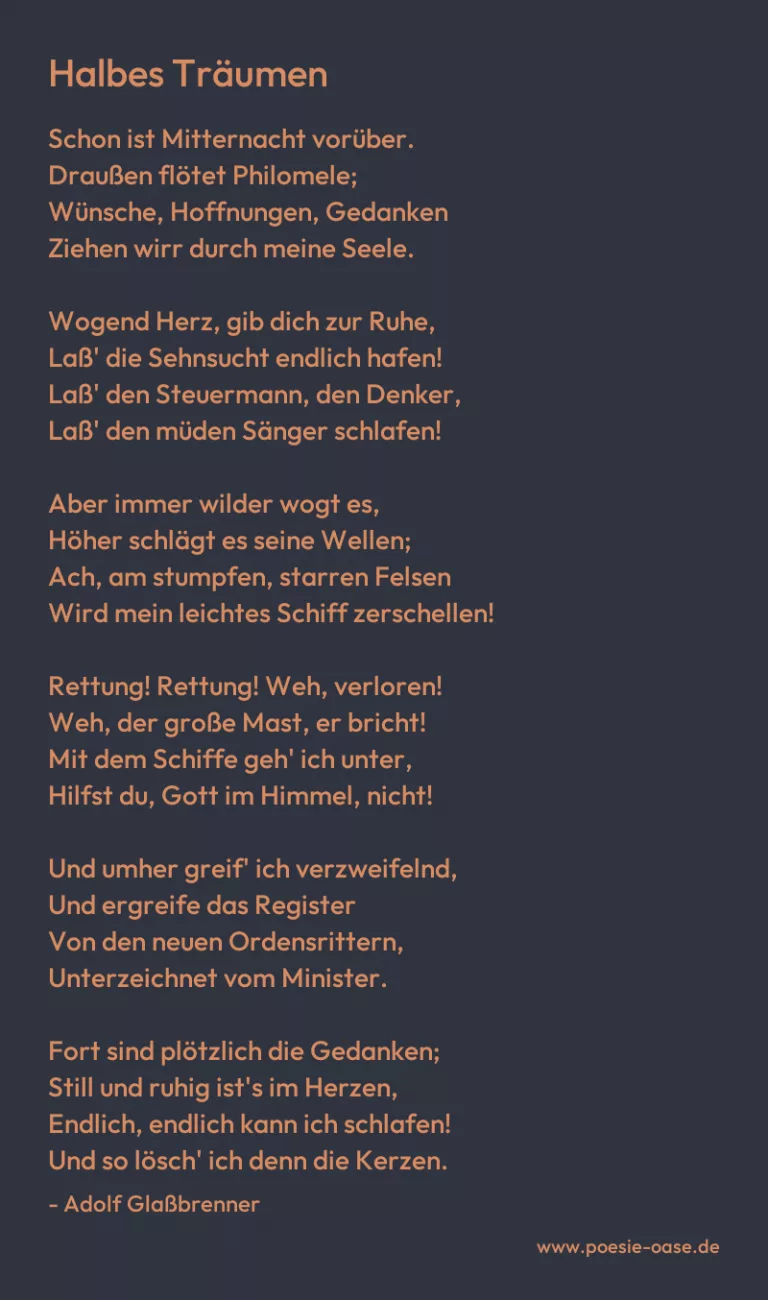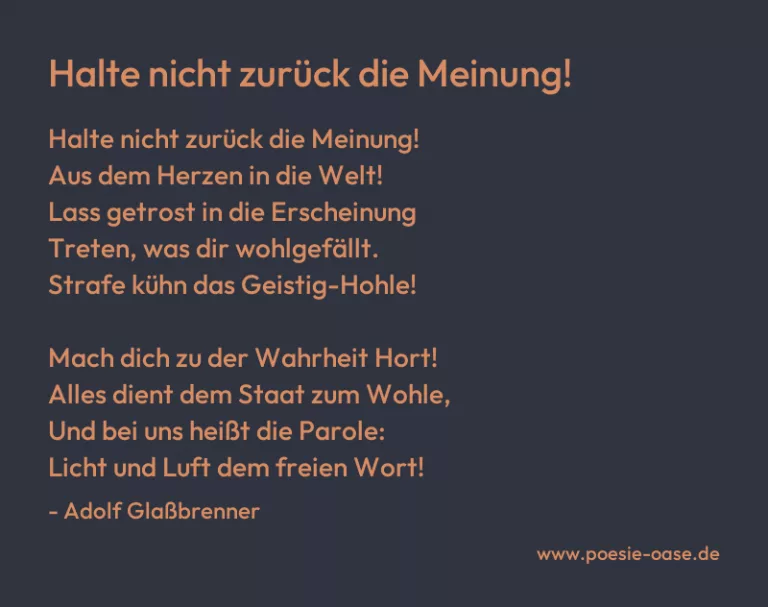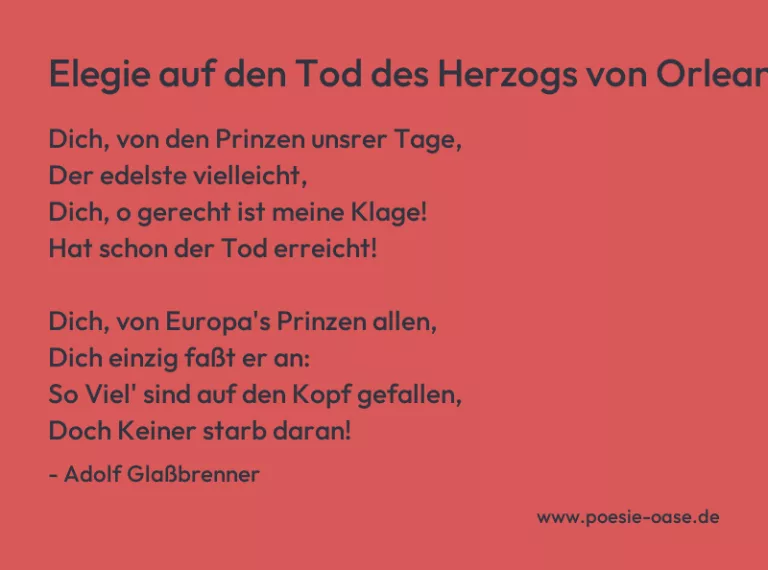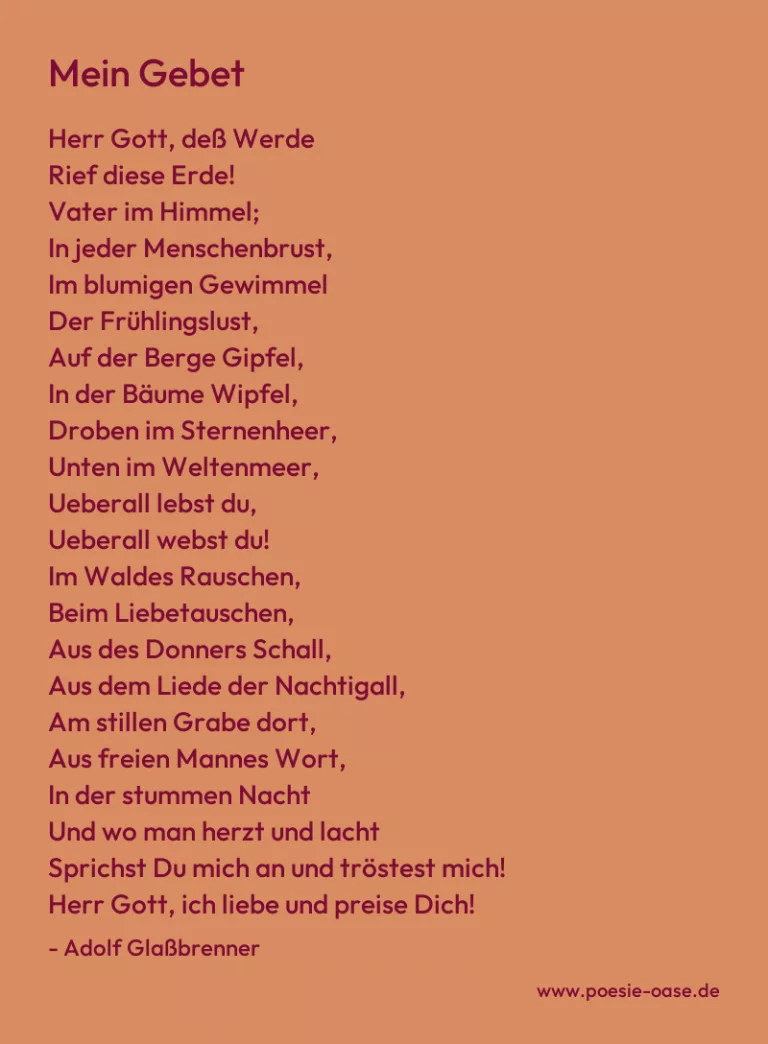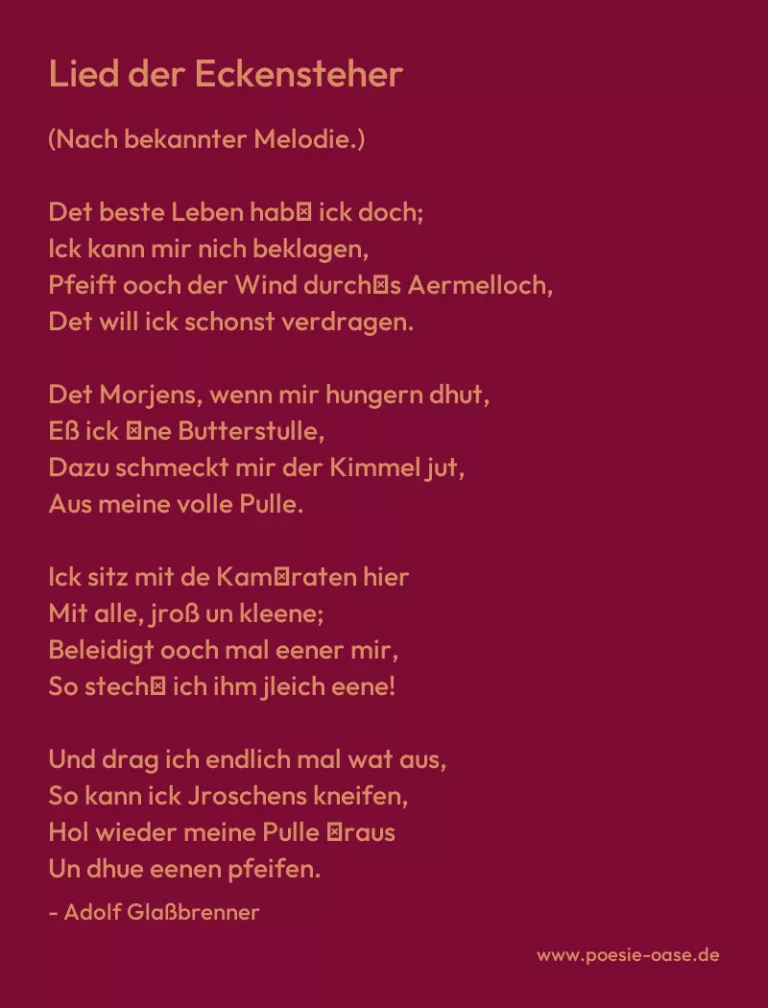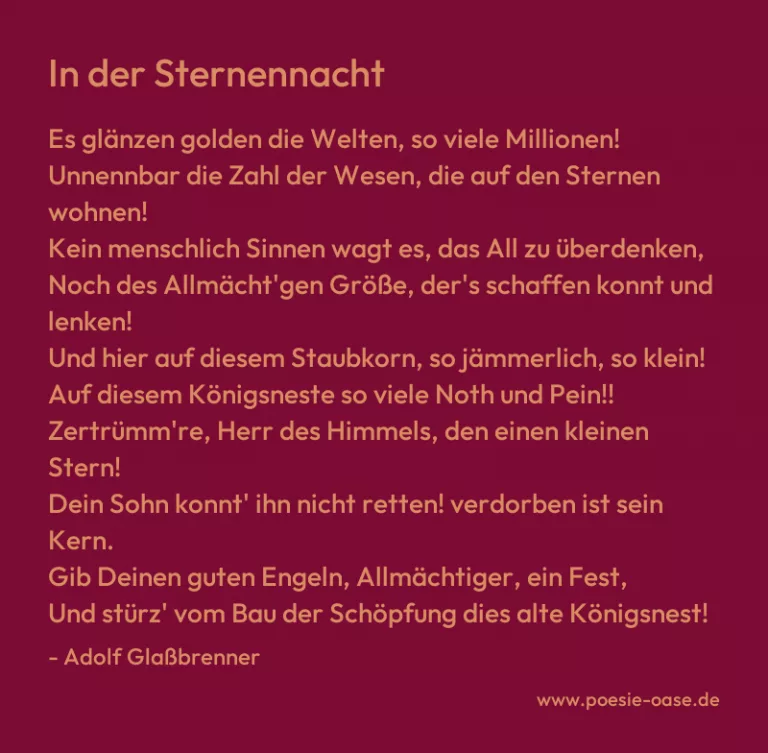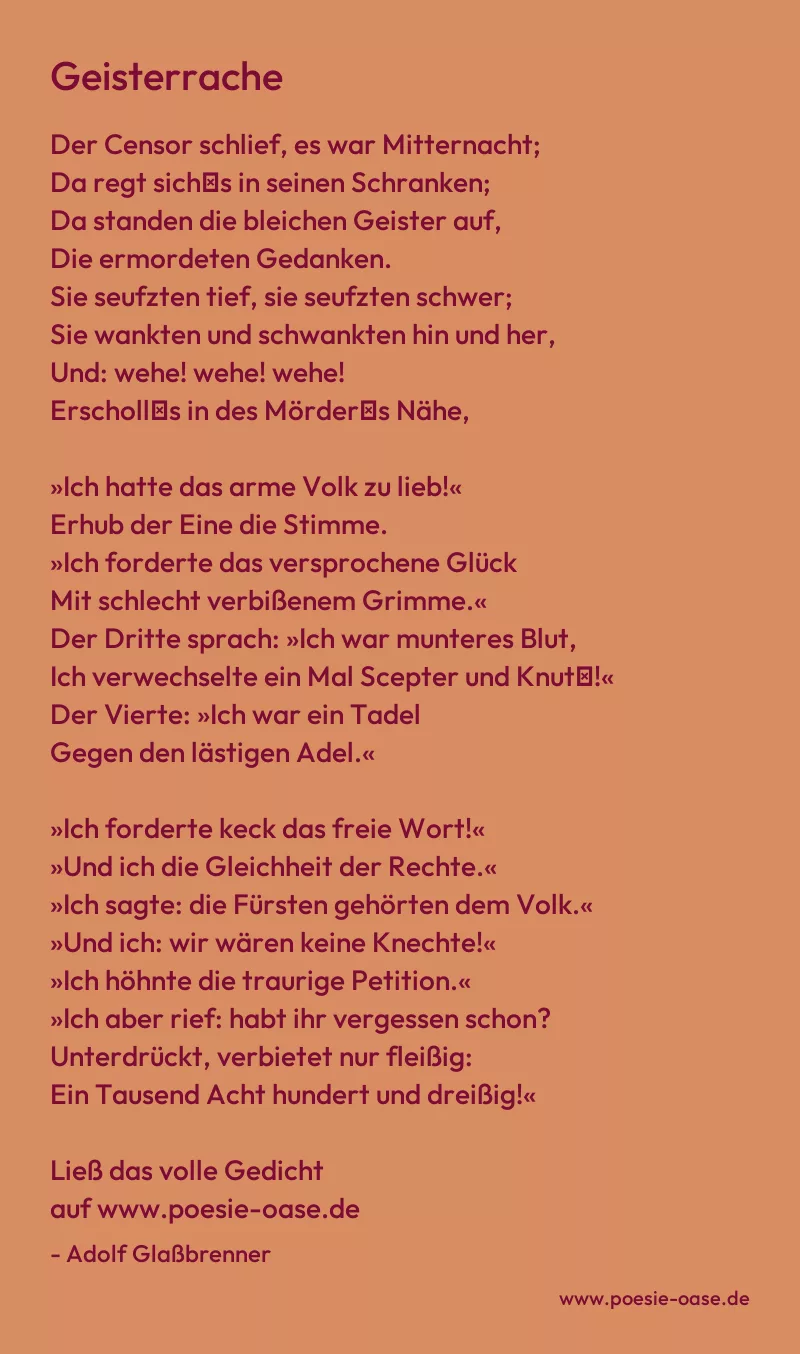Der Censor schlief, es war Mitternacht;
Da regt sich′s in seinen Schranken;
Da standen die bleichen Geister auf,
Die ermordeten Gedanken.
Sie seufzten tief, sie seufzten schwer;
Sie wankten und schwankten hin und her,
Und: wehe! wehe! wehe!
Erscholl′s in des Mörder′s Nähe,
»Ich hatte das arme Volk zu lieb!«
Erhub der Eine die Stimme.
»Ich forderte das versprochene Glück
Mit schlecht verbißenem Grimme.«
Der Dritte sprach: »Ich war munteres Blut,
Ich verwechselte ein Mal Scepter und Knut′!«
Der Vierte: »Ich war ein Tadel
Gegen den lästigen Adel.«
»Ich forderte keck das freie Wort!«
»Und ich die Gleichheit der Rechte.«
»Ich sagte: die Fürsten gehörten dem Volk.«
»Und ich: wir wären keine Knechte!«
»Ich höhnte die traurige Petition.«
»Ich aber rief: habt ihr vergessen schon?
Unterdrückt, verbietet nur fleißig:
Ein Tausend Acht hundert und dreißig!«
So sprachen sie alle in finsterm Groll,
Und schwuren Rache zum Himmel;
Drauf wirrt′s und schwirrt′s um des Schläfers Kopf,
Das böse Geister-Gewimmel.
Sie krochen durch Nase, durch Ohr und Mund;
Sie rißen am Haar ihn, sie stopften den Schlund,
Sie tobten auf seiner Stirne,
Sie schrieen in seinem Gehirne.
Früh Morgens wurde dem Censor verliehn
Ein großer, langer Orden;
Er aber sah stier auf das bunte Band,
Denn er war wahnsinnig worden. –
An jenem Schrank′, in der Nacht darauf,
Hing er mit dem Ordensbande sich auf,
Und draußen hörte der Wächter
Ein fürchterliches Gelächter.