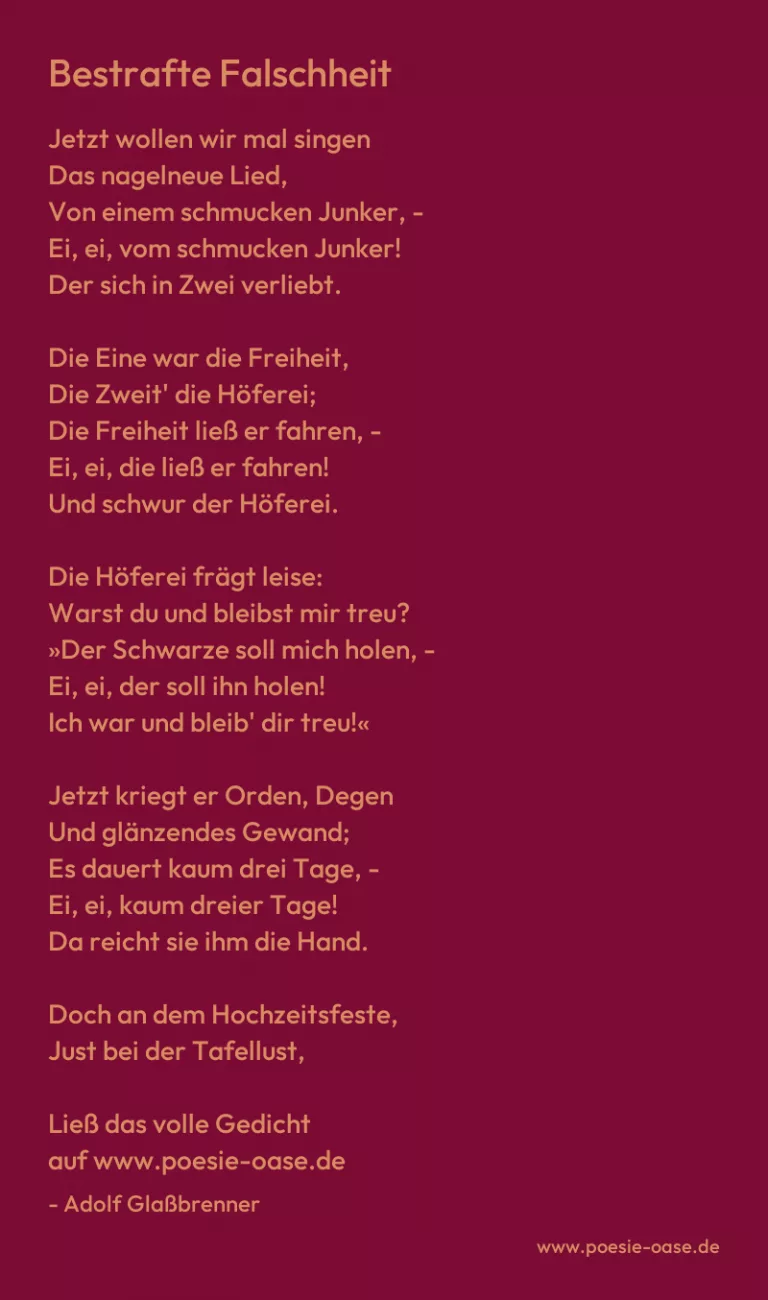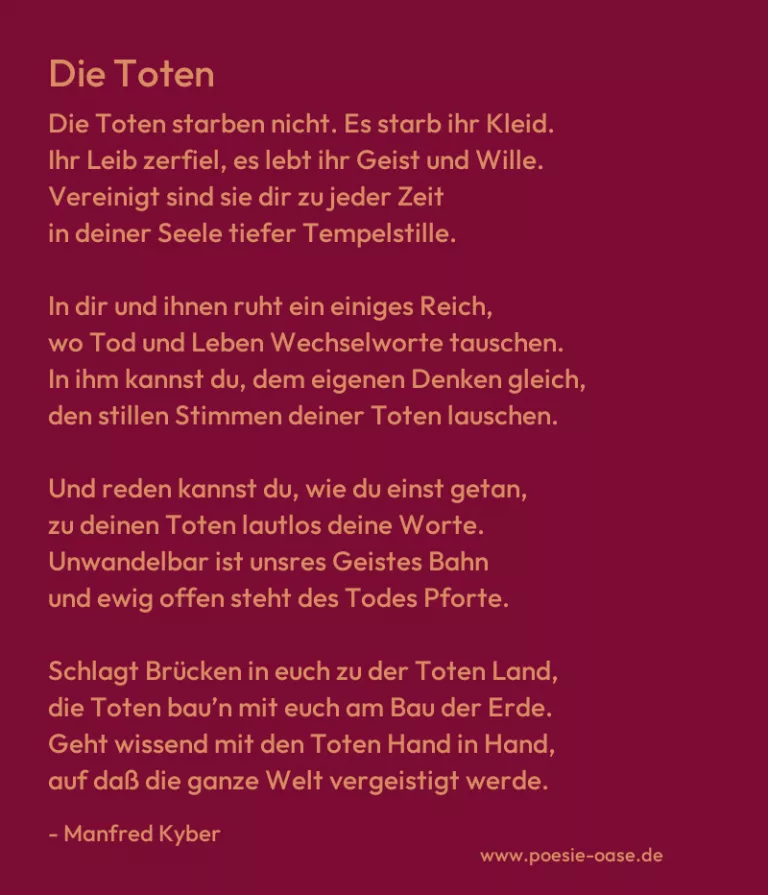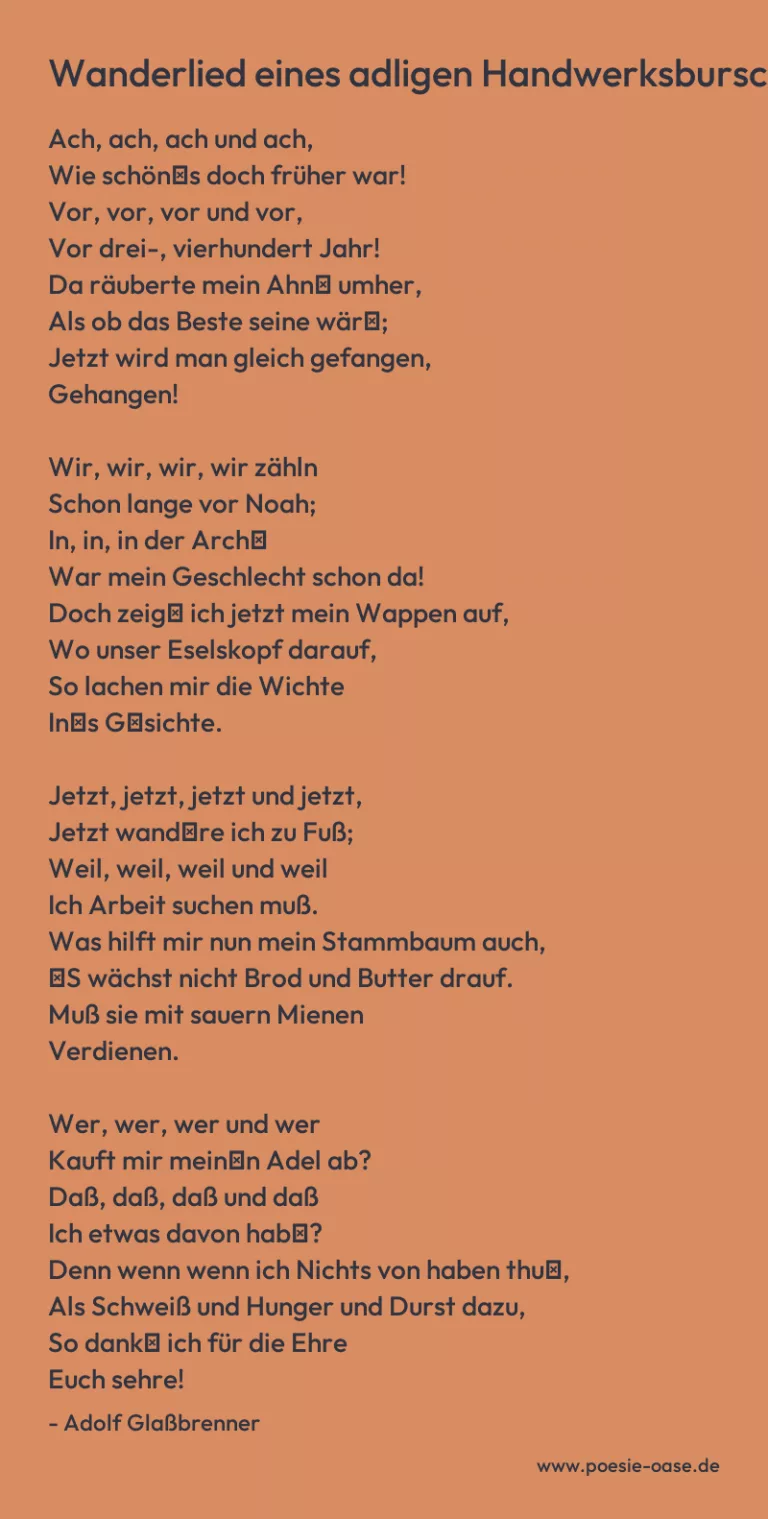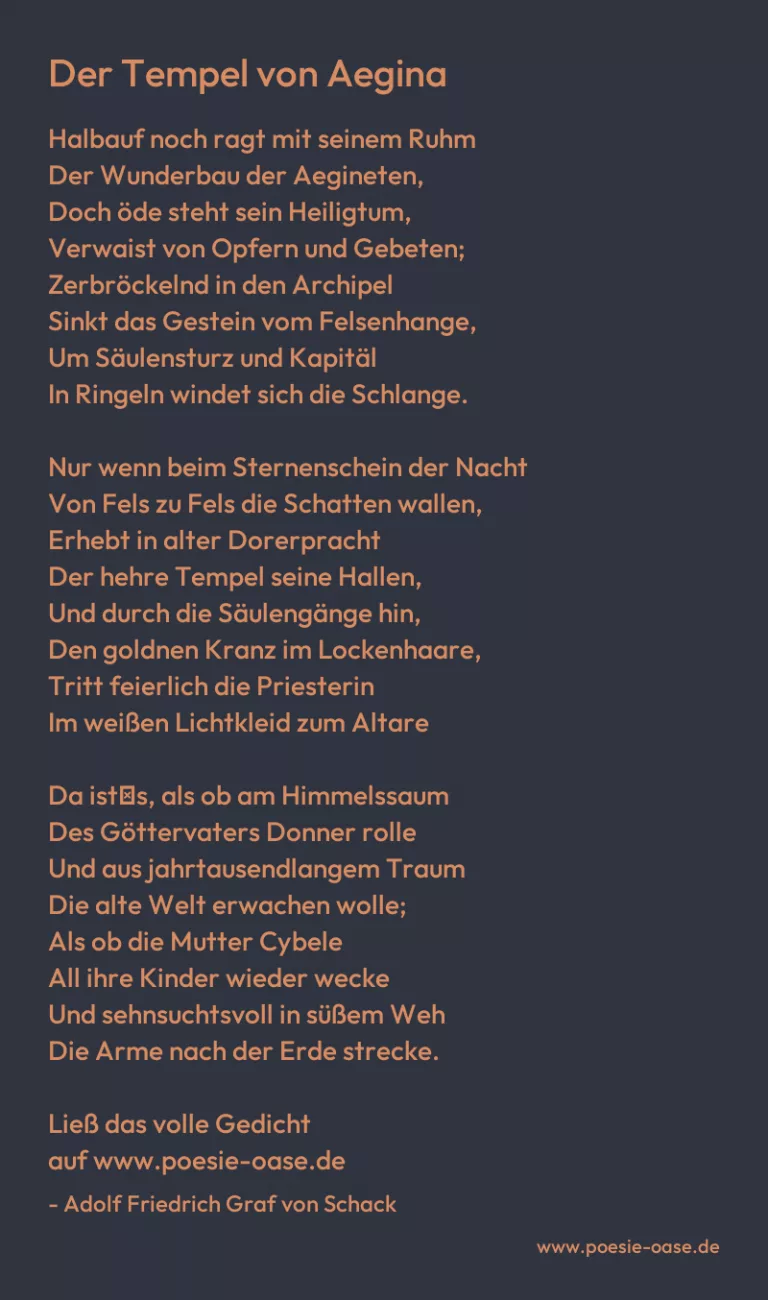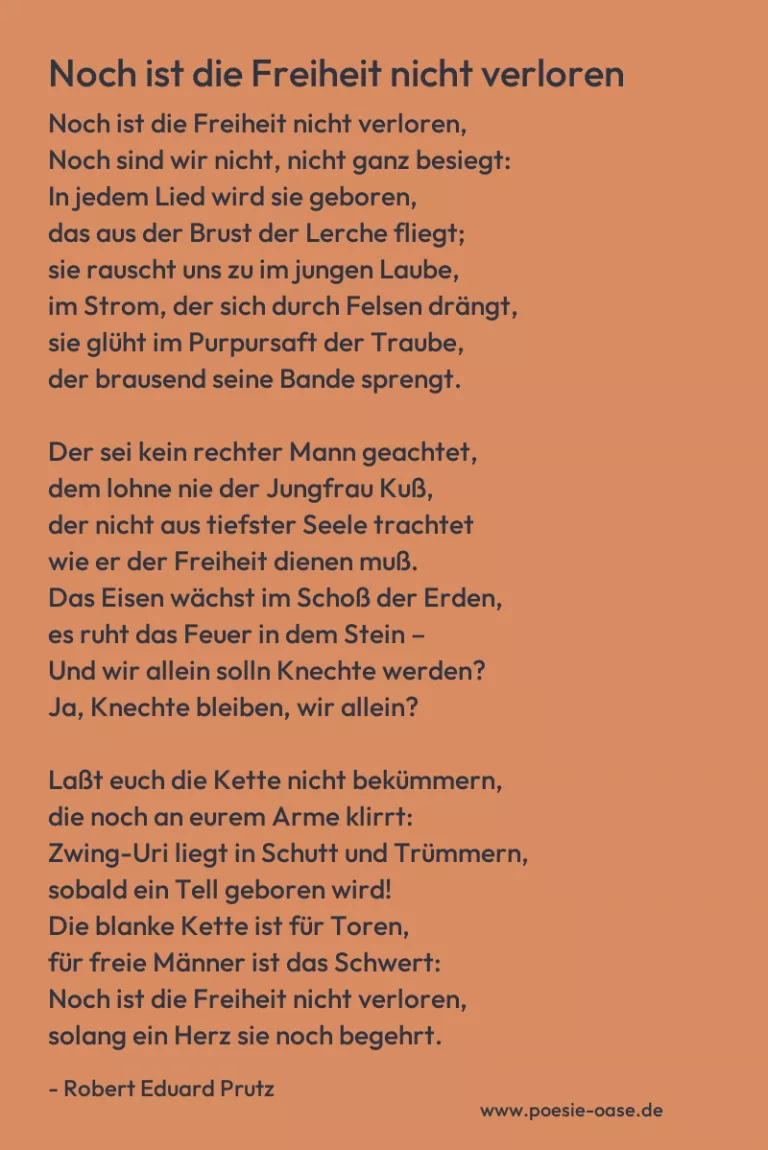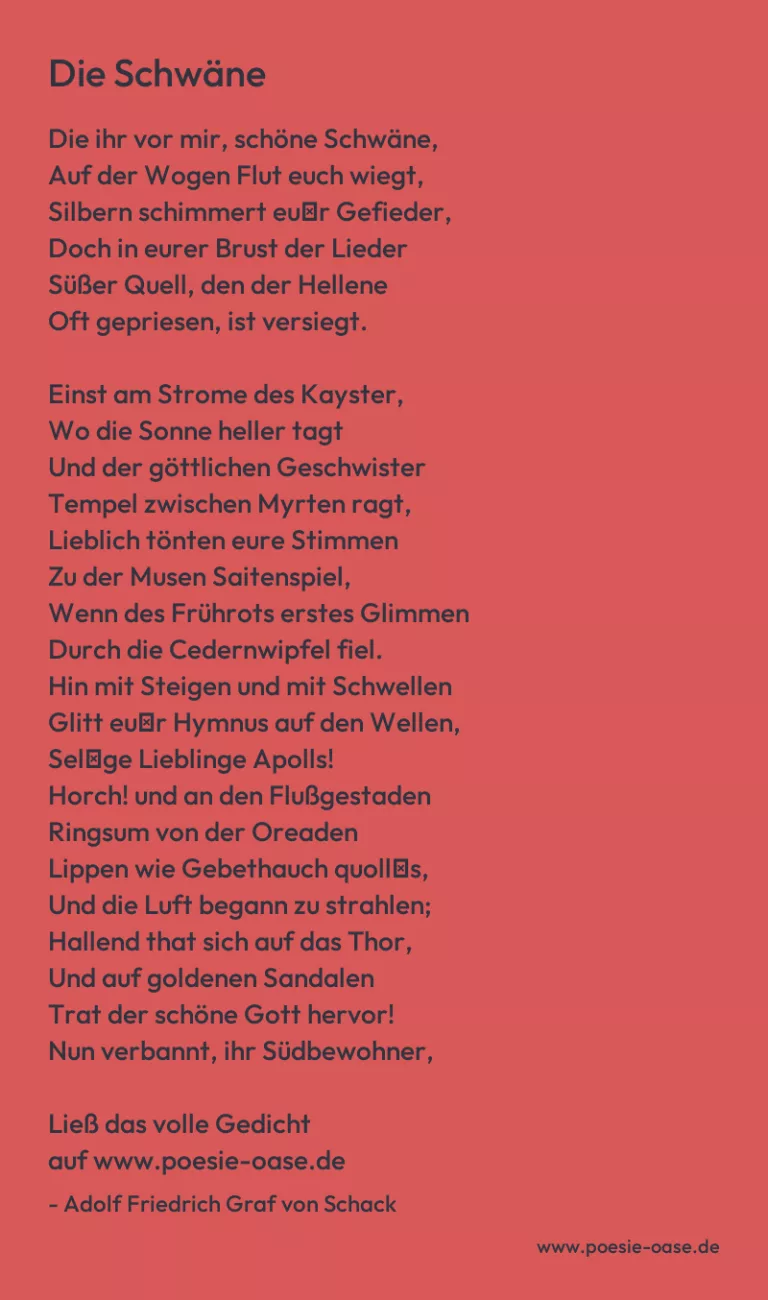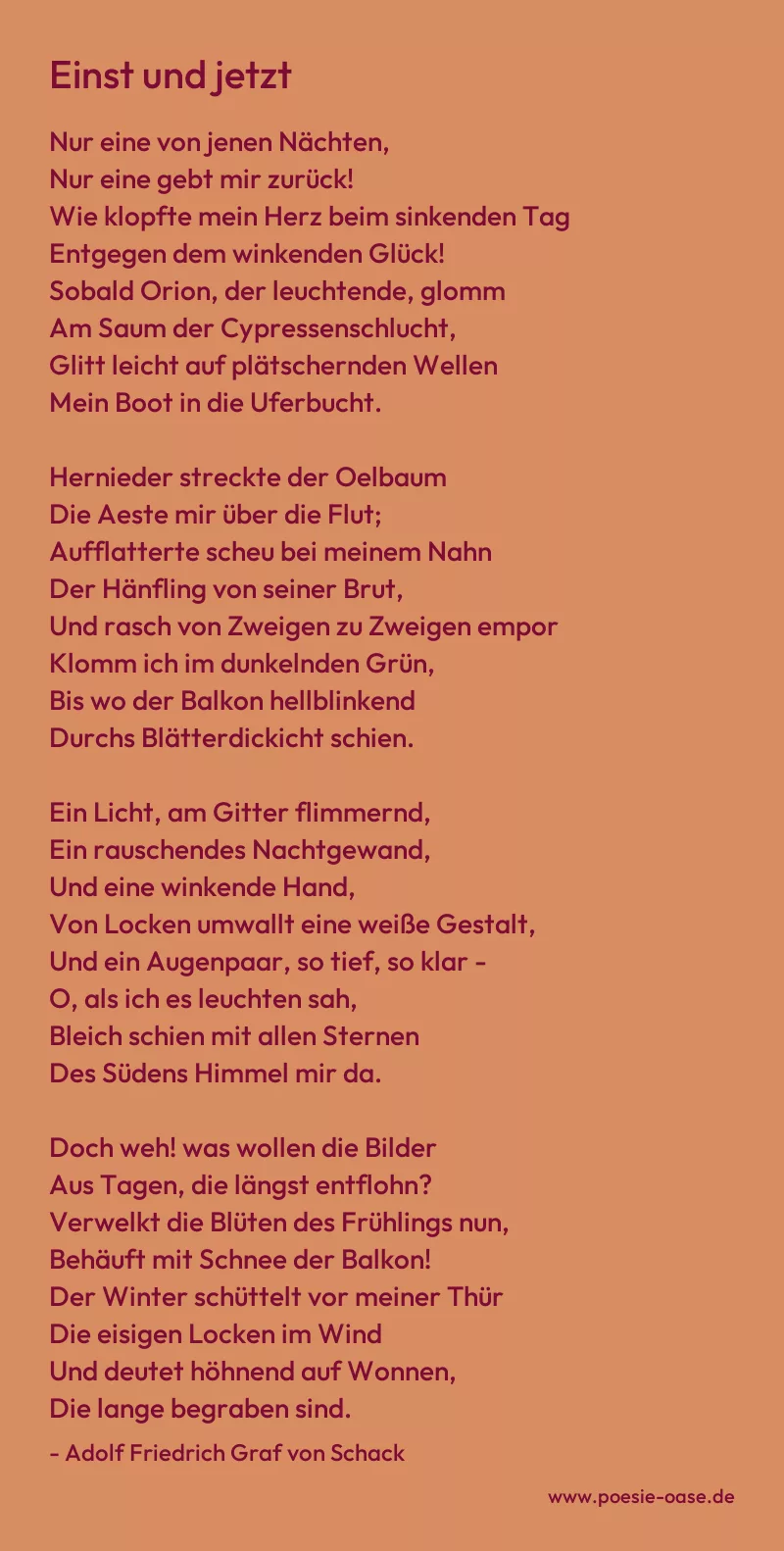Blumen & Pflanzen, Erinnerungen, Freude, Götter, Harmonie, Helden & Prinzessinnen, Herbst, Leichtigkeit, Russland, Unschuld, Winter
Einst und jetzt
Nur eine von jenen Nächten,
Nur eine gebt mir zurück!
Wie klopfte mein Herz beim sinkenden Tag
Entgegen dem winkenden Glück!
Sobald Orion, der leuchtende, glomm
Am Saum der Cypressenschlucht,
Glitt leicht auf plätschernden Wellen
Mein Boot in die Uferbucht.
Hernieder streckte der Oelbaum
Die Aeste mir über die Flut;
Aufflatterte scheu bei meinem Nahn
Der Hänfling von seiner Brut,
Und rasch von Zweigen zu Zweigen empor
Klomm ich im dunkelnden Grün,
Bis wo der Balkon hellblinkend
Durchs Blätterdickicht schien.
Ein Licht, am Gitter flimmernd,
Ein rauschendes Nachtgewand,
Und eine winkende Hand,
Von Locken umwallt eine weiße Gestalt,
Und ein Augenpaar, so tief, so klar –
O, als ich es leuchten sah,
Bleich schien mit allen Sternen
Des Südens Himmel mir da.
Doch weh! was wollen die Bilder
Aus Tagen, die längst entflohn?
Verwelkt die Blüten des Frühlings nun,
Behäuft mit Schnee der Balkon!
Der Winter schüttelt vor meiner Thür
Die eisigen Locken im Wind
Und deutet höhnend auf Wonnen,
Die lange begraben sind.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
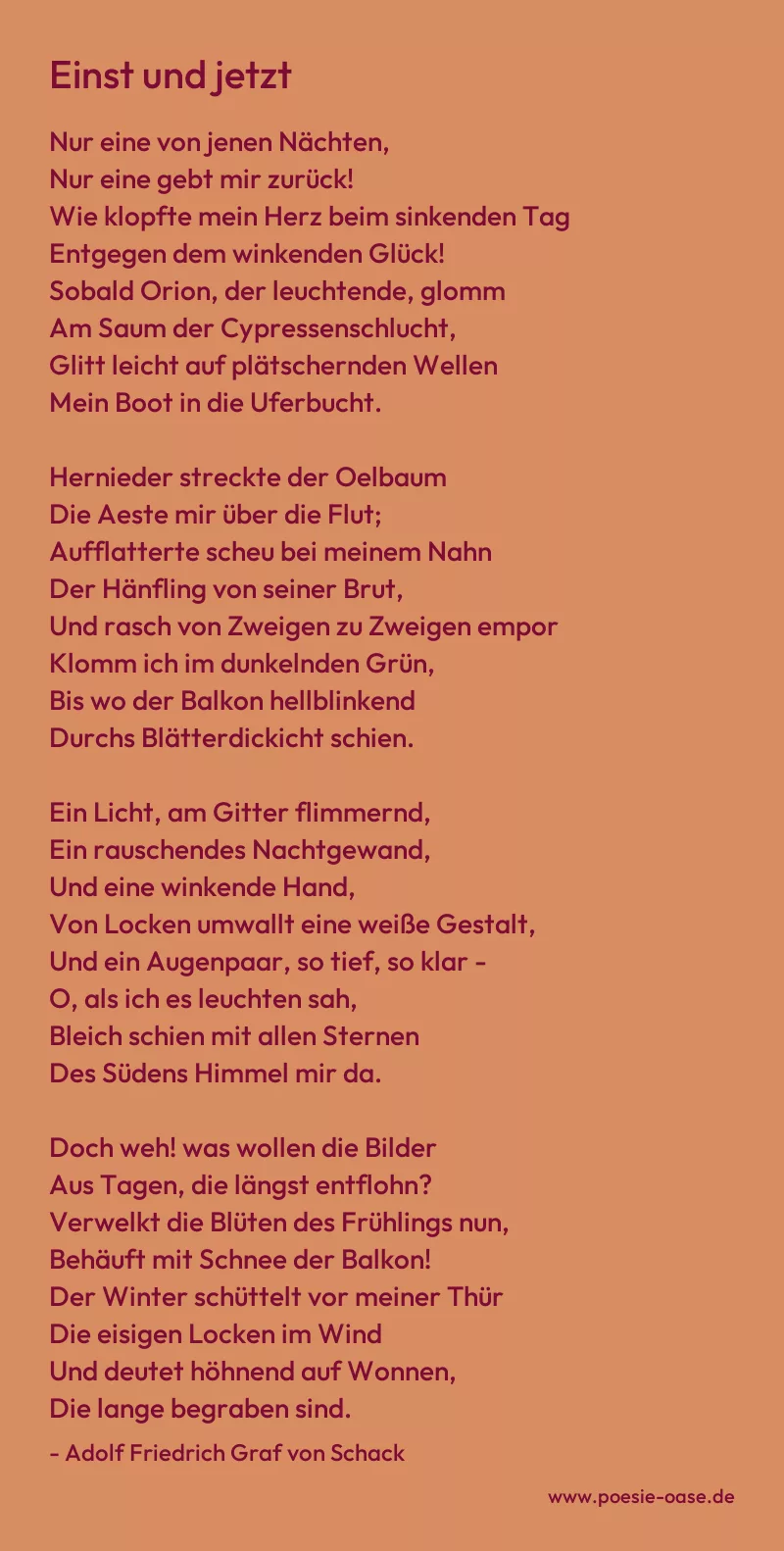
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Einst und jetzt“ von Adolf Friedrich Graf von Schack ist eine melancholische Reflexion über die Vergänglichkeit der Jugend, der Liebe und des Glücks. Es beschreibt eine Szene romantischer Verliebtheit, die in der Vergangenheit liegt, und kontrastiert diese mit der trostlosen Gegenwart des Erzählers. Das Gedicht ist in drei Abschnitte gegliedert, die durch die Zeit getrennt sind: die Erinnerung an die Vergangenheit, die Beschreibung der Szene der Liebe und schließlich der jähe Kontrast zur gegenwärtigen Realität.
Der erste Teil des Gedichts, der aus den ersten beiden Strophen besteht, entführt den Leser in die glückliche Vergangenheit des Erzählers. Der Dichter beschreibt die Sehnsucht und Erwartung, die er in einer bestimmten Nacht empfand, als er sich auf dem Weg zu seiner Geliebten machte. Die Natur, die Elemente wie Orion, die Cypressenschlucht, das Boot und der Ölbaum, werden als stimmungsvolle Kulisse für die verliebte Fahrt dargestellt. Die flüchtige Begegnung mit der Natur, wie dem flüchtenden Hänfling, verstärkt das Gefühl von Lebendigkeit und Unmittelbarkeit der Szene. Das Bild des Ankommens am Balkon der Geliebten wird durch das dichte Grün des Blätterdicksichts angedeutet, was die Spannung und das Geheimnis der bevorstehenden Begegnung erhöht.
Die zweite Hälfte des Gedichts ist der Höhepunkt der Erinnerung an die Liebesbegegnung gewidmet. Der Erzähler beschreibt die Sehnsucht und die Erwartung, die er in dieser Nacht empfand. Das Licht, das durch das Gitter flimmerte, die rauschhaften Geräusche, die winkende Hand und die weiße Gestalt der Geliebten, werden mit großer Detailgenauigkeit geschildert. Das zentrale Bild sind die Augen der Geliebten, die so tief und klar sind, dass sie die Schönheit des Südhimmels mit seinen Sternen in den Schatten stellen. Hier kulminiert die romantische Verklärung der Liebe, die jedoch durch das abschließende „Doch weh!“ einen jähen Bruch erfährt.
Im letzten Teil des Gedichts wird die Vergänglichkeit der Jugend und der Liebe besonders deutlich. Der Erzähler wird aus der Nostalgie der Erinnerung in die kalte Realität zurückgeholt. Der Frühling mit seinen Blüten ist verwelkt, der Balkon mit Schnee bedeckt. Der Winter, ein Symbol für Alter und Tod, klopft an die Tür und verspottet die vergangenen Freuden. Das Gedicht endet mit einer bitteren Erkenntnis: Die Glückseligkeit der Vergangenheit ist unwiederbringlich verloren, und die Gegenwart ist von Einsamkeit und Leere geprägt. Die einstigen Wonnen sind nun längst begraben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.