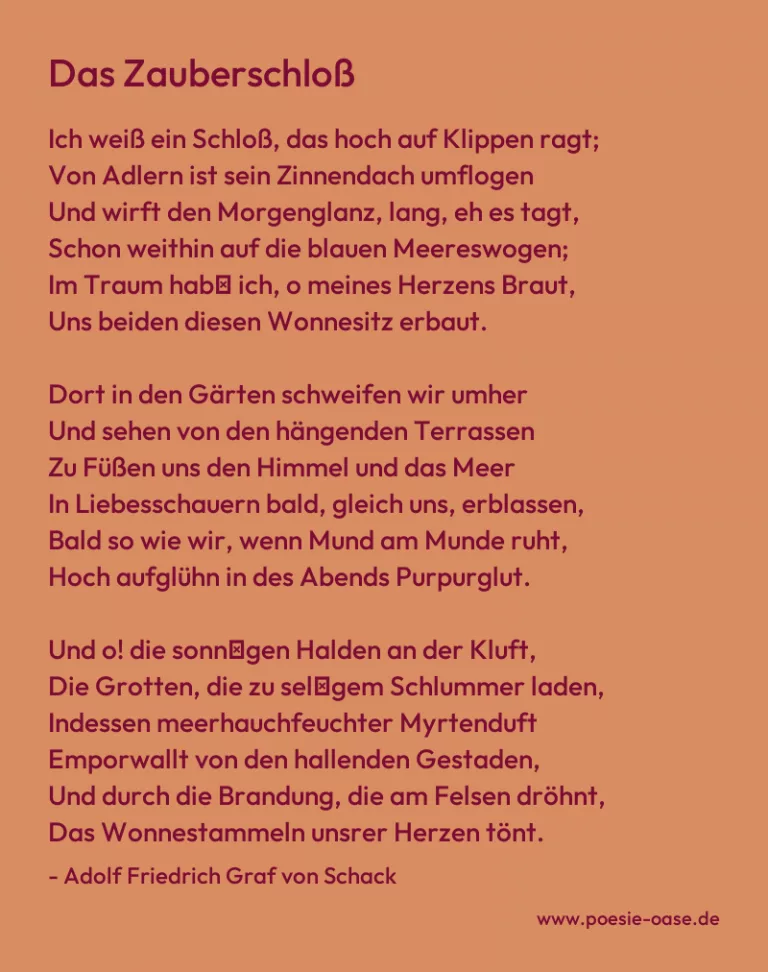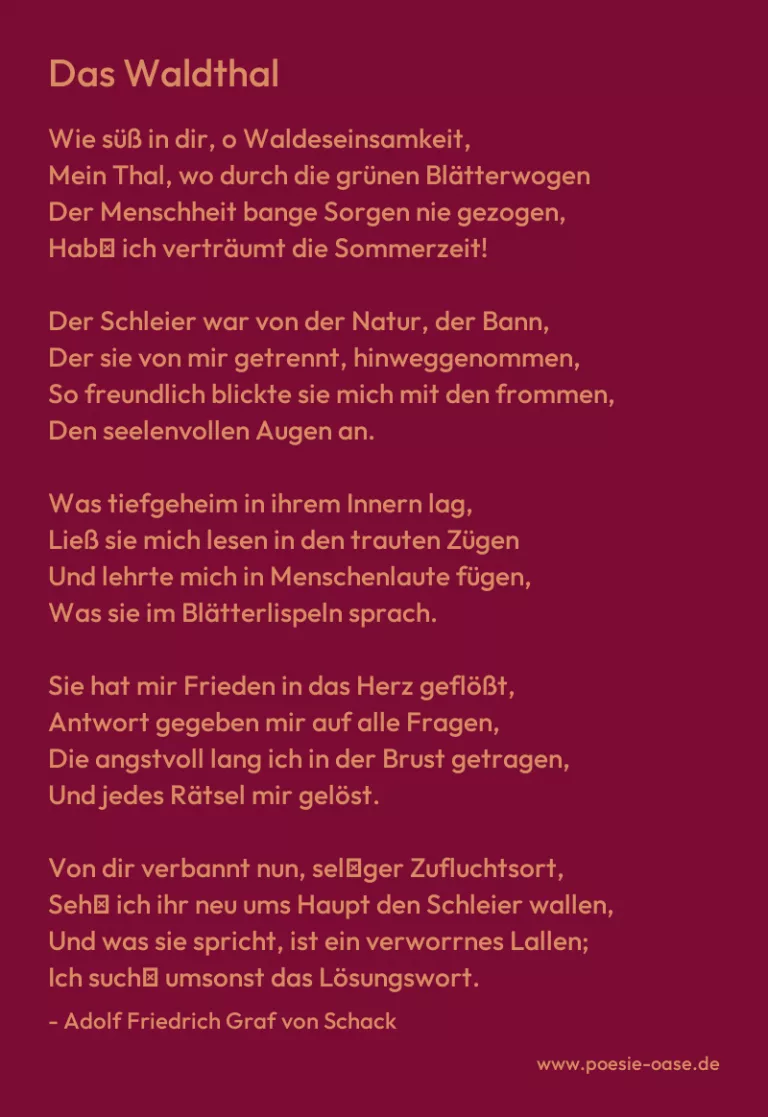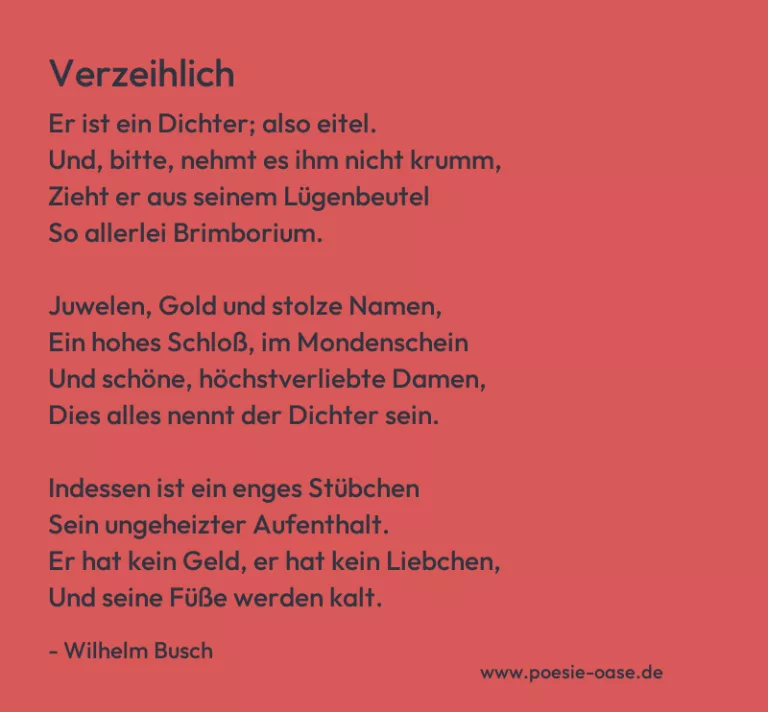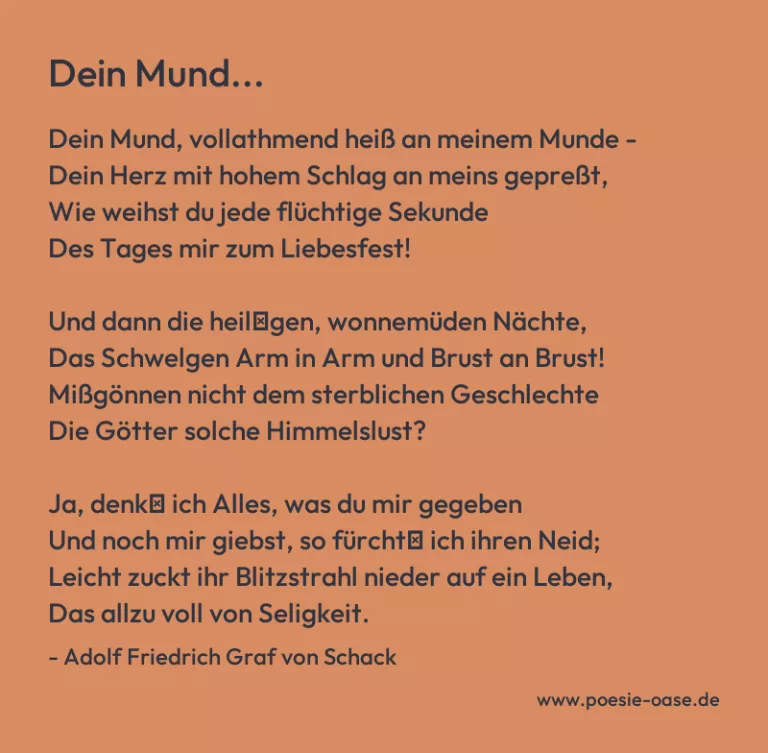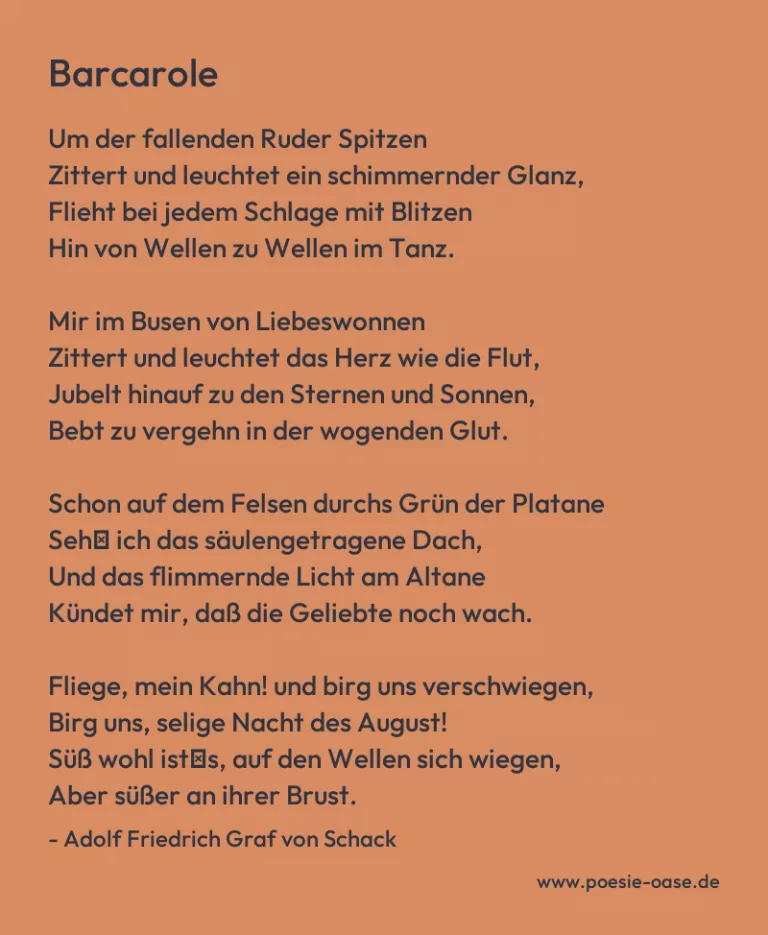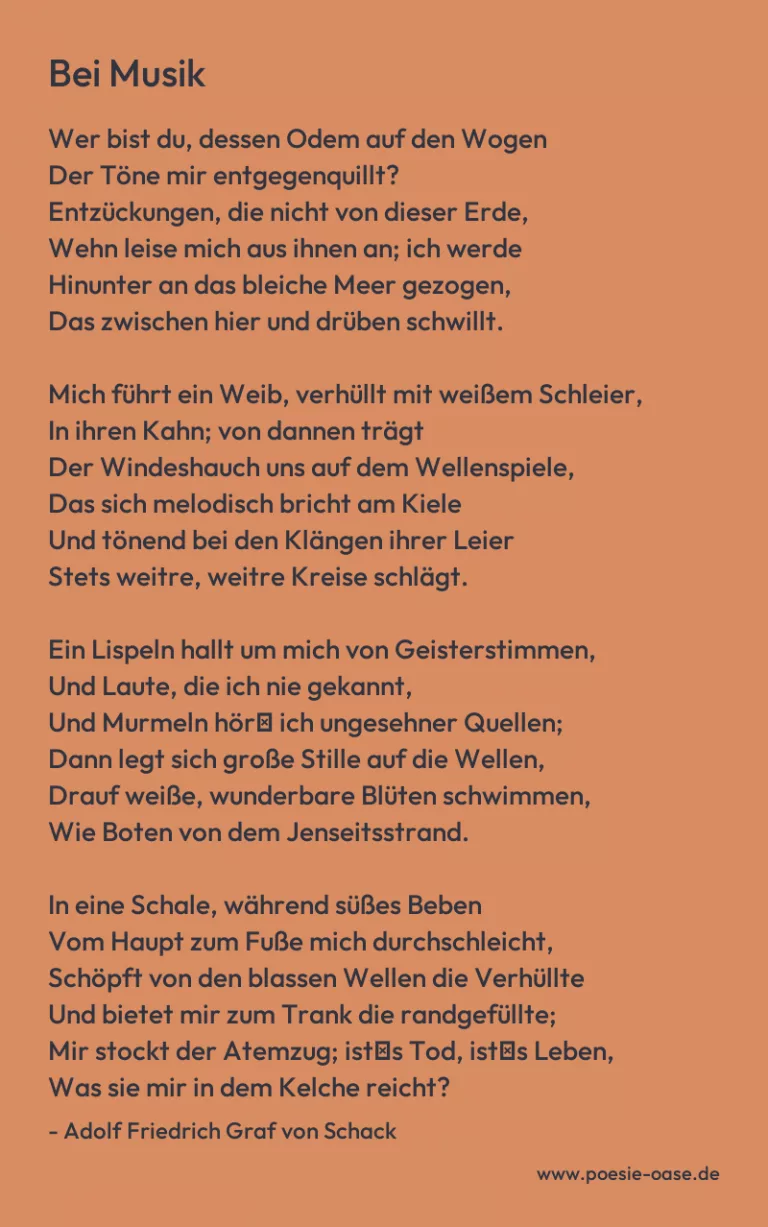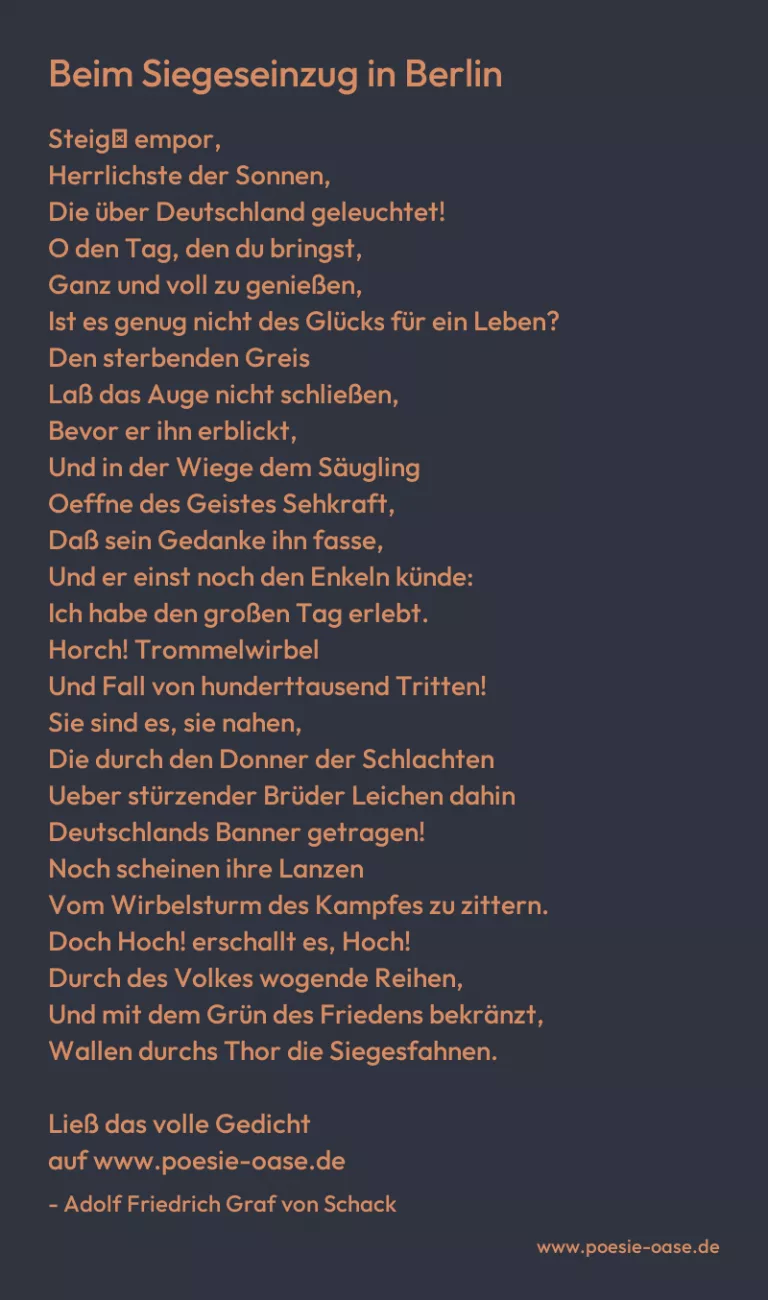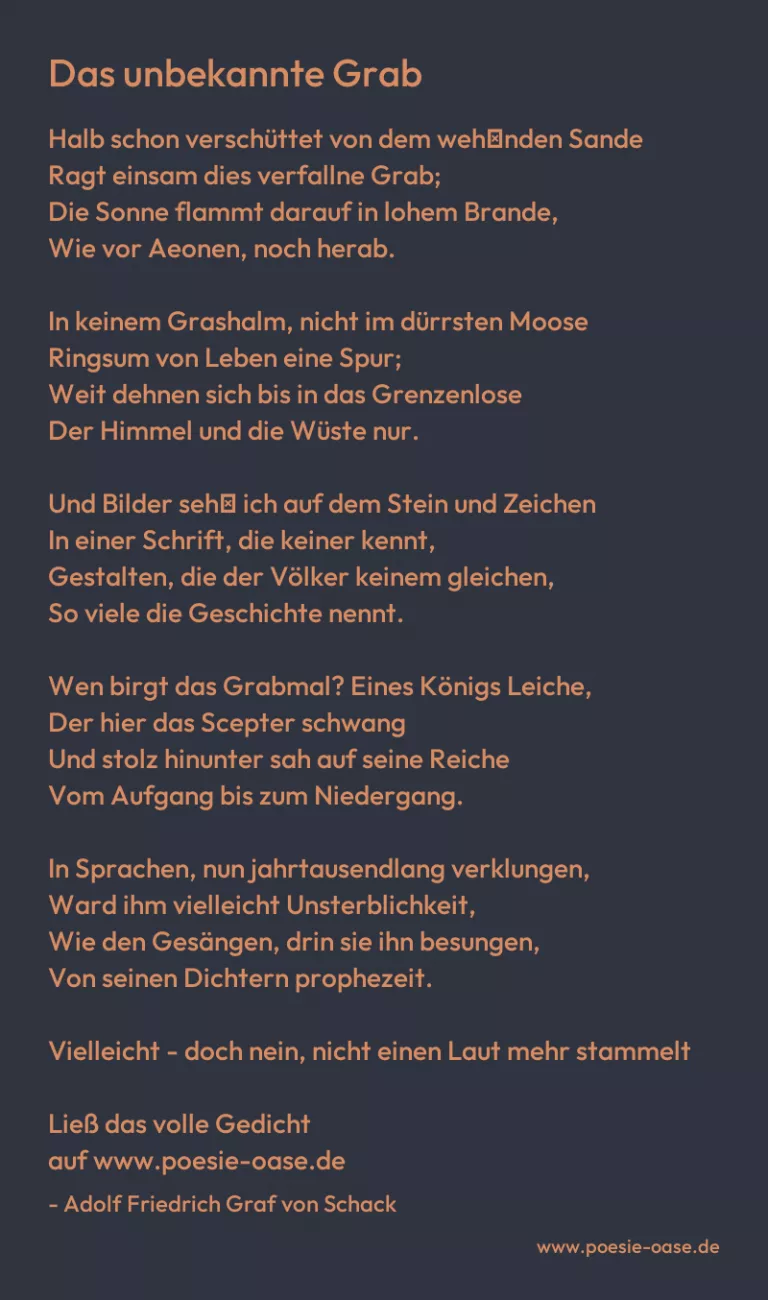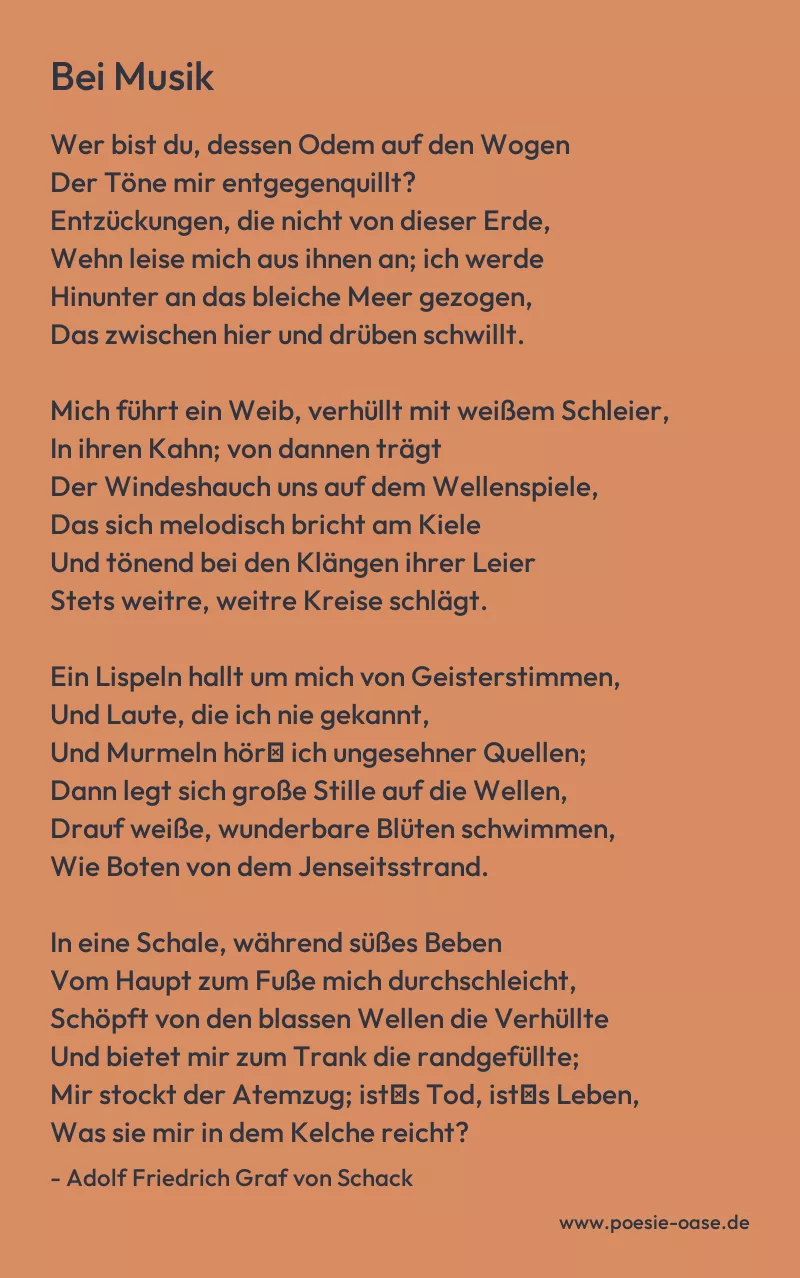Bei Musik
Wer bist du, dessen Odem auf den Wogen
Der Töne mir entgegenquillt?
Entzückungen, die nicht von dieser Erde,
Wehn leise mich aus ihnen an; ich werde
Hinunter an das bleiche Meer gezogen,
Das zwischen hier und drüben schwillt.
Mich führt ein Weib, verhüllt mit weißem Schleier,
In ihren Kahn; von dannen trägt
Der Windeshauch uns auf dem Wellenspiele,
Das sich melodisch bricht am Kiele
Und tönend bei den Klängen ihrer Leier
Stets weitre, weitre Kreise schlägt.
Ein Lispeln hallt um mich von Geisterstimmen,
Und Laute, die ich nie gekannt,
Und Murmeln hör′ ich ungesehner Quellen;
Dann legt sich große Stille auf die Wellen,
Drauf weiße, wunderbare Blüten schwimmen,
Wie Boten von dem Jenseitsstrand.
In eine Schale, während süßes Beben
Vom Haupt zum Fuße mich durchschleicht,
Schöpft von den blassen Wellen die Verhüllte
Und bietet mir zum Trank die randgefüllte;
Mir stockt der Atemzug; ist′s Tod, ist′s Leben,
Was sie mir in dem Kelche reicht?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
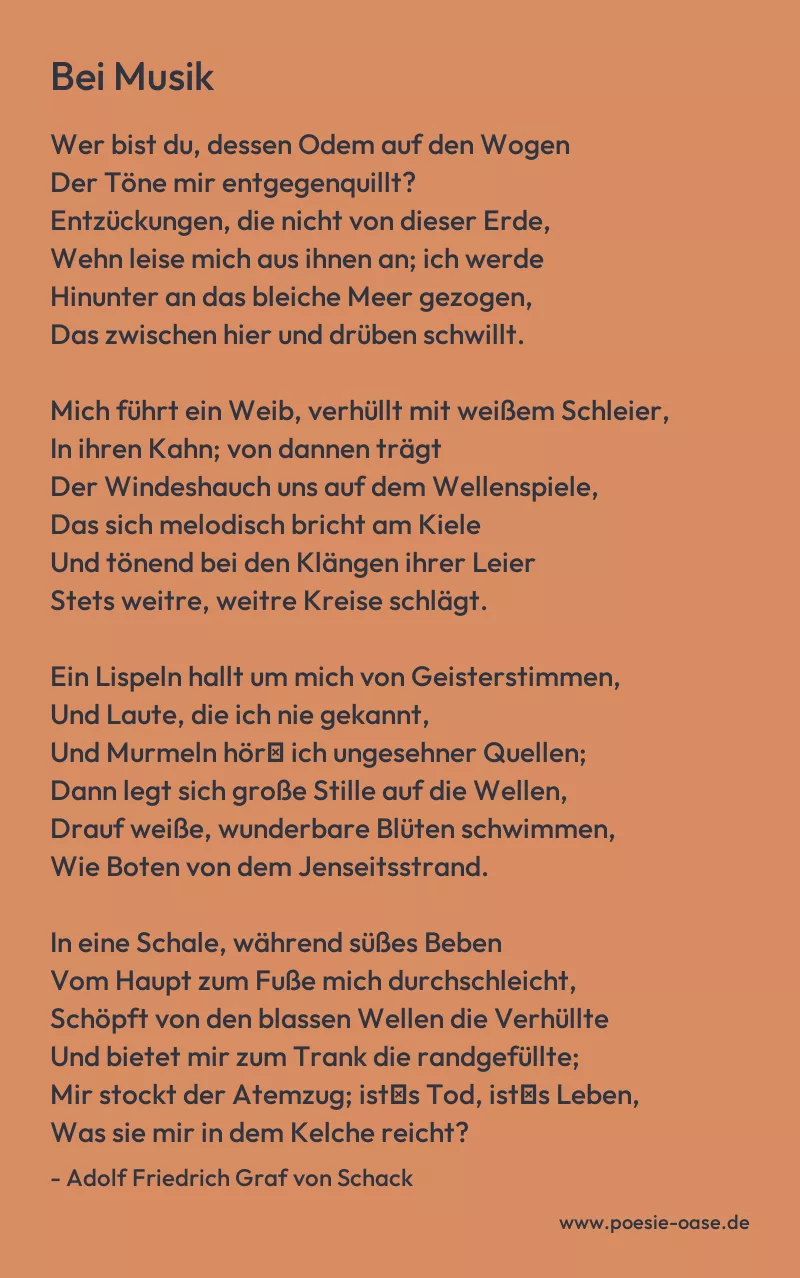
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bei Musik“ von Adolf Friedrich Graf von Schack entfaltet eine mystische Szenerie, in der Musik als Brücke zwischen der irdischen und einer jenseitigen Welt fungiert. Der Sprecher wird von den Klängen einer unbekannten Quelle, dem „Odem“ der Musik, in eine Traumlandschaft entführt. Diese beginnt mit einem Gefühl der Entrückung, einem sanften Davonschweben, und endet mit der Konfrontation mit einer Frau, die als Mittlerin zwischen den Welten fungiert. Die Atmosphäre ist von Anfang bis Ende von einem Gefühl des Geheimnisvollen und der Sehnsucht geprägt.
Der zweite Teil des Gedichts intensiviert die surreale Erfahrung. Eine Frau, verhüllt mit einem weißen Schleier, nimmt den Sprecher in einem Kahn mit auf eine Reise über ein „bleiches Meer“. Die Musik der Leier, das Wellenspiel und der Wind bilden eine harmonische Einheit, die den Sprecher tiefer in die Sphäre der Träume und Visionen eintauchen lässt. Die Beschreibung des Wellenspiels, das „sich melodisch bricht“, und die „weitre, weitre Kreise“ der Klänge, die sich ausbreiten, verstärken das Gefühl der Ausdehnung und des Loslassens von der Realität.
Der dritte Abschnitt steigert die mystische Atmosphäre weiter. Geisterstimmen flüstern, unbekannte Laute erklingen, und das Murmeln unsichtbarer Quellen erzeugt ein Gefühl der Transzendenz. Das Bild der weißen Blüten, die auf den Wellen treiben, verstärkt die Assoziation mit dem Jenseits. Diese Blüten könnten als Boten einer anderen Welt interpretiert werden, die dem Sprecher eine Botschaft oder Einladung aus dem Reich der Toten zukommen lassen. Die Stille, die sich über die Wellen legt, vor dem Erscheinen der Blüten, deutet auf einen Moment der Andacht und der Vorbereitung auf das Unbekannte hin.
Das Gedicht kulminiert in der Frage nach Leben und Tod. Die Frau reicht dem Sprecher eine Schale mit einem Getränk aus den „blassen Wellen“. Der Sprecher ist von einem „süßen Beben“ erfasst, was die Verunsicherung und das Unbehagen in diesem Moment widerspiegelt. Das Angebot des Getränks wirft die zentrale Frage des Gedichts auf: Ist dies der Übergang in den Tod oder ein neues, transzendentes Leben? Die Ungewissheit, die in der Frage nach dem Inhalt des Kelches zum Ausdruck kommt, unterstreicht das zentrale Thema des Gedichts – die Verflechtung von Musik, Traum und der Ahnung einer anderen Existenz. Die Antwort bleibt offen, und überlässt dem Leser die Interpretation.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.