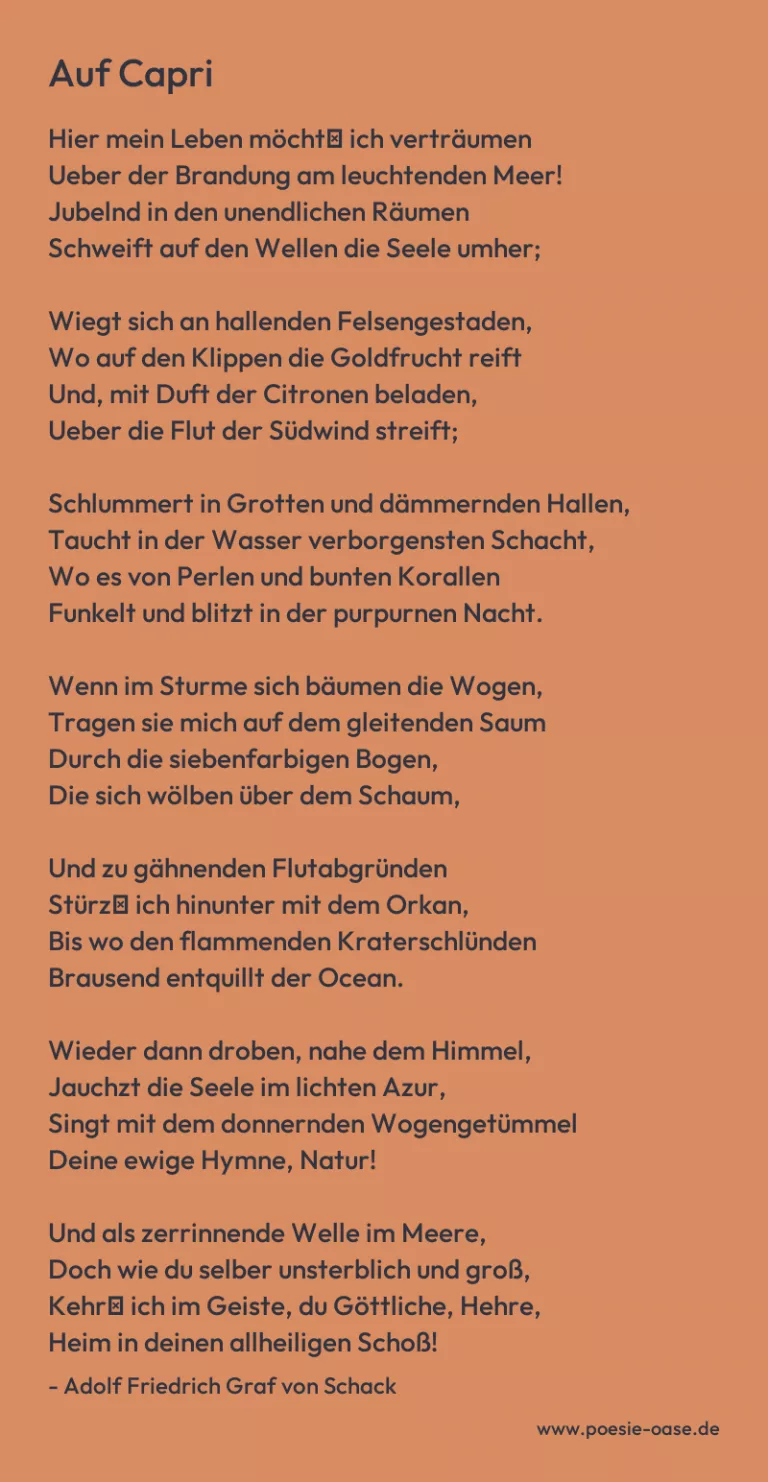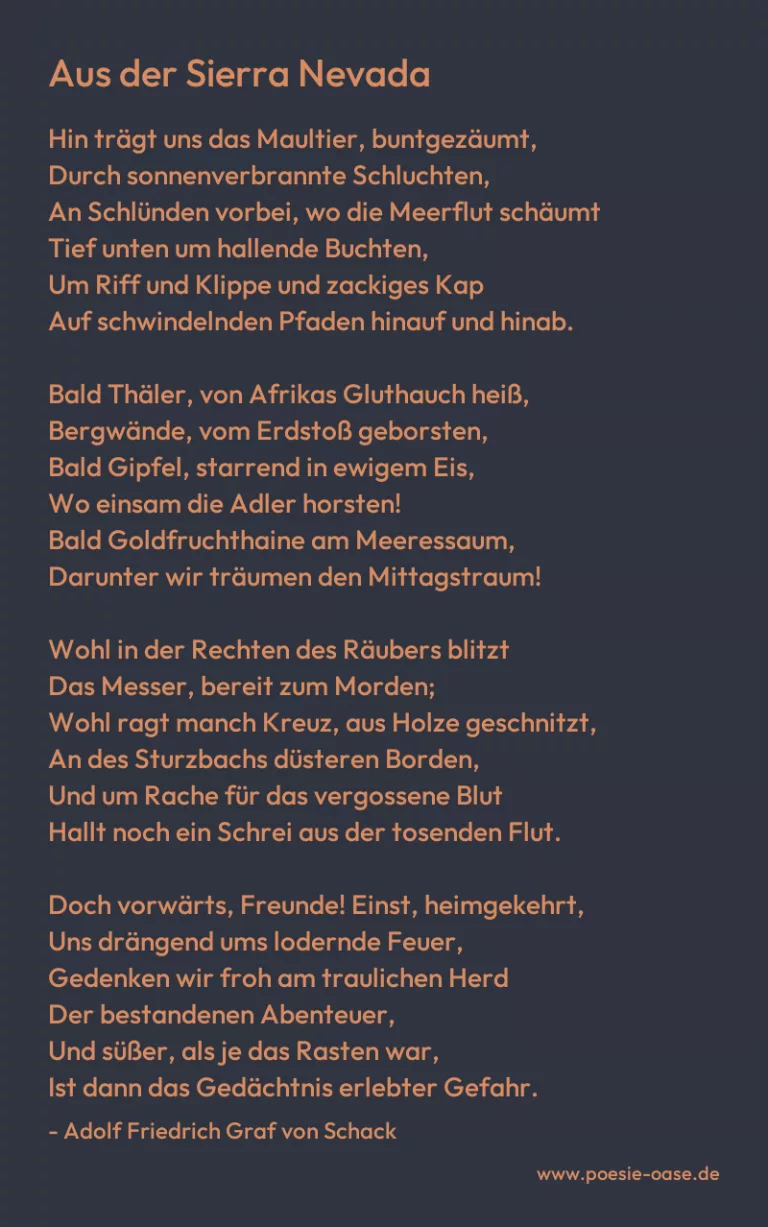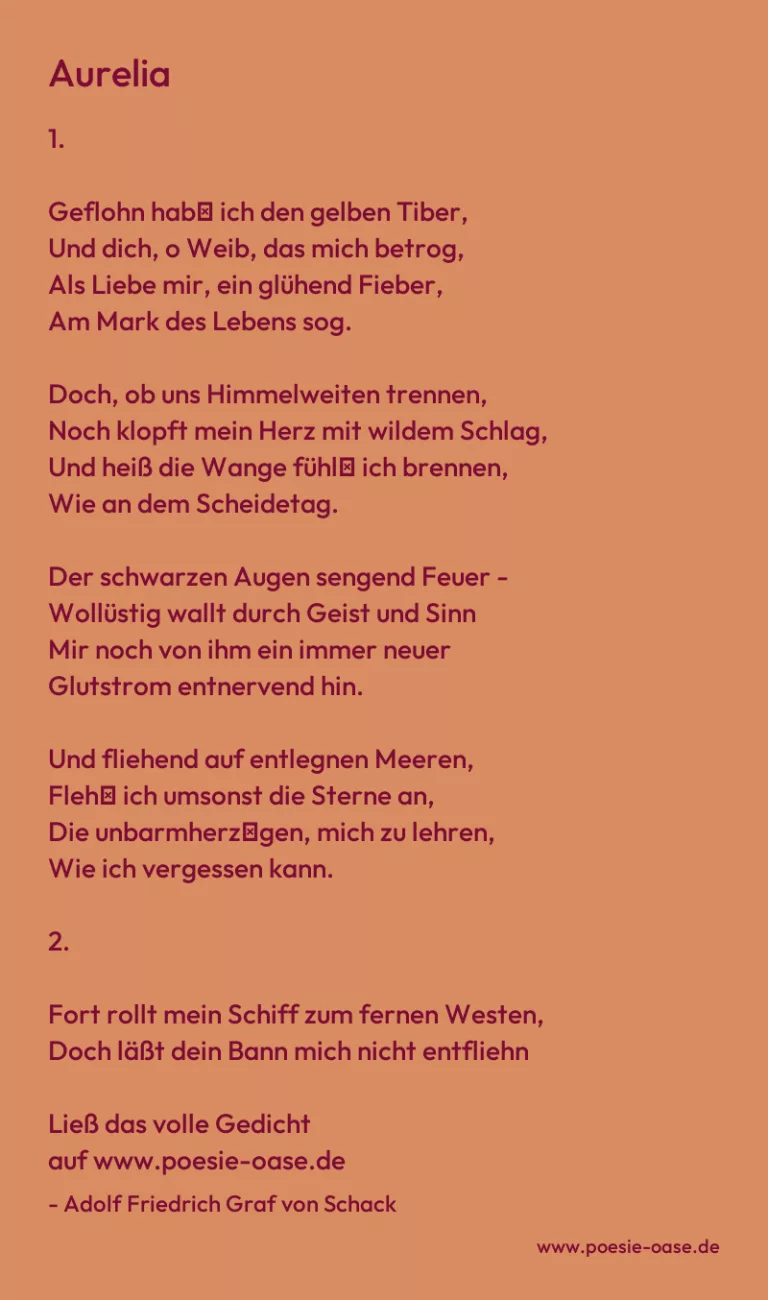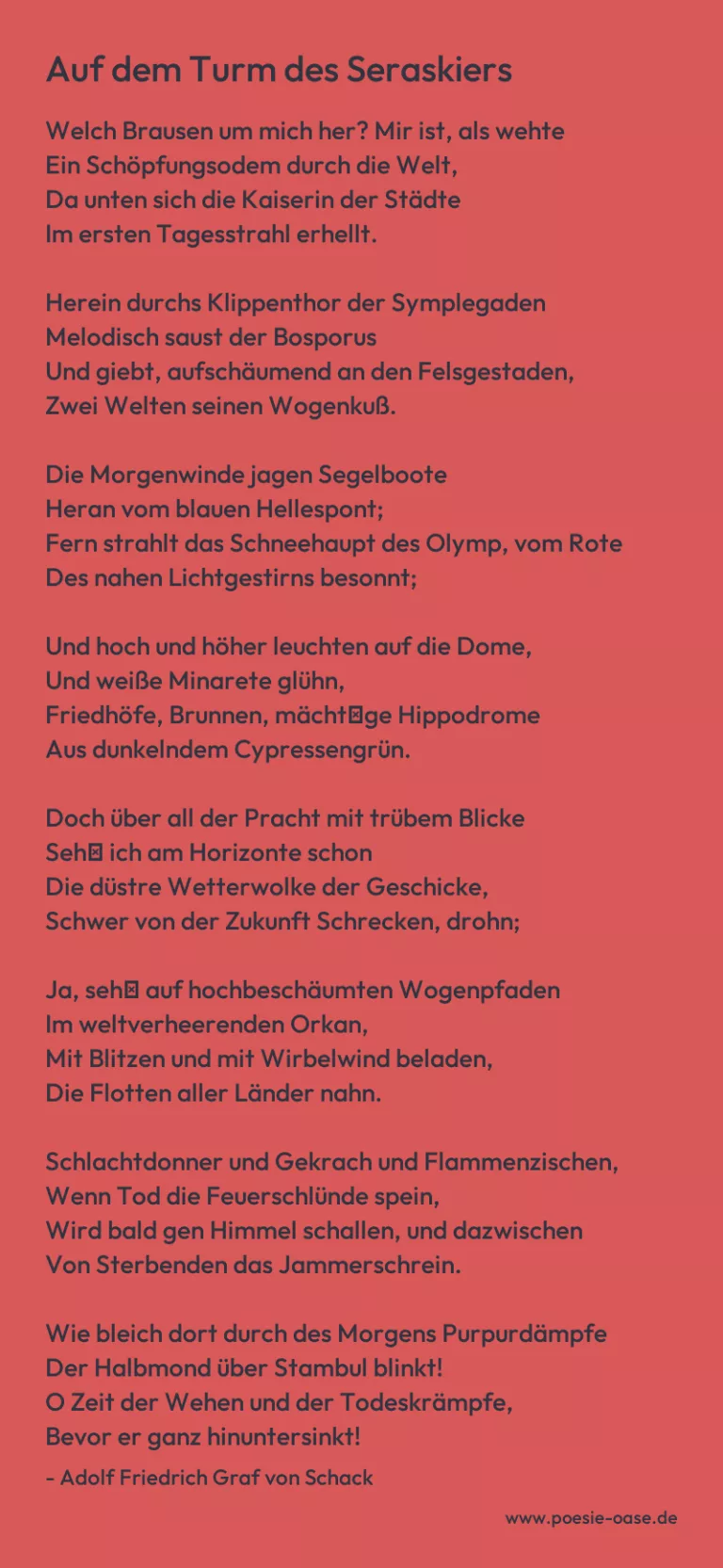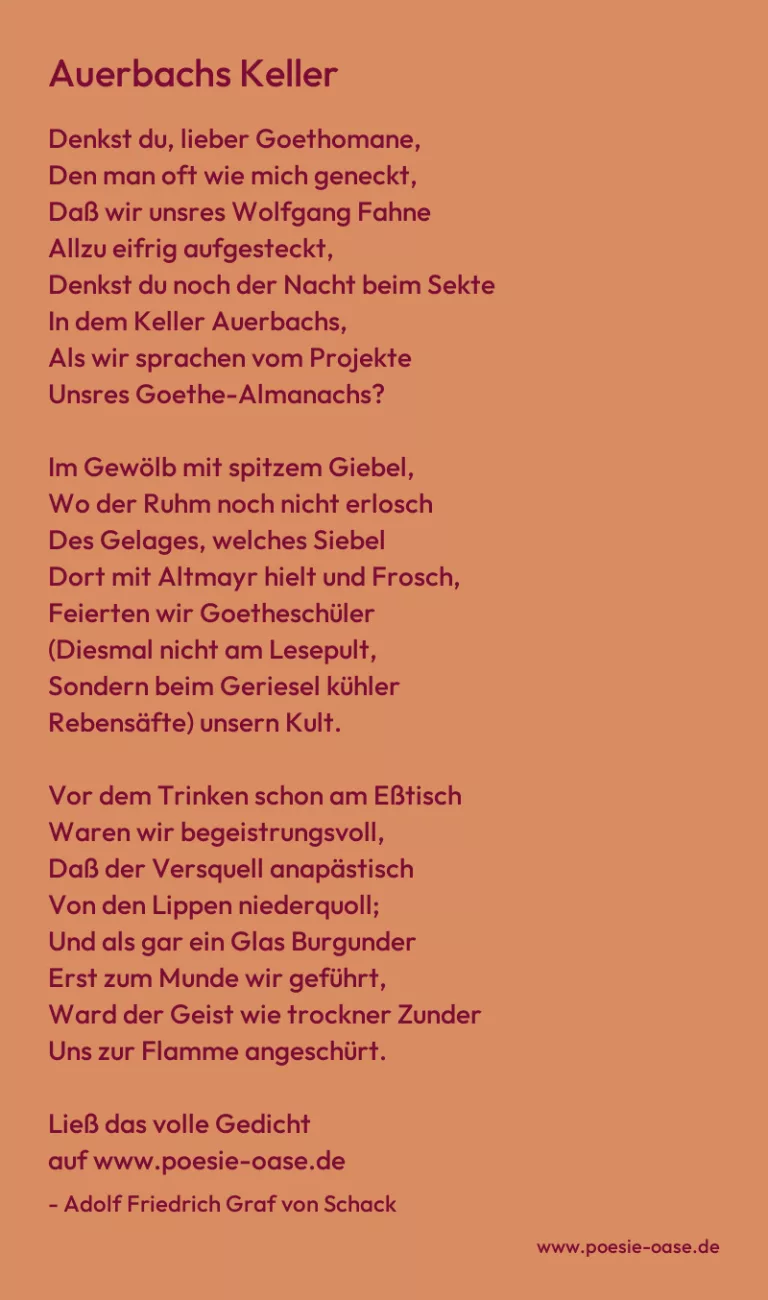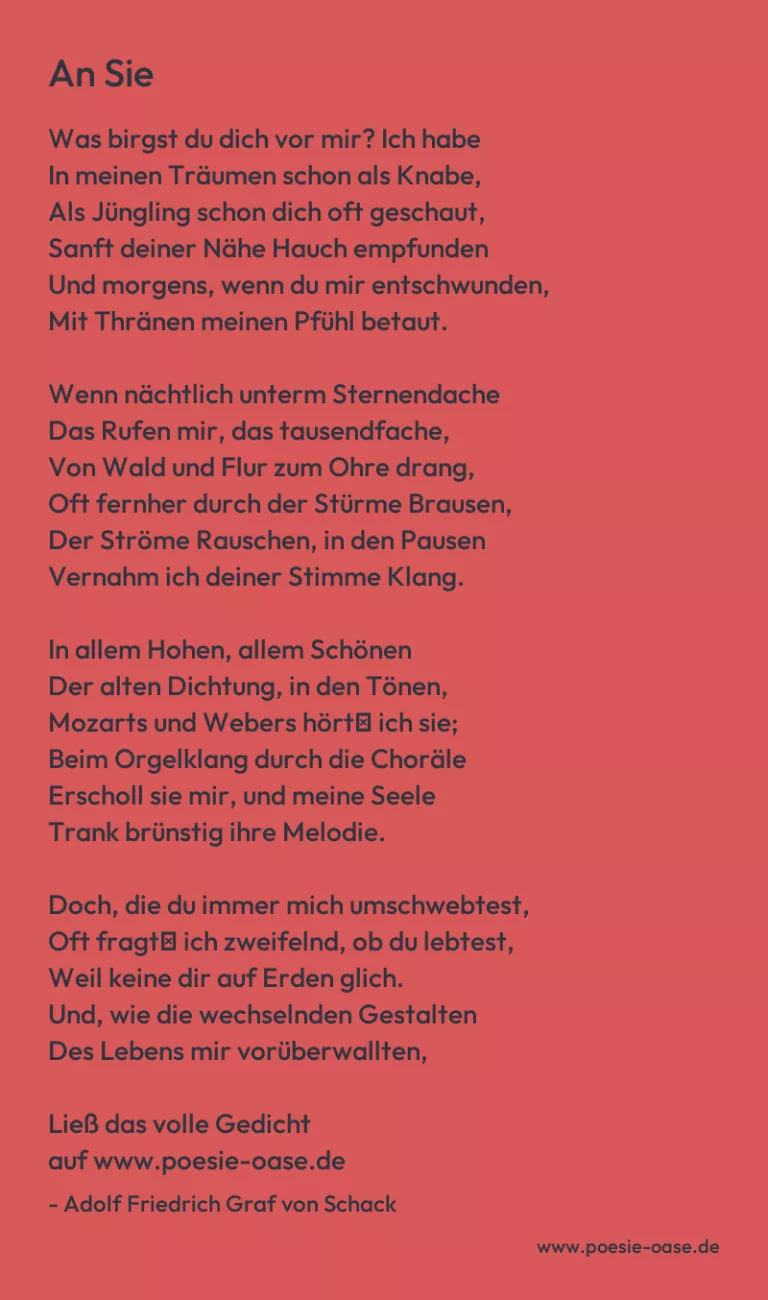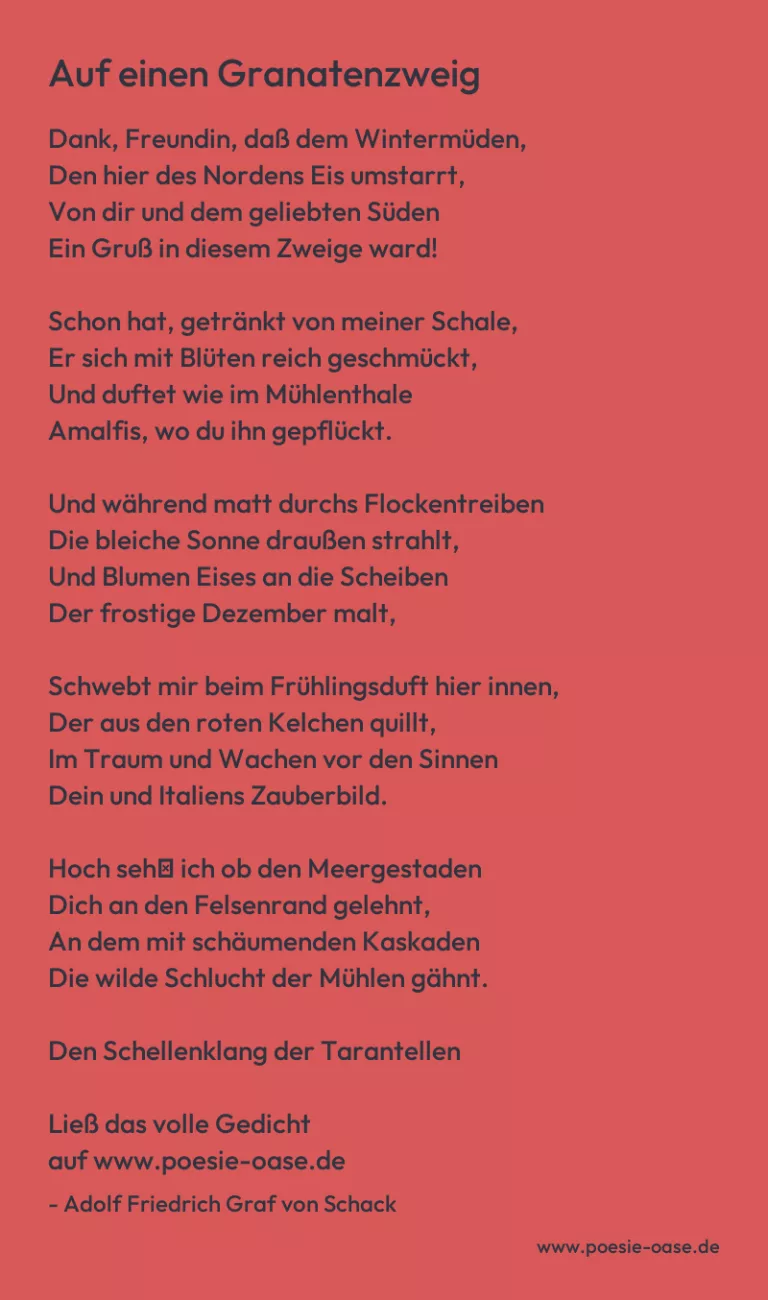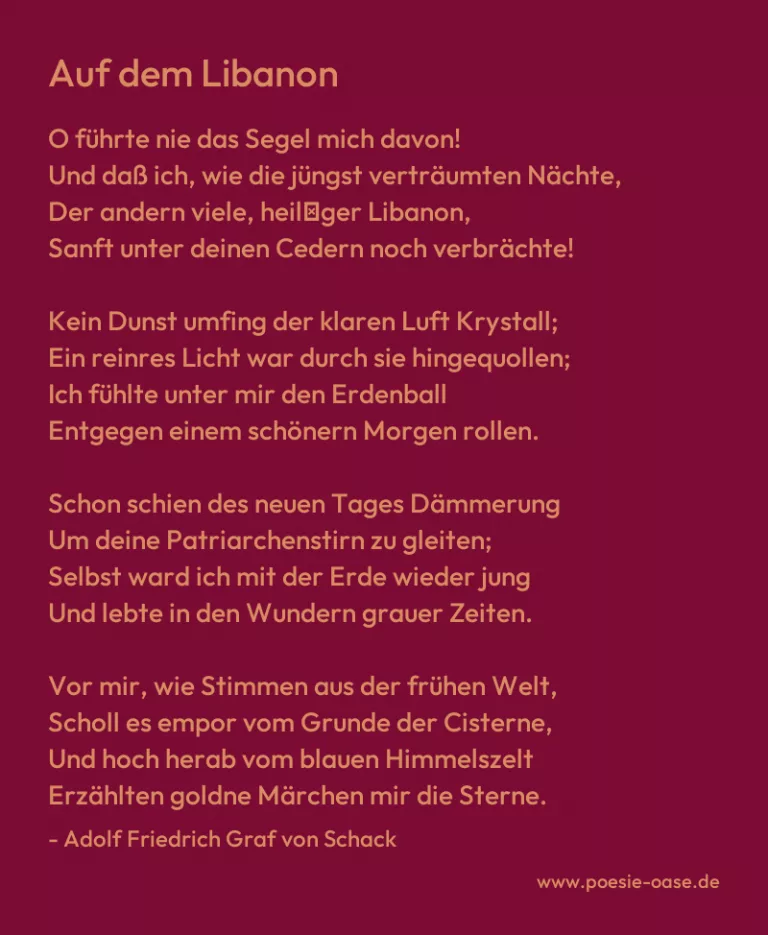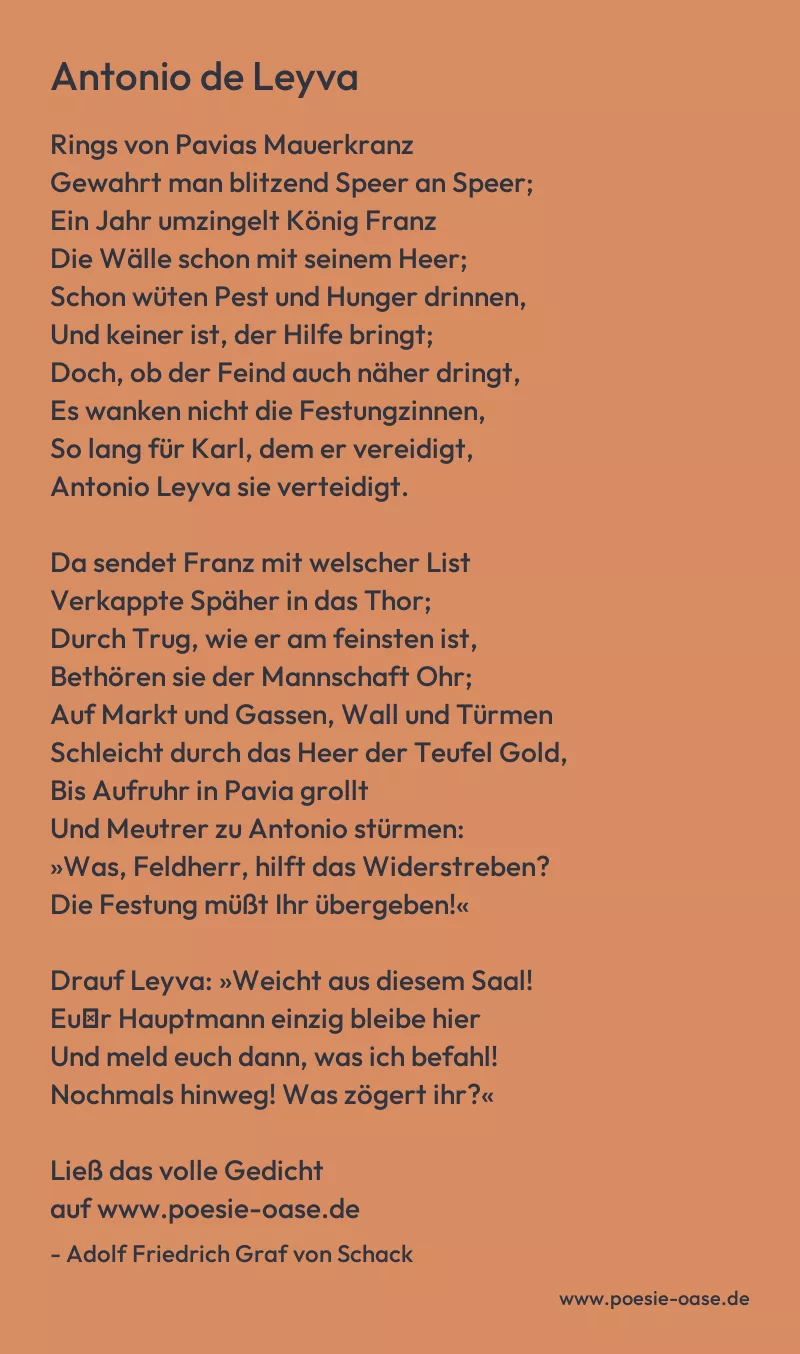Rings von Pavias Mauerkranz
Gewahrt man blitzend Speer an Speer;
Ein Jahr umzingelt König Franz
Die Wälle schon mit seinem Heer;
Schon wüten Pest und Hunger drinnen,
Und keiner ist, der Hilfe bringt;
Doch, ob der Feind auch näher dringt,
Es wanken nicht die Festungzinnen,
So lang für Karl, dem er vereidigt,
Antonio Leyva sie verteidigt.
Da sendet Franz mit welscher List
Verkappte Späher in das Thor;
Durch Trug, wie er am feinsten ist,
Bethören sie der Mannschaft Ohr;
Auf Markt und Gassen, Wall und Türmen
Schleicht durch das Heer der Teufel Gold,
Bis Aufruhr in Pavia grollt
Und Meutrer zu Antonio stürmen:
»Was, Feldherr, hilft das Widerstreben?
Die Festung müßt Ihr übergeben!«
Drauf Leyva: »Weicht aus diesem Saal!
Eu′r Hauptmann einzig bleibe hier
Und meld euch dann, was ich befahl!
Nochmals hinweg! Was zögert ihr?«
Der Hauptmann winkt und, zu vollführen,
Was er gebeut, gehn jene stumm;
Antonio aber schließt ringsum
Des Saales feste Eisenthüren
Und donnert in des Hauptmanns Ohren:
»Zieh, Schurke, zieh! Du bist verloren!
Verräter nenn′ ich dich an Gott
Und an des Kaisers Majestät;
Um Gold, von Franken ausgesät,
Treibst du mit Ehr′ und Treue Spott!
Zieh, zieh! Kein Weg zur Flucht ist offen!«
Auf den Bestürzten eilt er los,
Hieb folgt auf Hieb und Stoß auf Stoß;
»Weh!« – ruft der Hauptmann – »weh! getroffen!«
Zu Boden taumelt der Bethörte,
Durchbohrt von Don Antonios Schwerte.
Indessen tönt von unten schon
Der Soldateska wüst Geschrei;
Es wächst und schwillt die Meuterei;
Den Hauptmann fordern sie und drohn
Mit Lanzen und entflammten Lunten;
Antonio aber tritt gefaßt
Auf den Balkon vor dem Palast
Und schleudert ins Gewühl nach unten
Den kaum erblaßten Toten nieder.
»Ihr fordert ihn, da habt ihn wieder!«
Und wild ertönt das Racheschrein
Der Kriegerhaufen; voll von Wut
Verlangen sie des Feldherrn Blut;
Doch festen Schritts in ihre Reihn
Steigt er hinunter. »Hört, ihr alle,
Daß diesen für Verrat und Trug
Ich in gerechtem Kampf erschlug!
Die Leiche werft hinab vom Walle,
Damit wir König Franz belehren,
Wie seine Söldlinge wir ehren!
Ihr bebt vor Pest und Hungersnot
Und sagt dafür der Ehre ab;
Seht hier – es ist mein letztes Brot,
Ich werf′ es in den Strom hinab;
Und wollt ihr noch von Schande reden
Und Uebergabe – nun, wohlan!
Euch alle will ich Mann für Mann
Im Kampf bestehn und werde jeden,
Sobald er fiel von meinen Händen,
Als Leiche den Franzosen senden.«
Ein Murmeln ging, als so er sprach,
Ein Staunen durch der Krieger Reihn;
Nicht einer wollte so mit Schmach
Befleckt vor seinem Feldherrn sein;
Verzeihung sich erflehend, traten
Sie um ihn her und schwuren neu,
Zum letzten Atemzuge treu
Sein wert zu sein durch Heldenthaten.
Und König Franz verließ in Schnelle,
Da er′s vernahm, Pavias Wälle.