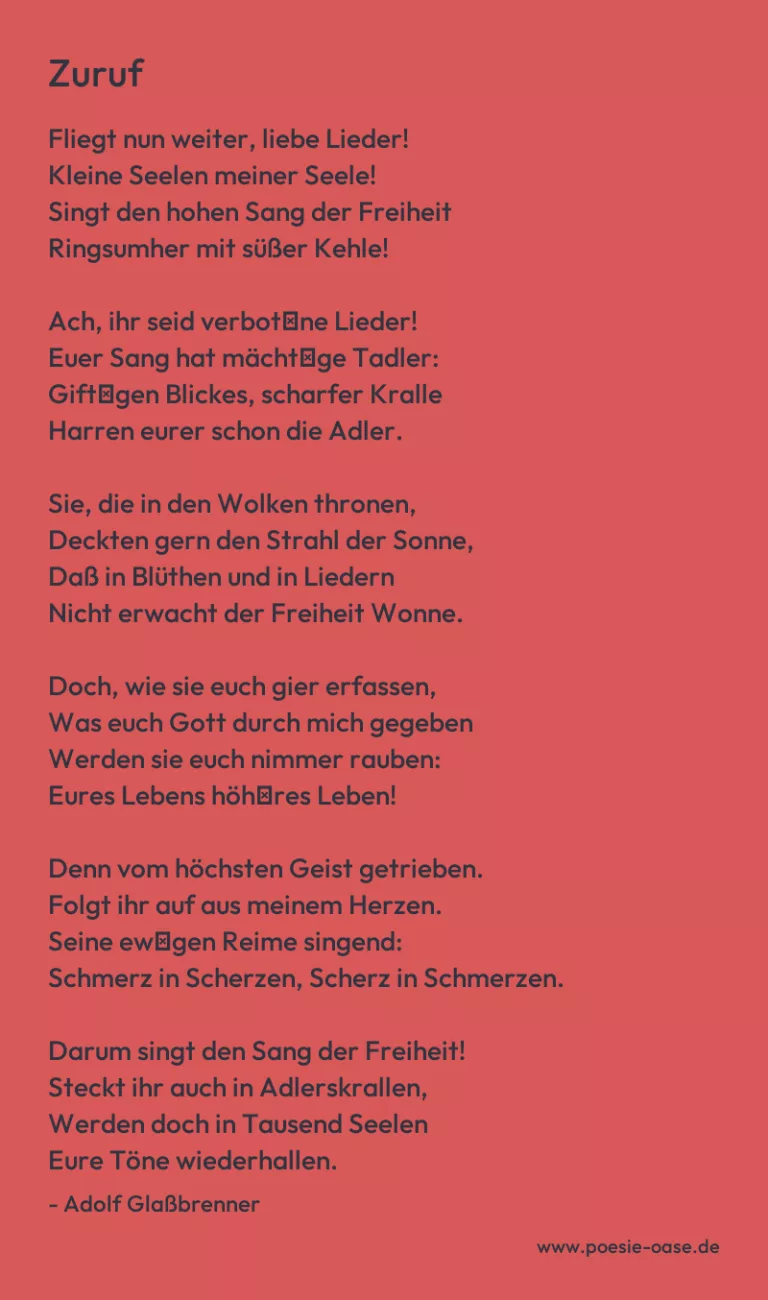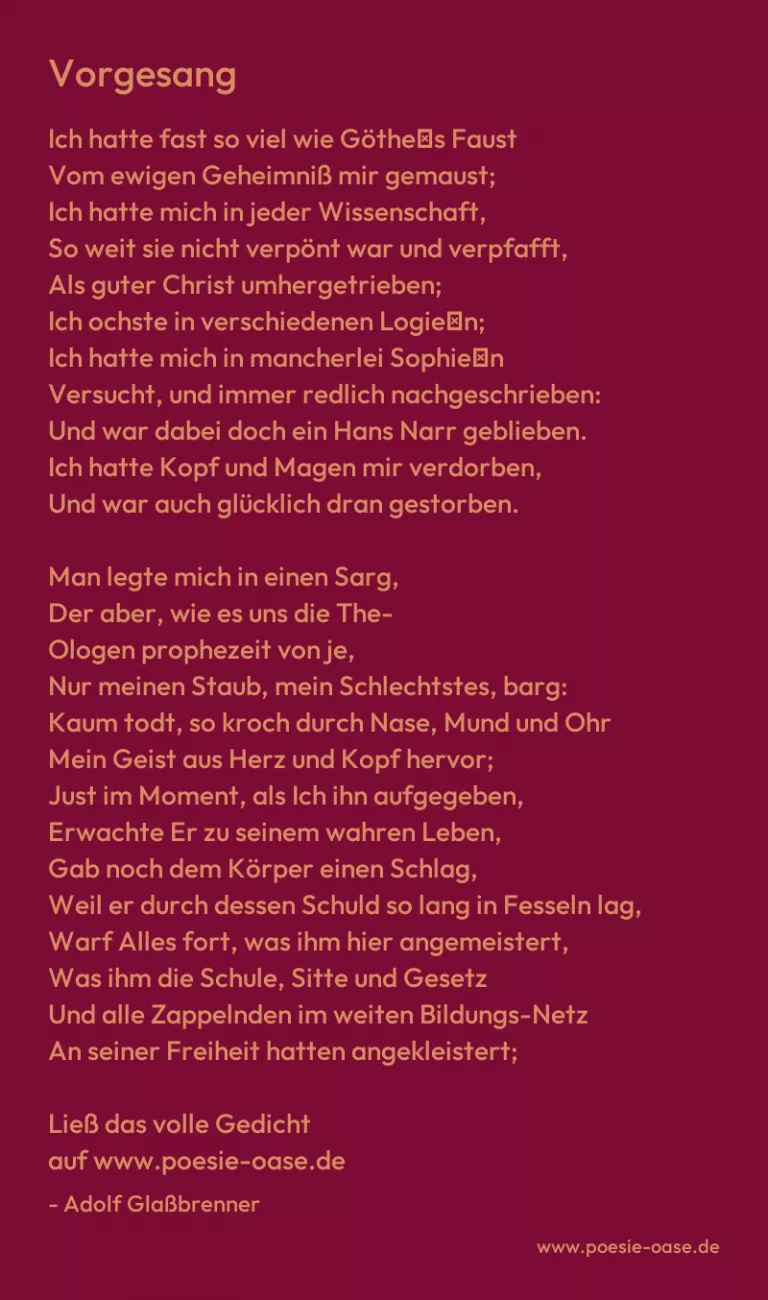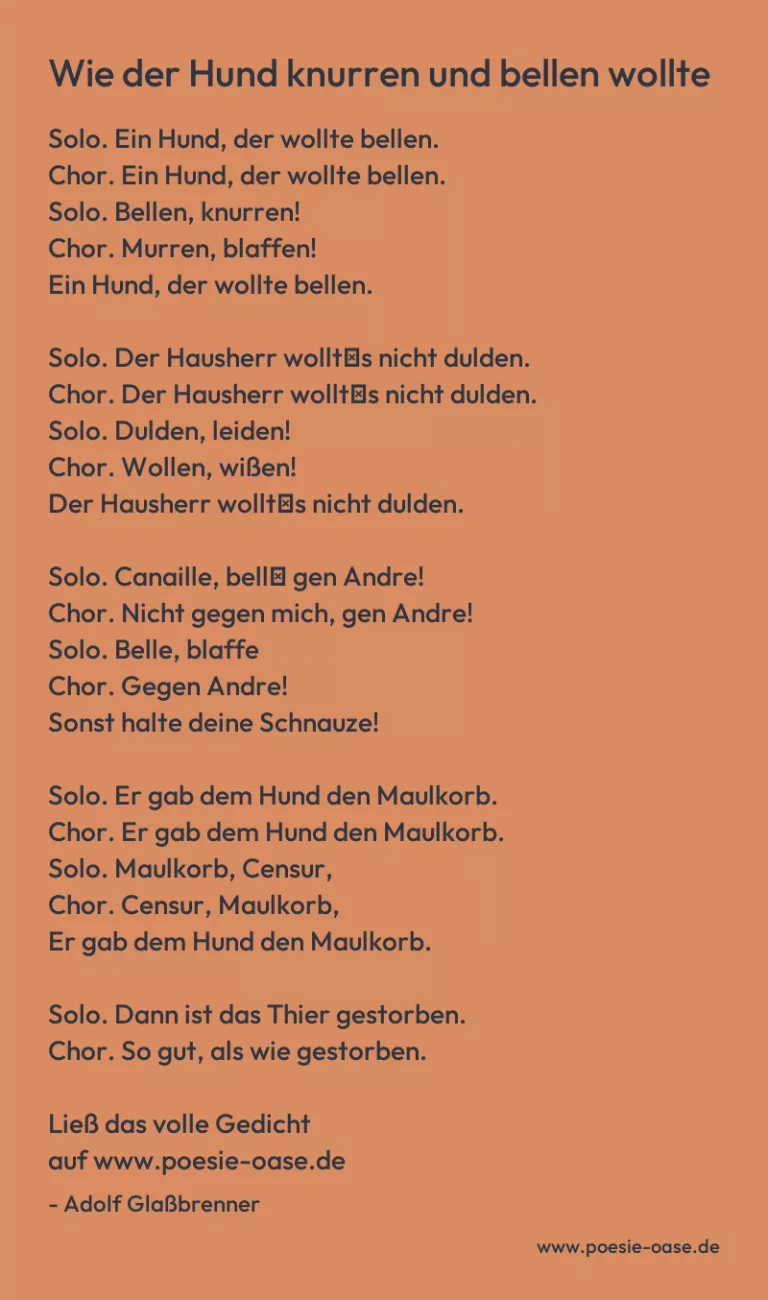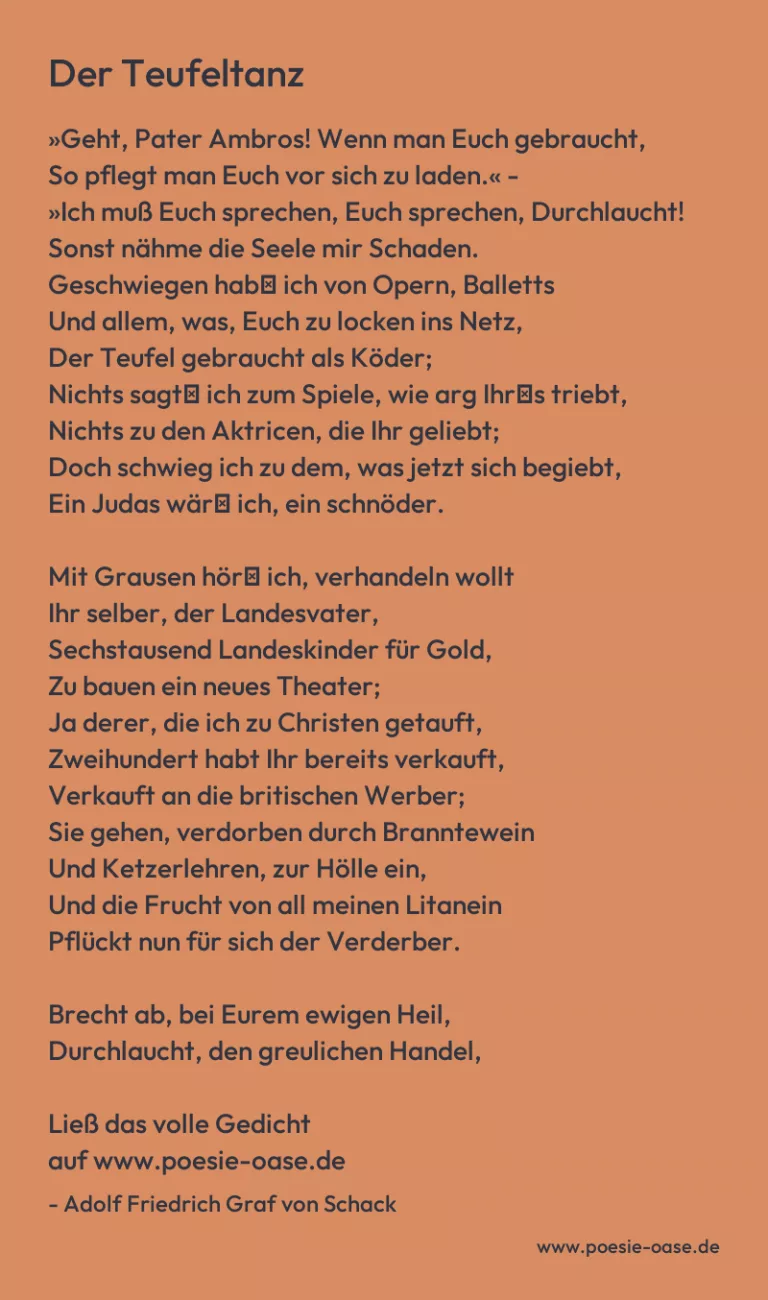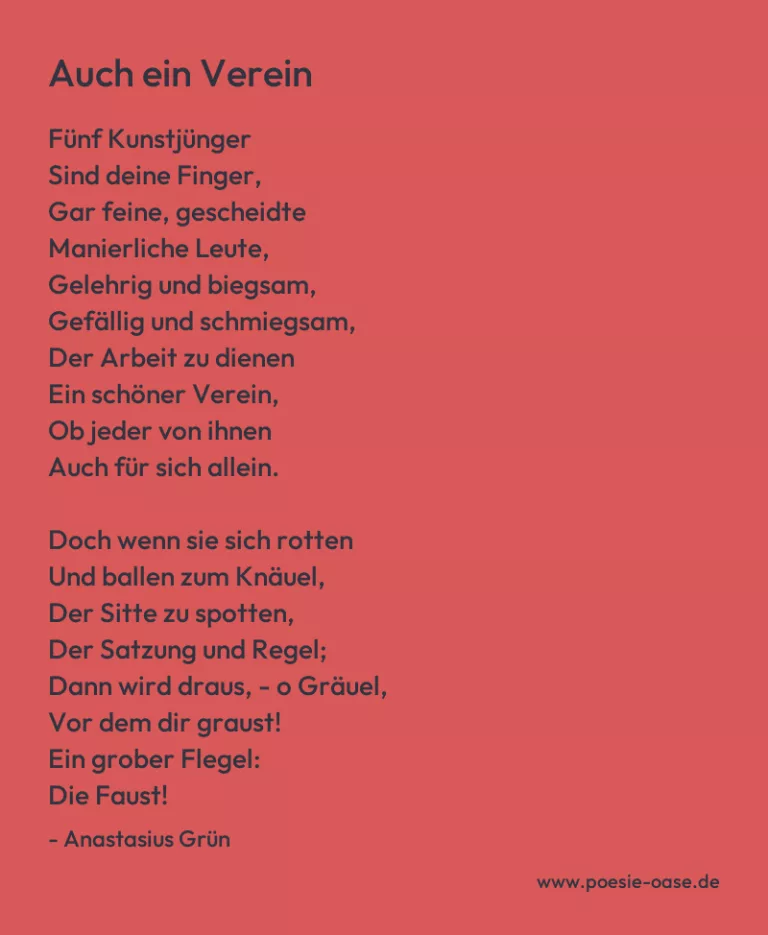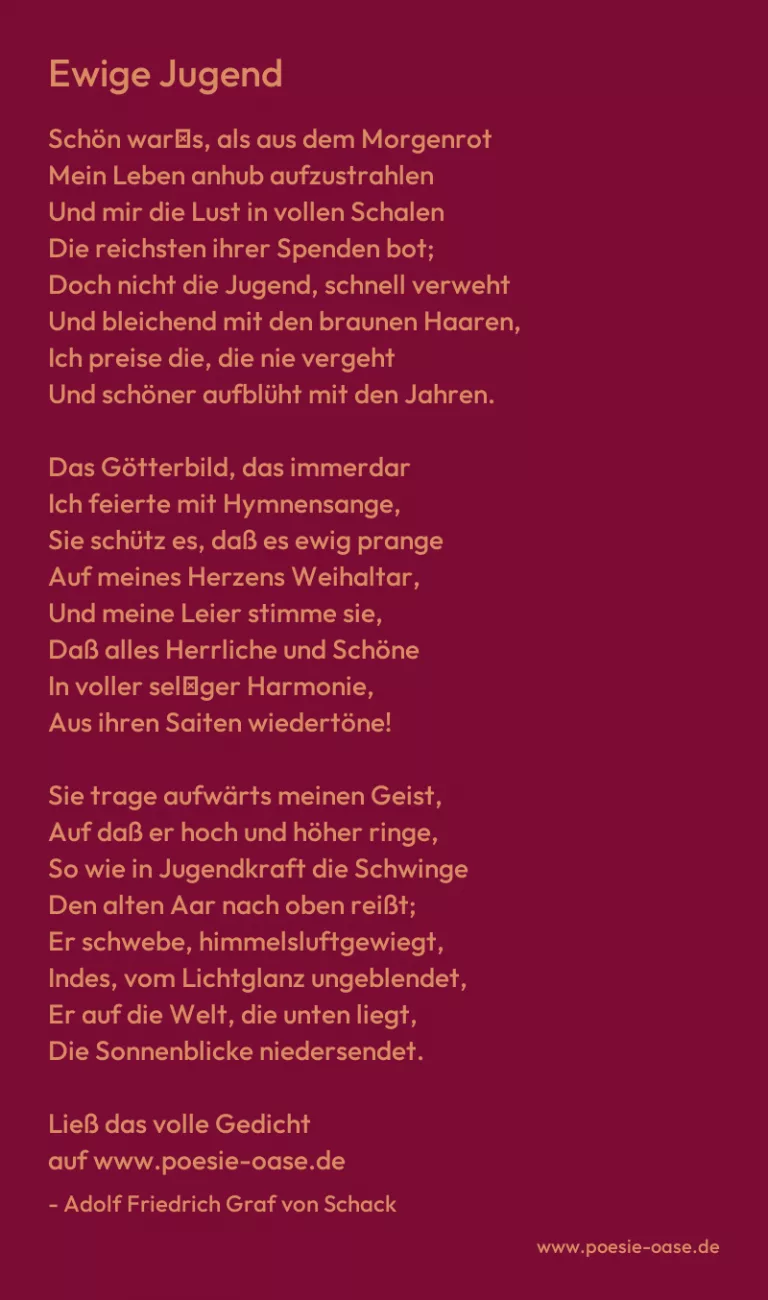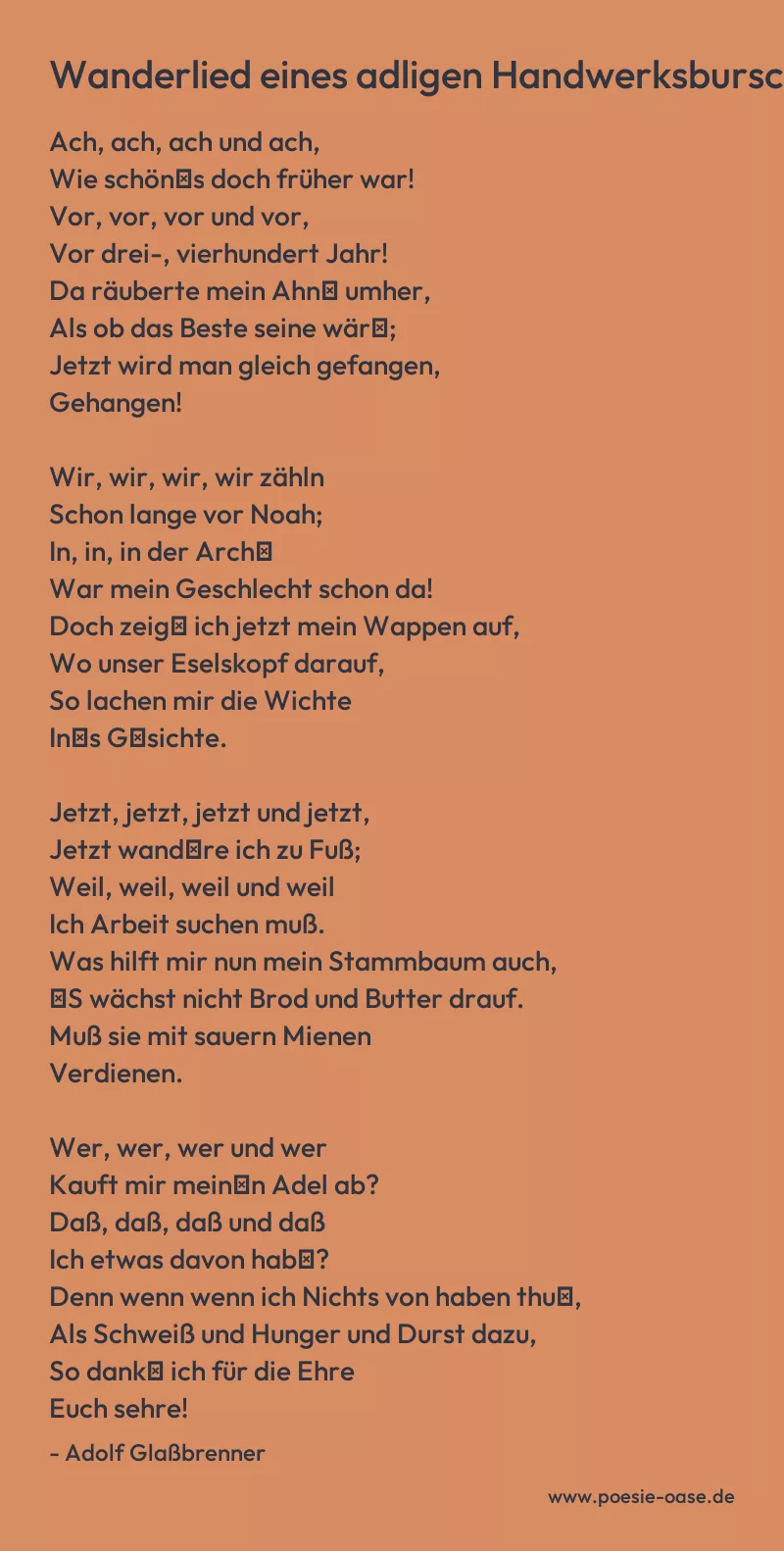Ach, ach, ach und ach,
Wie schön′s doch früher war!
Vor, vor, vor und vor,
Vor drei-, vierhundert Jahr!
Da räuberte mein Ahn′ umher,
Als ob das Beste seine wär′;
Jetzt wird man gleich gefangen,
Gehangen!
Wir, wir, wir, wir zähln
Schon lange vor Noah;
In, in, in der Arch′
War mein Geschlecht schon da!
Doch zeig′ ich jetzt mein Wappen auf,
Wo unser Eselskopf darauf,
So lachen mir die Wichte
In′s G′sichte.
Jetzt, jetzt, jetzt und jetzt,
Jetzt wand′re ich zu Fuß;
Weil, weil, weil und weil
Ich Arbeit suchen muß.
Was hilft mir nun mein Stammbaum auch,
′S wächst nicht Brod und Butter drauf.
Muß sie mit sauern Mienen
Verdienen.
Wer, wer, wer und wer
Kauft mir mein′n Adel ab?
Daß, daß, daß und daß
Ich etwas davon hab′?
Denn wenn wenn ich Nichts von haben thu′,
Als Schweiß und Hunger und Durst dazu,
So dank′ ich für die Ehre
Euch sehre!