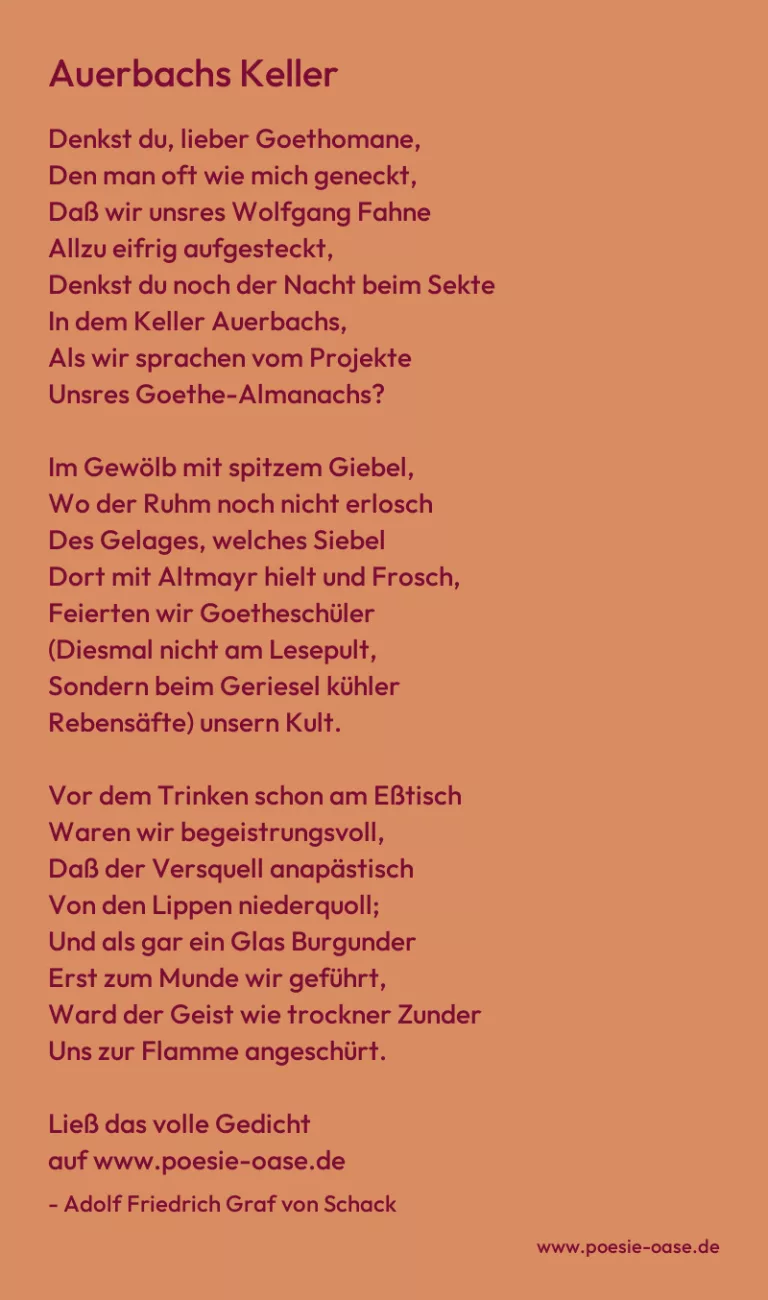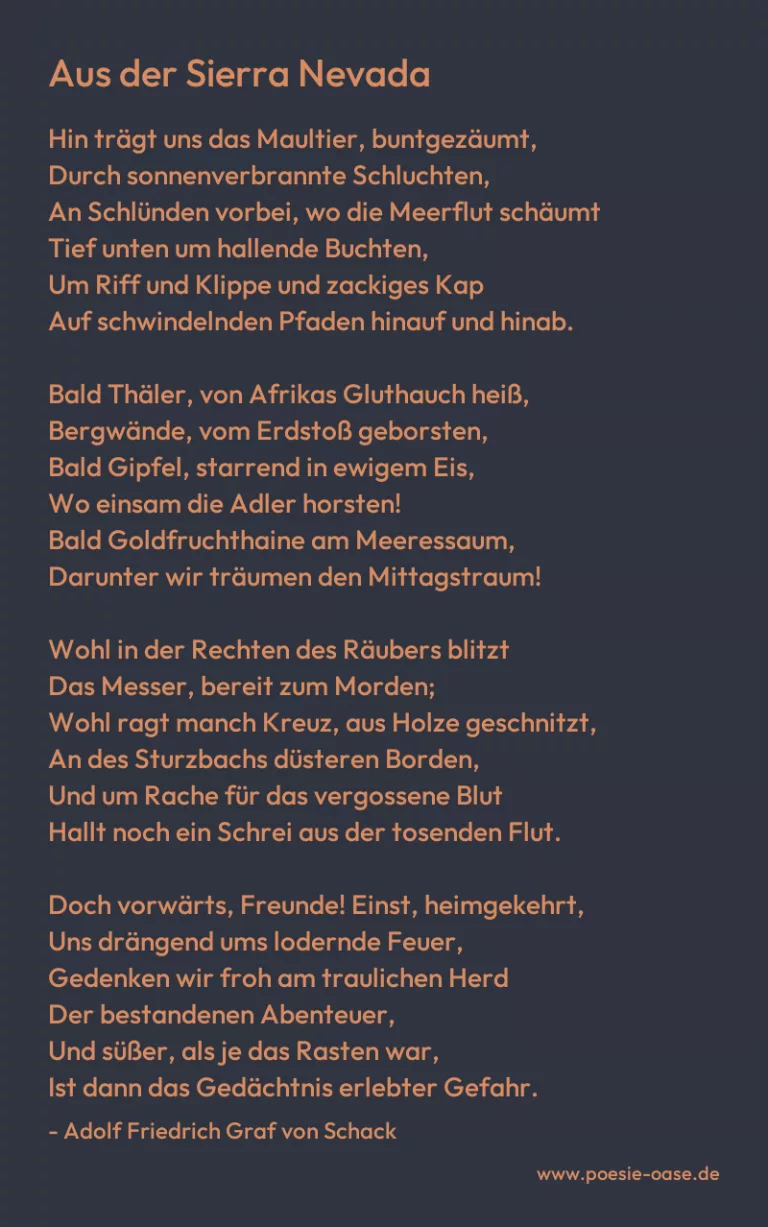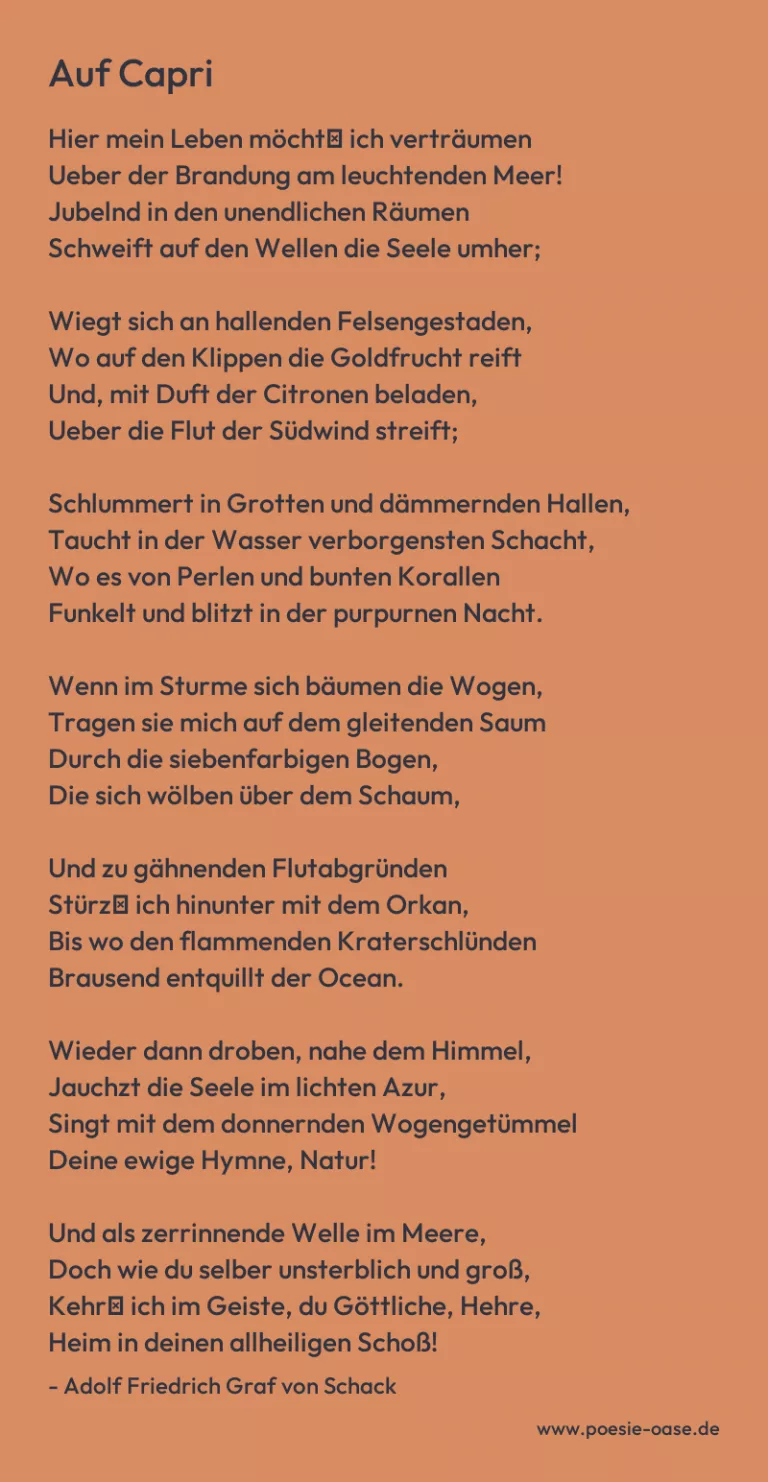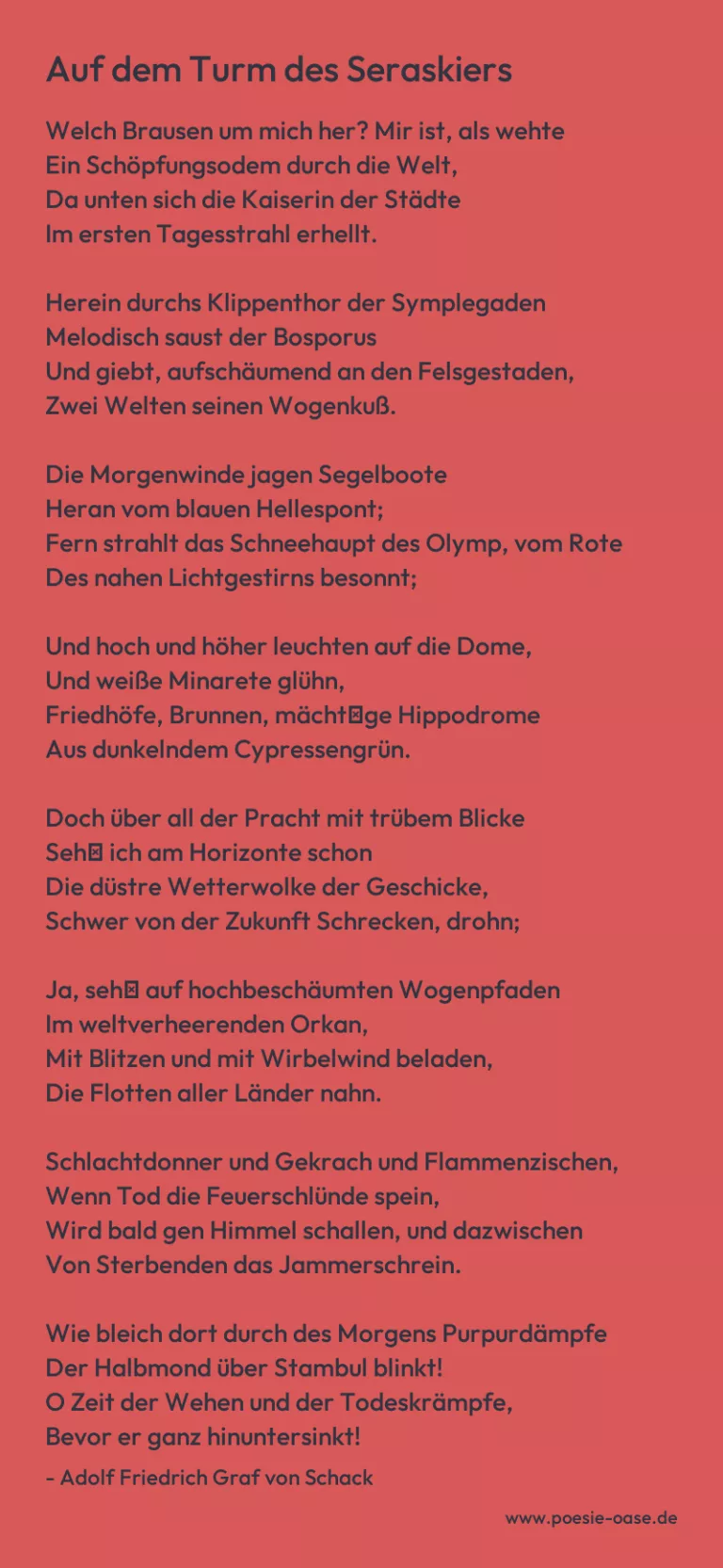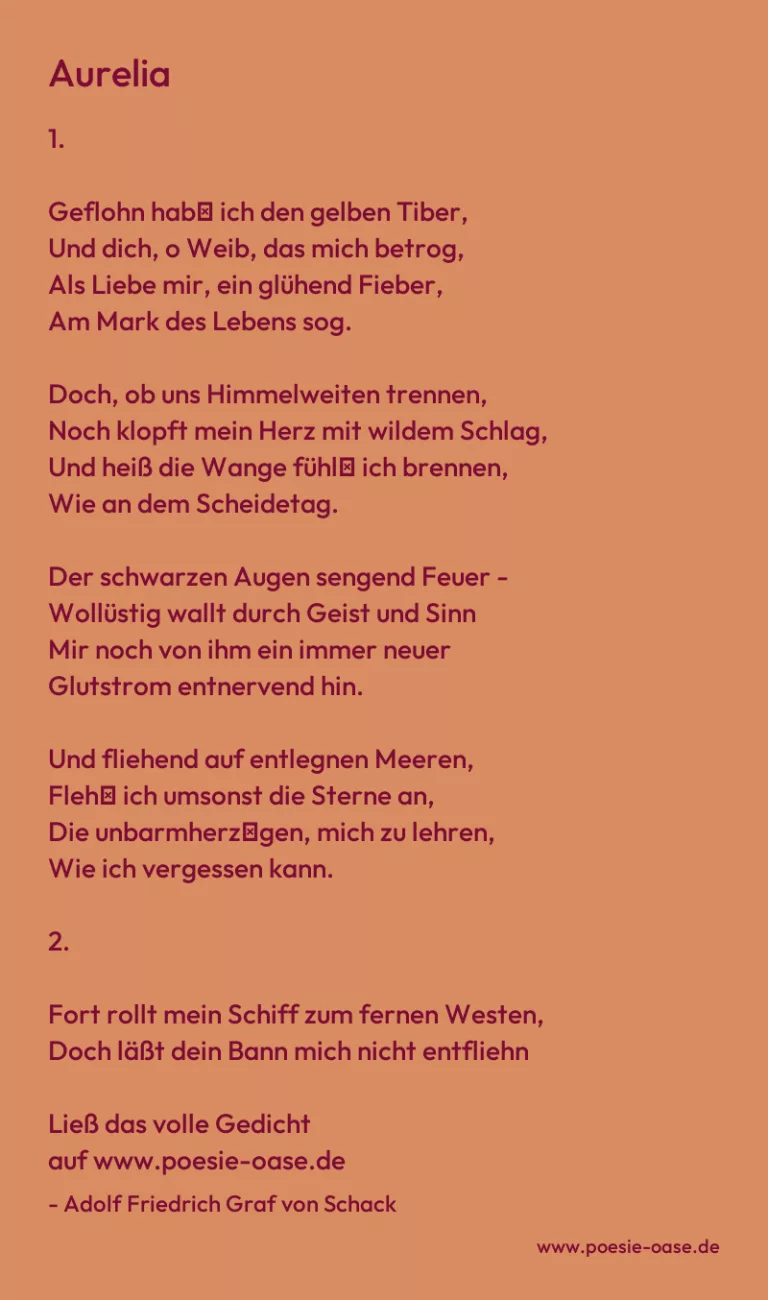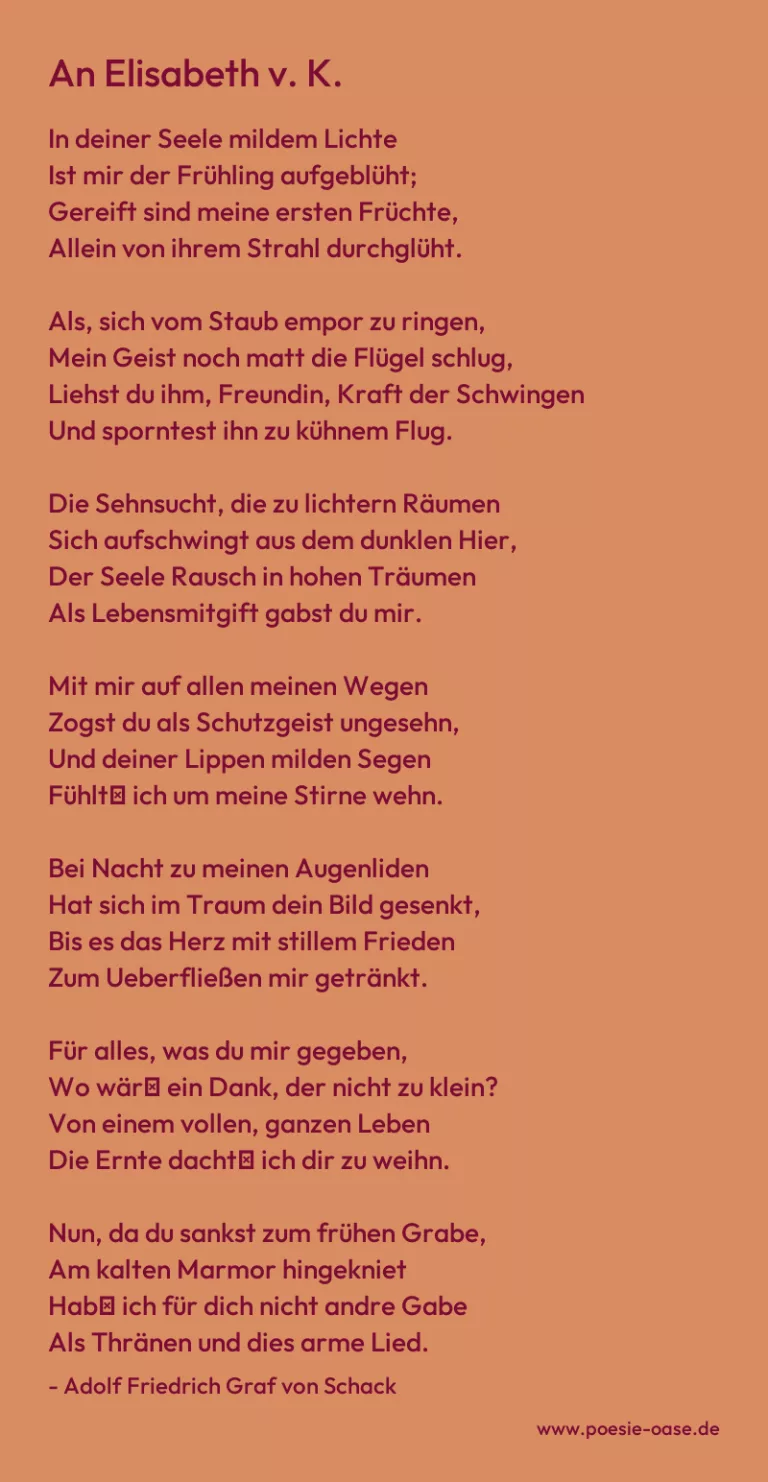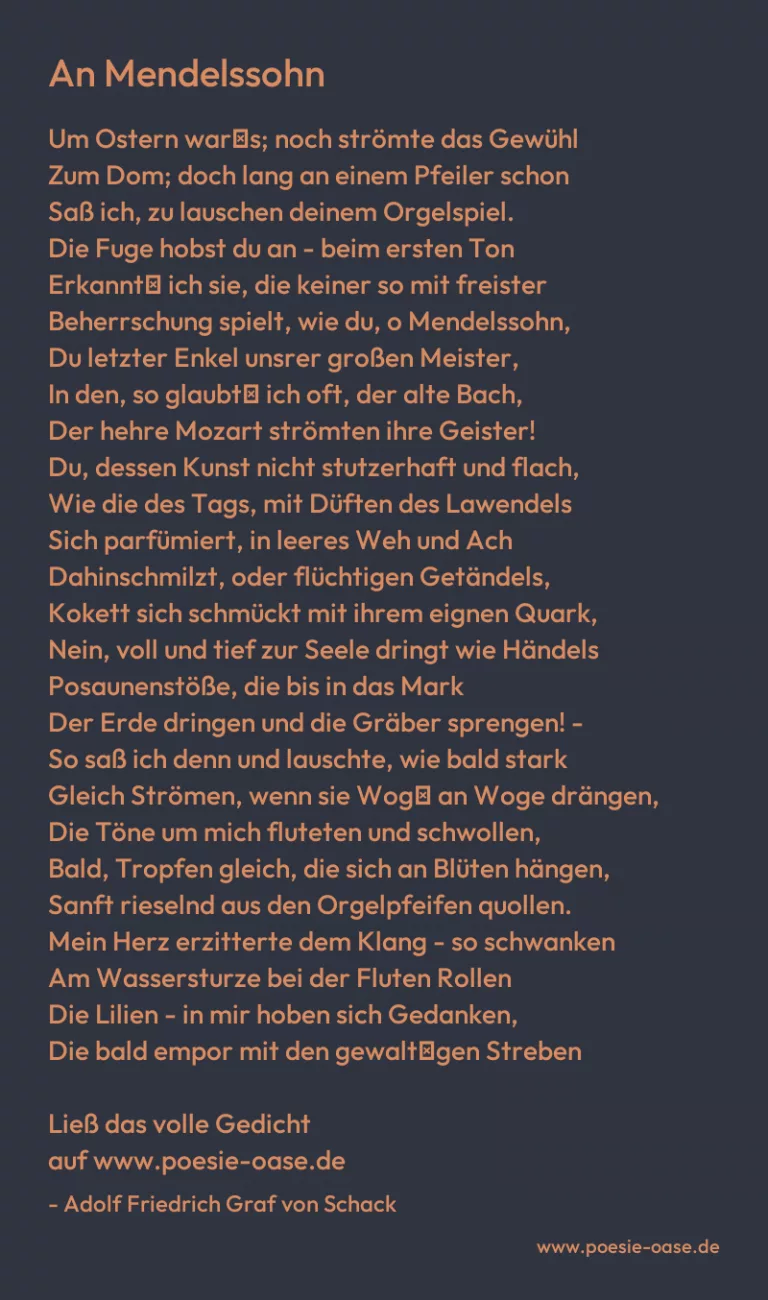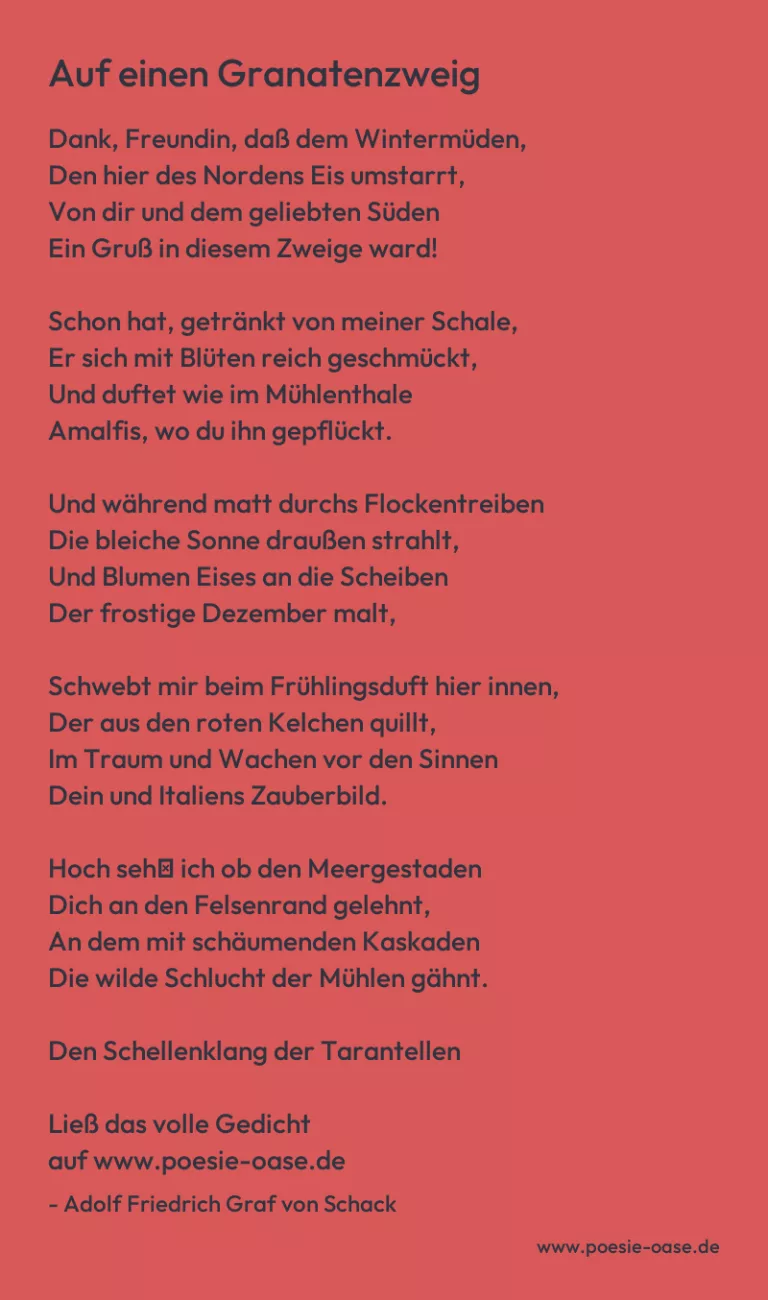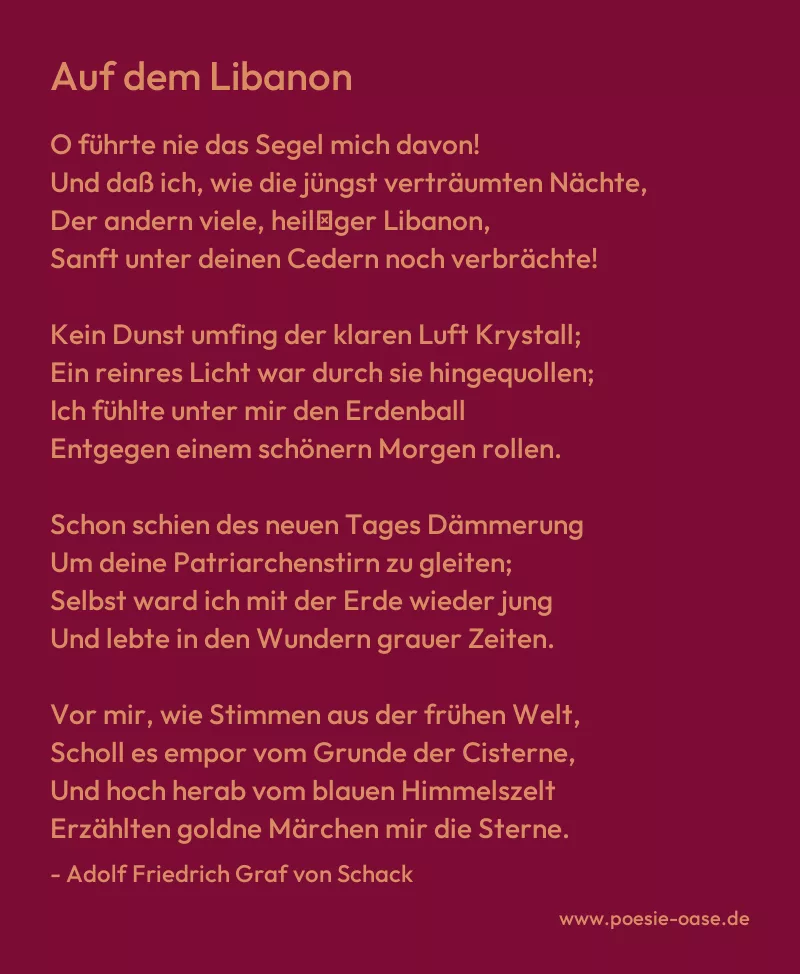Auf dem Libanon
O führte nie das Segel mich davon!
Und daß ich, wie die jüngst verträumten Nächte,
Der andern viele, heil′ger Libanon,
Sanft unter deinen Cedern noch verbrächte!
Kein Dunst umfing der klaren Luft Krystall;
Ein reinres Licht war durch sie hingequollen;
Ich fühlte unter mir den Erdenball
Entgegen einem schönern Morgen rollen.
Schon schien des neuen Tages Dämmerung
Um deine Patriarchenstirn zu gleiten;
Selbst ward ich mit der Erde wieder jung
Und lebte in den Wundern grauer Zeiten.
Vor mir, wie Stimmen aus der frühen Welt,
Scholl es empor vom Grunde der Cisterne,
Und hoch herab vom blauen Himmelszelt
Erzählten goldne Märchen mir die Sterne.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
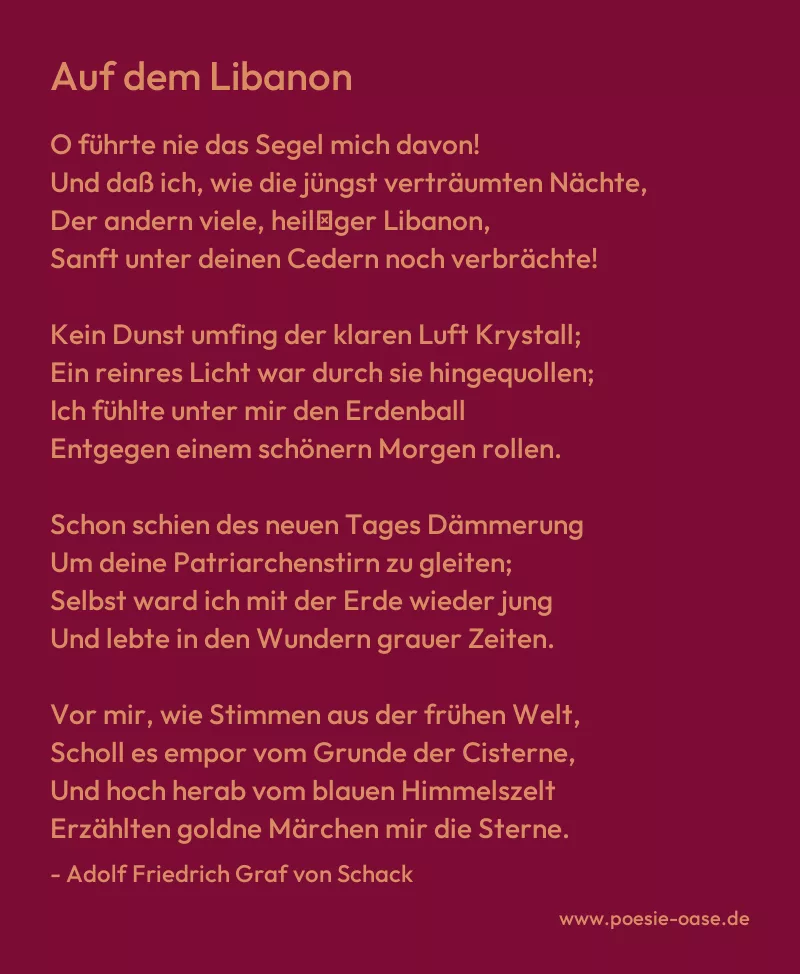
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf dem Libanon“ von Adolf Friedrich Graf von Schack ist eine poetische Hommage an die Schönheit und Erhabenheit des Libanongebirges, verbunden mit der Sehnsucht nach einem Zustand von Harmonie und spiritueller Erneuerung. Der Sprecher drückt den Wunsch aus, seine Zeit am Libanon zu verlängern und die dort verbrachten Nächte in vollen Zügen auszukosten. Es ist ein Bekenntnis zur Schönheit der Natur und eine Reflektion über die Vergänglichkeit des Lebens. Die Verwendung von Begriffen wie „heil’ger Libanon“ und „Cisternen“ deutet auf eine tiefe Verehrung und Ehrfurcht gegenüber der Natur und der Geschichte des Ortes hin.
Die im Gedicht beschriebene Szenerie ist von Klarheit und Reinheit geprägt. Die „klare Luft Krystall“ und das „reinres Licht“ vermitteln ein Gefühl von Erhabenheit und Unberührtheit. Der Sprecher erlebt eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und spürt, wie die Erde sich „einem schönern Morgen“ entgegenbewegt. Diese Zeilen suggerieren eine Hoffnung und Zuversicht, sowie die Sehnsucht nach einem Neuanfang. Der Libanon wird hier zu einem Ort der spirituellen Erhebung und des Aufbruchs, der dem Sprecher ein Gefühl der Verjüngung und der Nähe zur Vergangenheit verleiht.
In der dritten Strophe wird die Zeit der Dämmerung als Moment der Erneuerung dargestellt. Der Sprecher fühlt sich jung und lebendig, als er die Patriarchenstirn des Berges beobachtet. Die „Wunder grauer Zeiten“ verschmelzen mit der Gegenwart, und der Sprecher taucht in eine Welt der Vergangenheit ein. Die Metapher „Mit der Erde wieder jung“ drückt eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und der Geschichte des Ortes aus, wodurch eine Erfahrung der Zeitlosigkeit und des Einklangs entsteht.
Die abschließende Strophe verstärkt die spirituelle Dimension des Gedichts. Die „Stimmen aus der frühen Welt“ und die „goldnen Märchen“ der Sterne erwecken den Eindruck eines mythischen Ortes. Der Sprecher scheint in eine andere Dimension einzutauchen, in der die Vergangenheit und die Gegenwart verschmelzen. Durch die Verbindung von irdischen Elementen wie der Cisterne mit den himmlischen Erzählungen der Sterne wird eine Einheit von Geist und Natur geschaffen, die dem Gedicht eine besondere Tiefe verleiht. Das Gedicht zelebriert somit die Schönheit der Natur als Quelle der Inspiration, Erneuerung und spirituellen Erkenntnis.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.