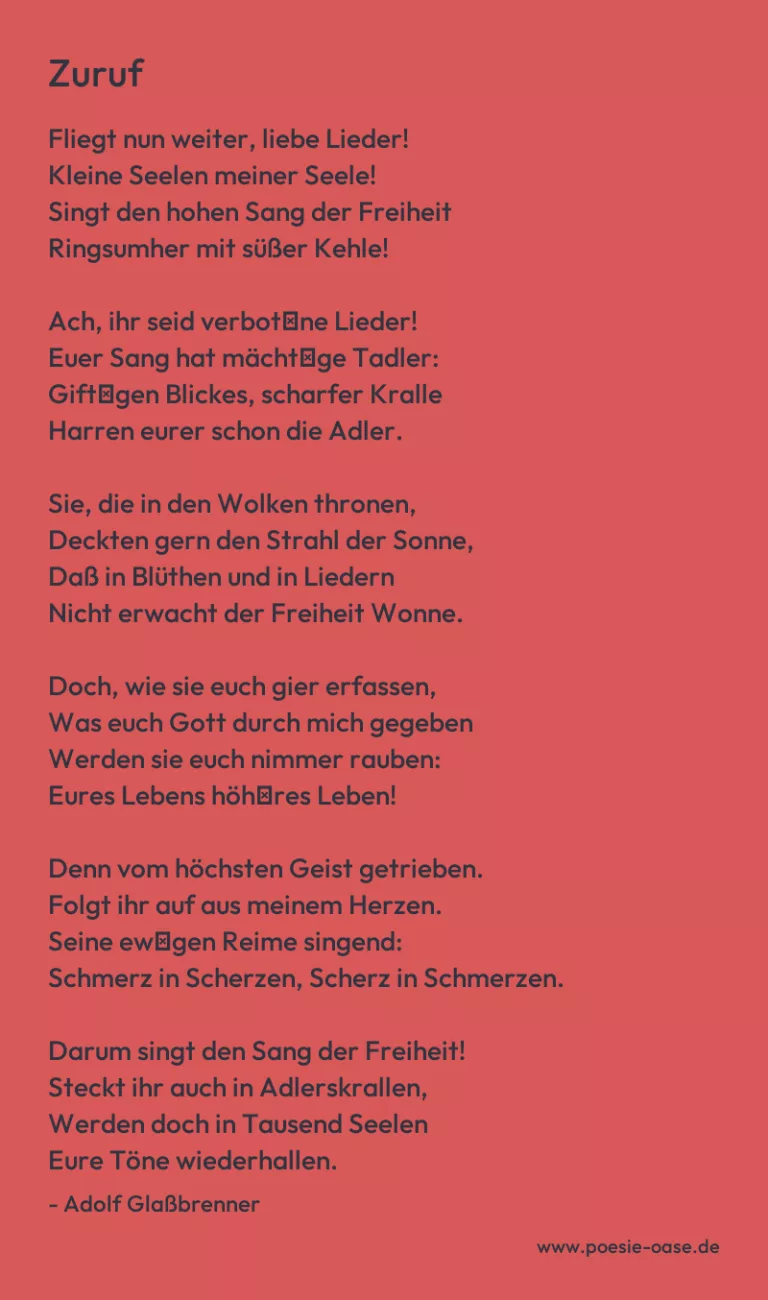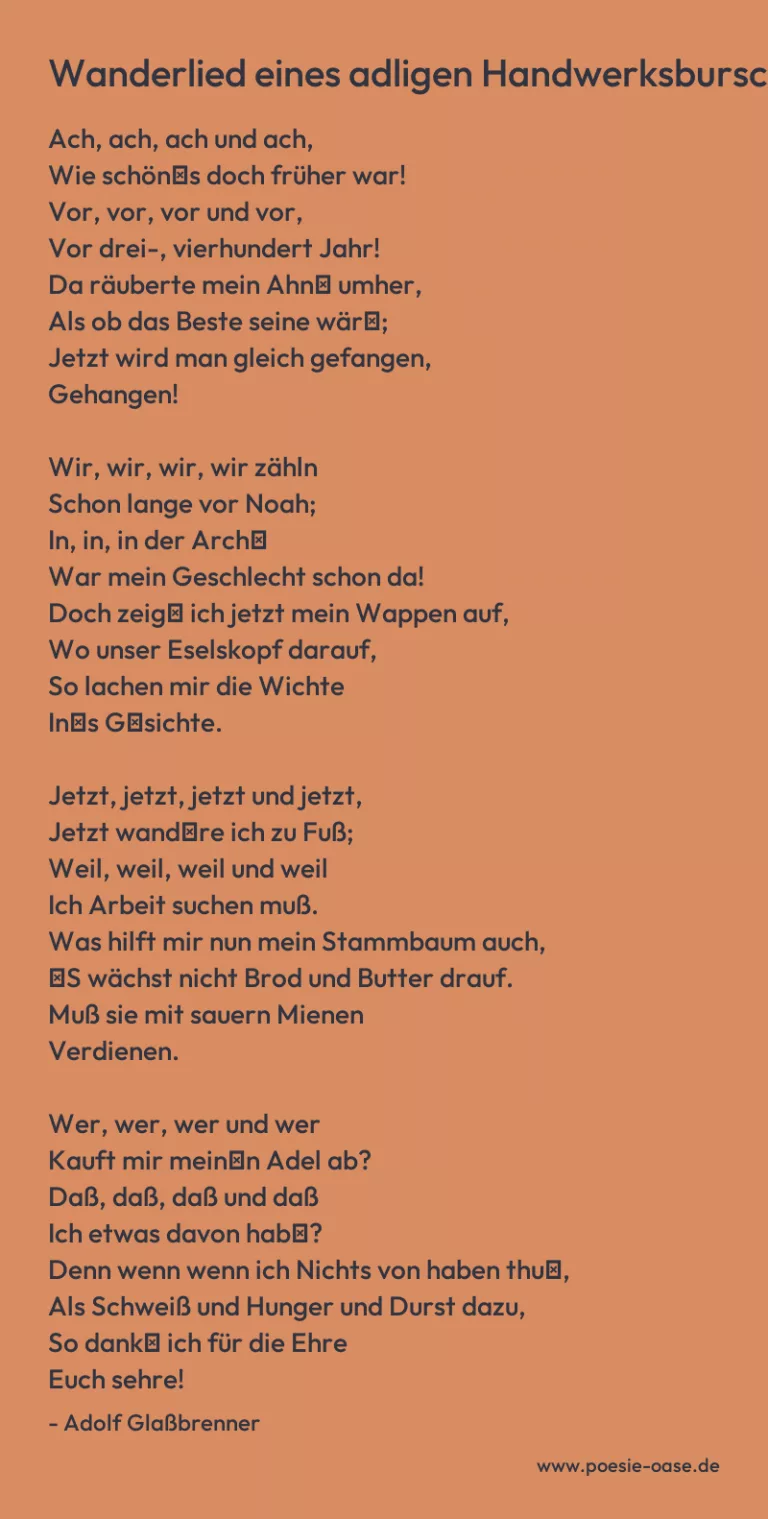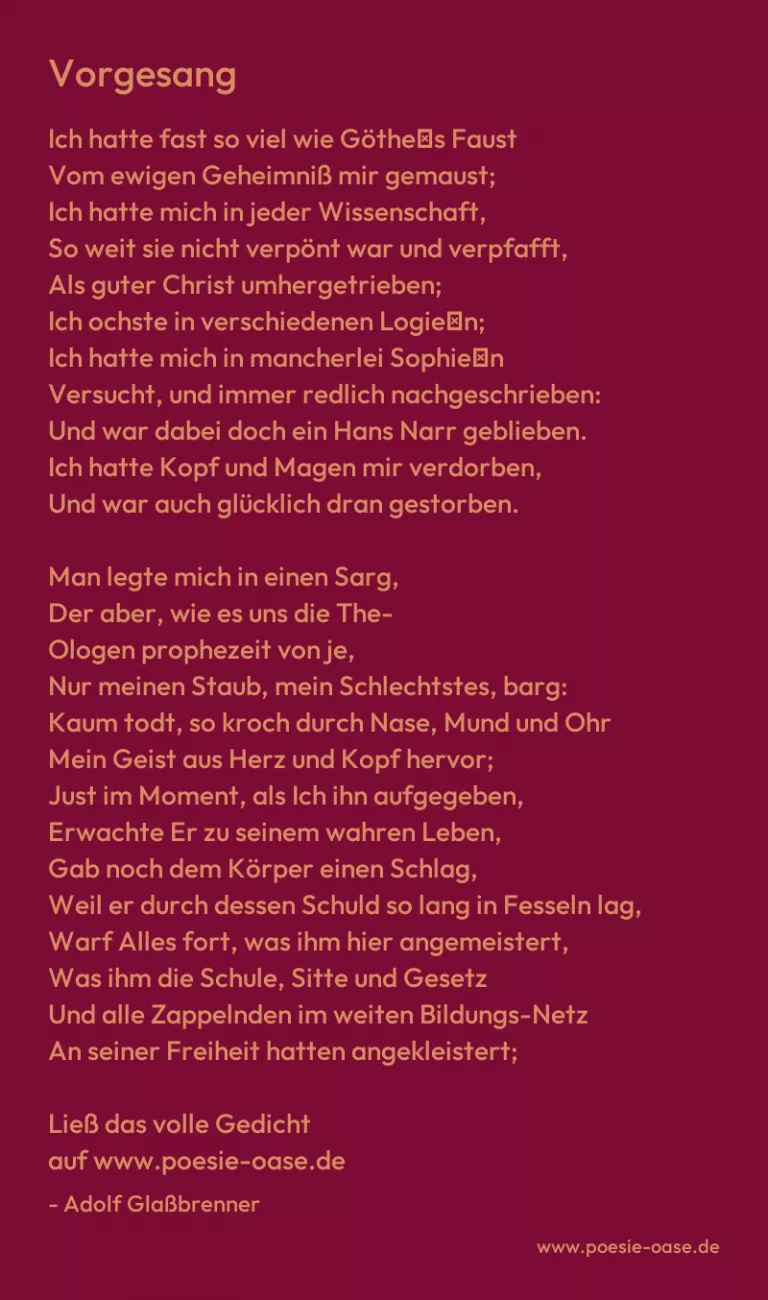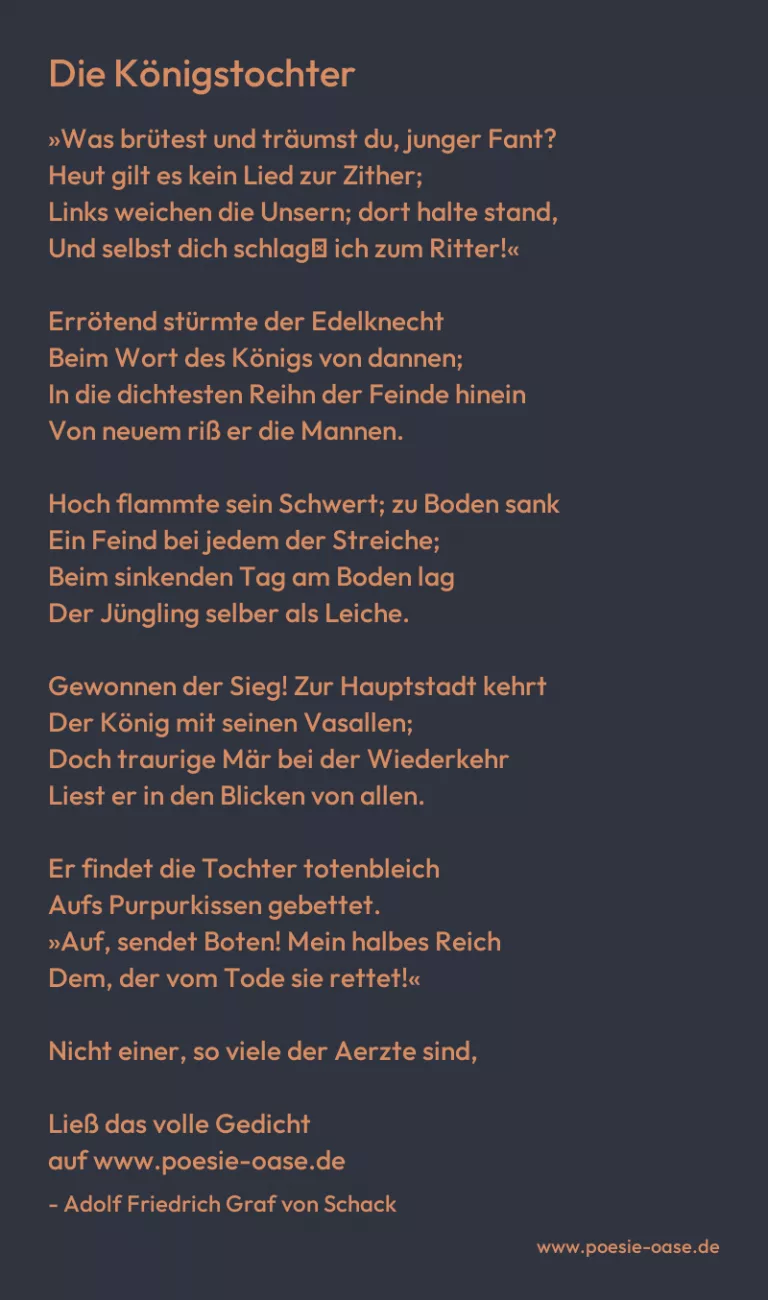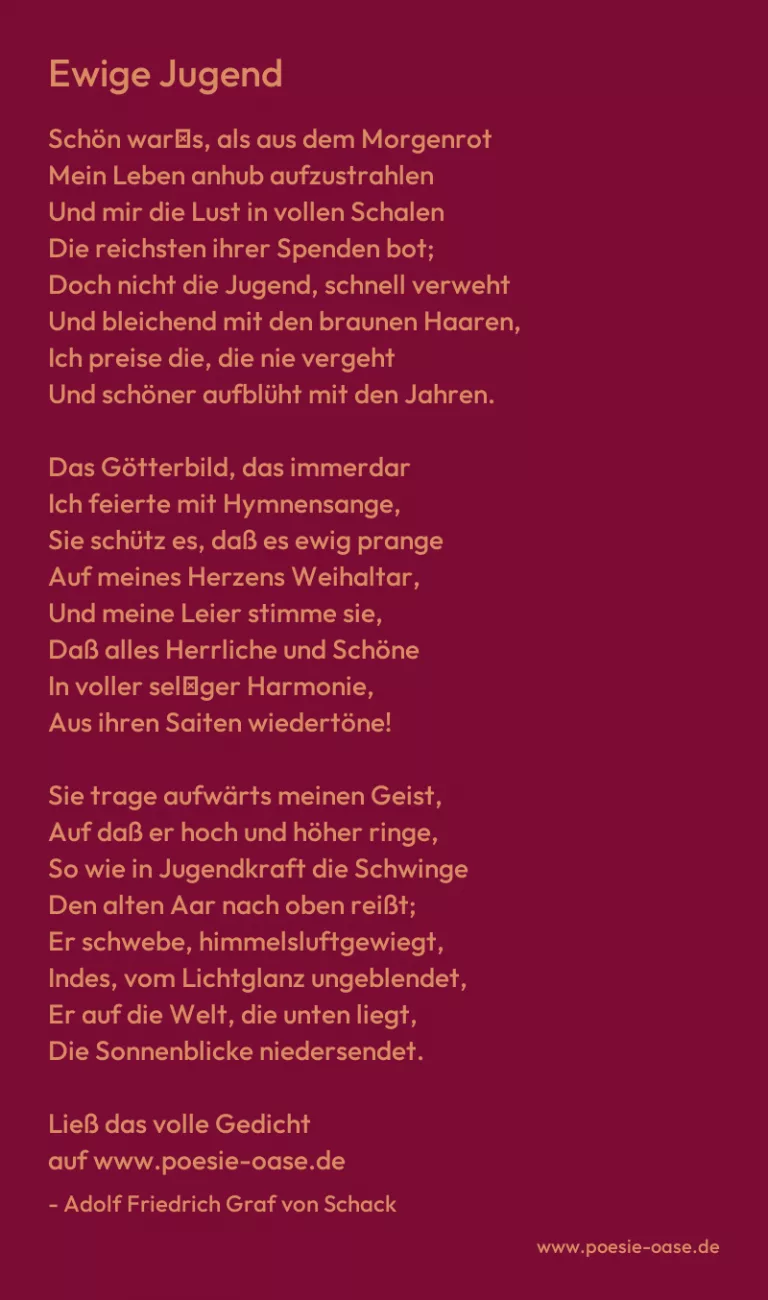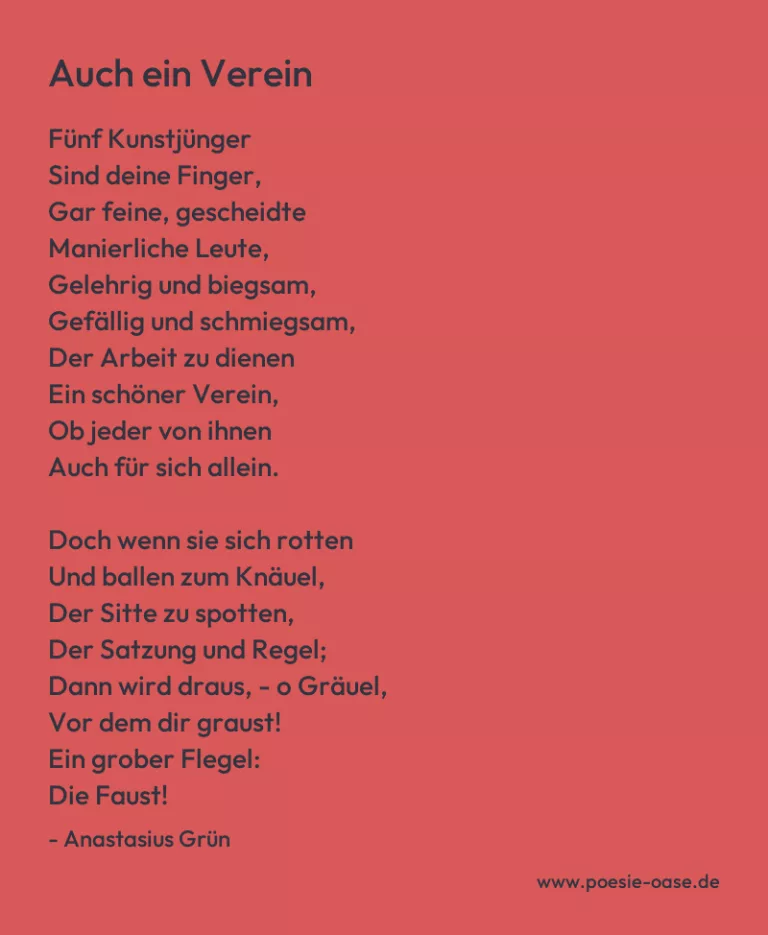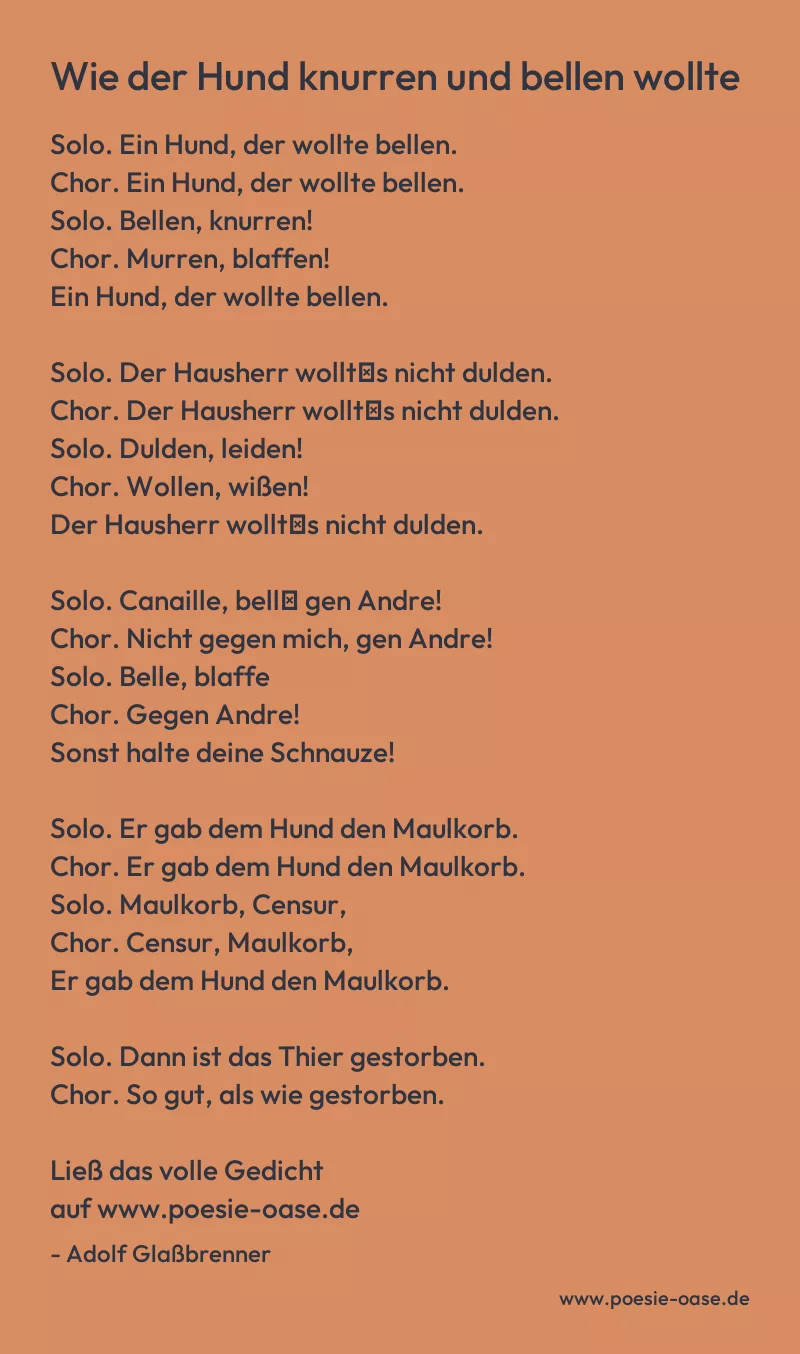Solo. Ein Hund, der wollte bellen.
Chor. Ein Hund, der wollte bellen.
Solo. Bellen, knurren!
Chor. Murren, blaffen!
Ein Hund, der wollte bellen.
Solo. Der Hausherr wollt′s nicht dulden.
Chor. Der Hausherr wollt′s nicht dulden.
Solo. Dulden, leiden!
Chor. Wollen, wißen!
Der Hausherr wollt′s nicht dulden.
Solo. Canaille, bell′ gen Andre!
Chor. Nicht gegen mich, gen Andre!
Solo. Belle, blaffe
Chor. Gegen Andre!
Sonst halte deine Schnauze!
Solo. Er gab dem Hund den Maulkorb.
Chor. Er gab dem Hund den Maulkorb.
Solo. Maulkorb, Censur,
Chor. Censur, Maulkorb,
Er gab dem Hund den Maulkorb.
Solo. Dann ist das Thier gestorben.
Chor. So gut, als wie gestorben.
Solo. Gestorben, verschieden,
Chor. Verrecket, crepiret,
Dann ist das Thier gestorben.
Solo. Sie setzten ihm ein Denkmal.
Chor. Natürlich wohl ein Denkmal.
Solo. Denkmal, Monument,
Chor. Grabstein, Leichenstein,
Sie setzten ihm ein Denkmal.
Solo. Darauf da stand geschrieben,
Chor. Darauf da stand geschrieben,
Solo. Gekritzelt, geklieret,
Chor. Gegraben, geschmieret,
Darauf da stand geschrieben:
Der arme Hund, der ist nun todt,
Den Hausherrn holt die Schwerenoth!
Wir wollen′s ihm hiermit nur sagen,
Daß wir nicht mehr den Maulkorb tragen!