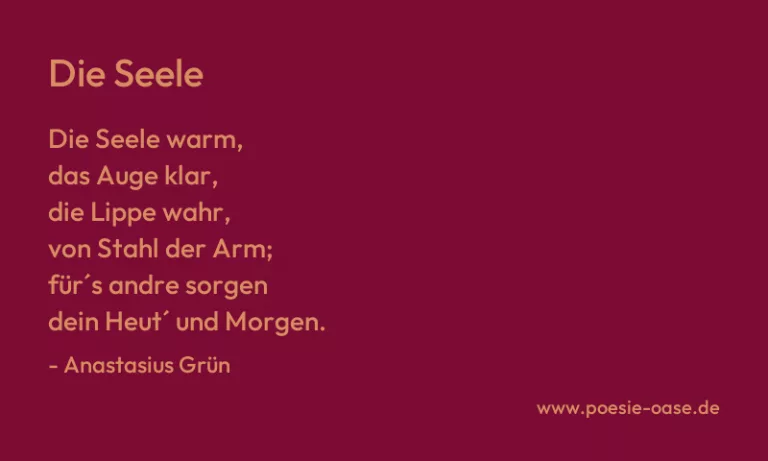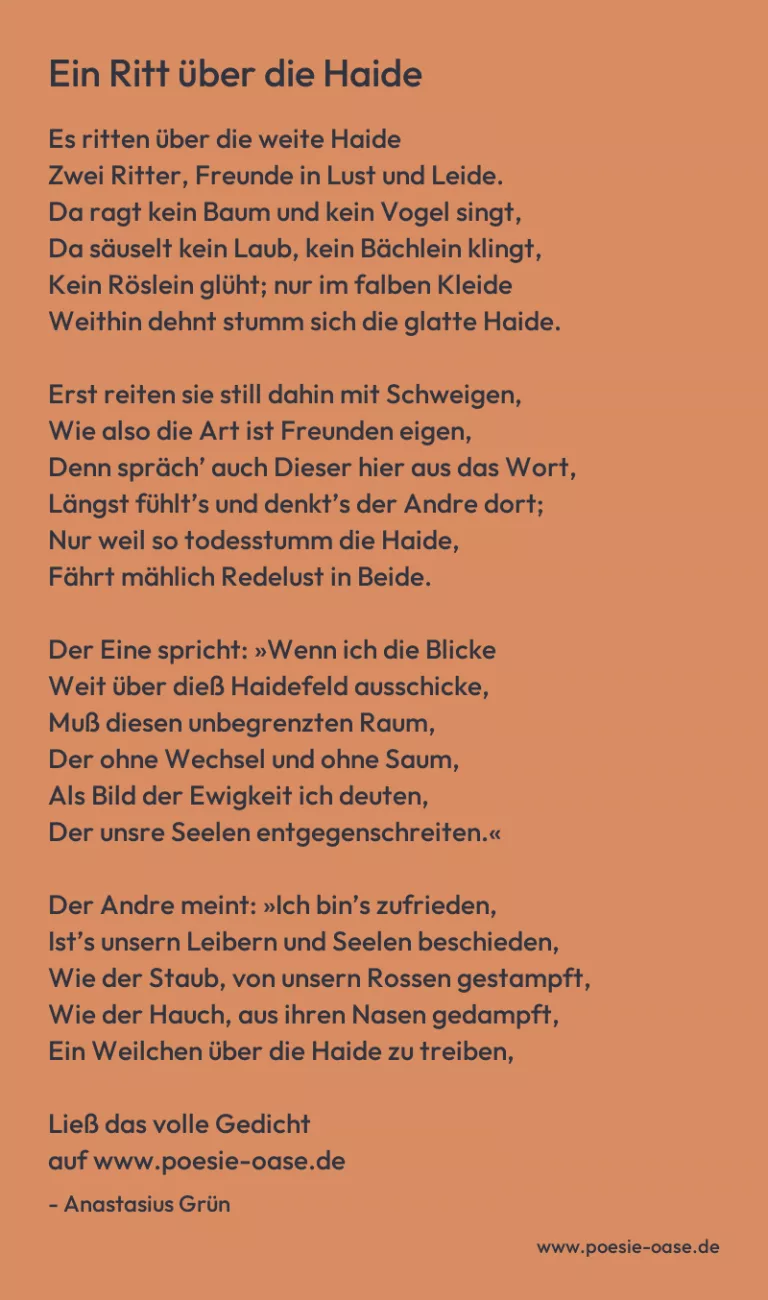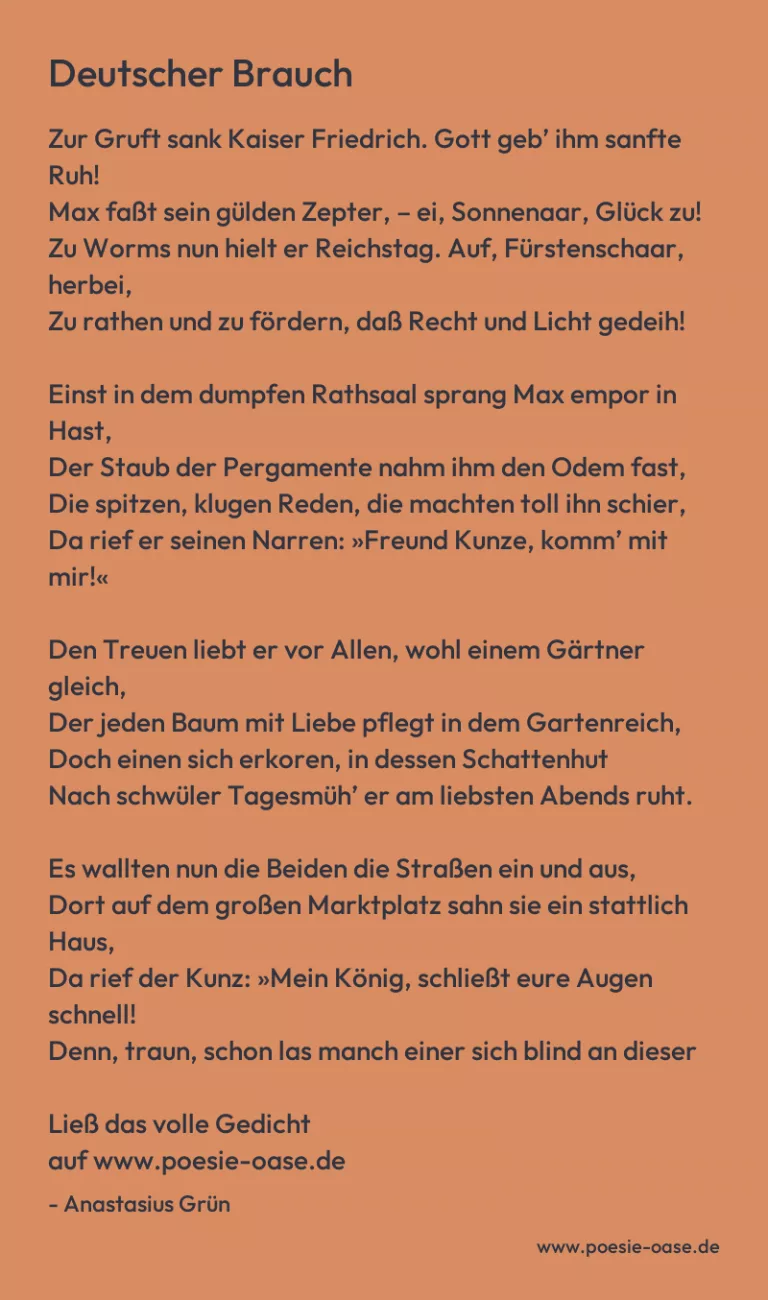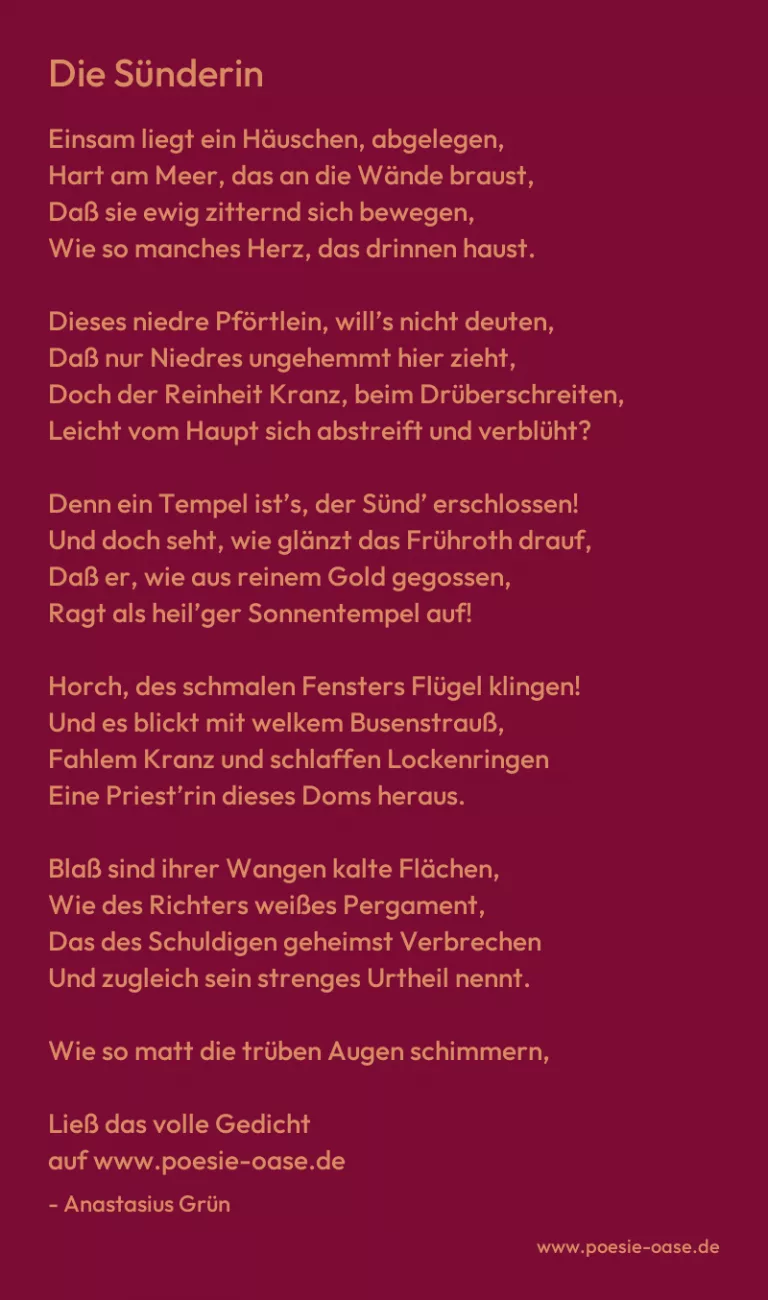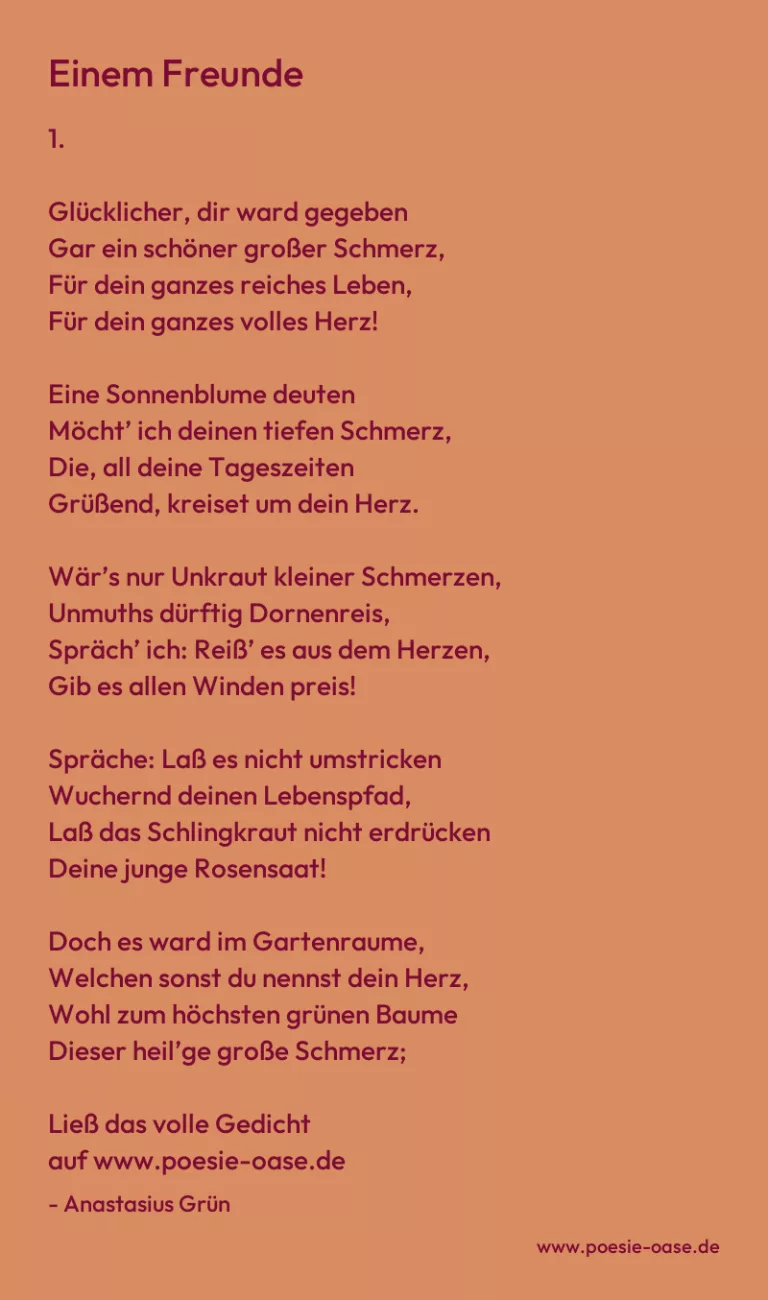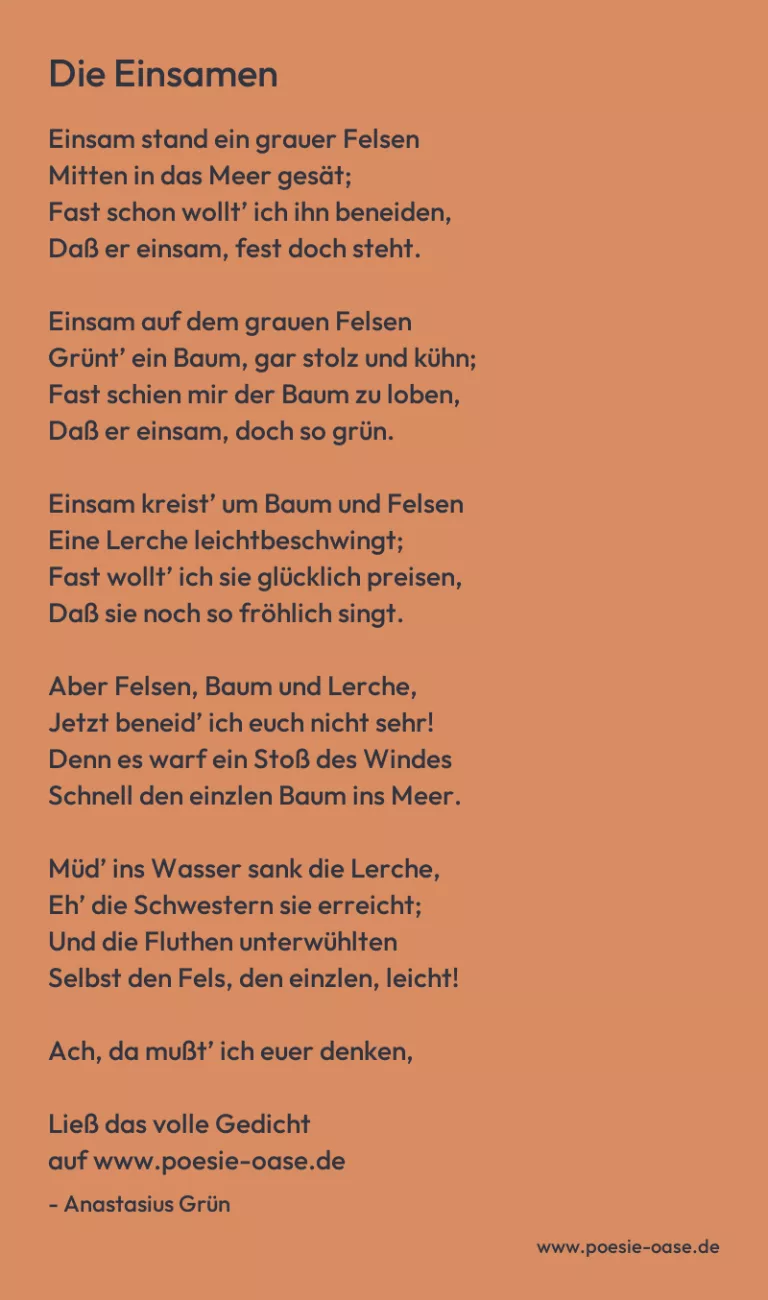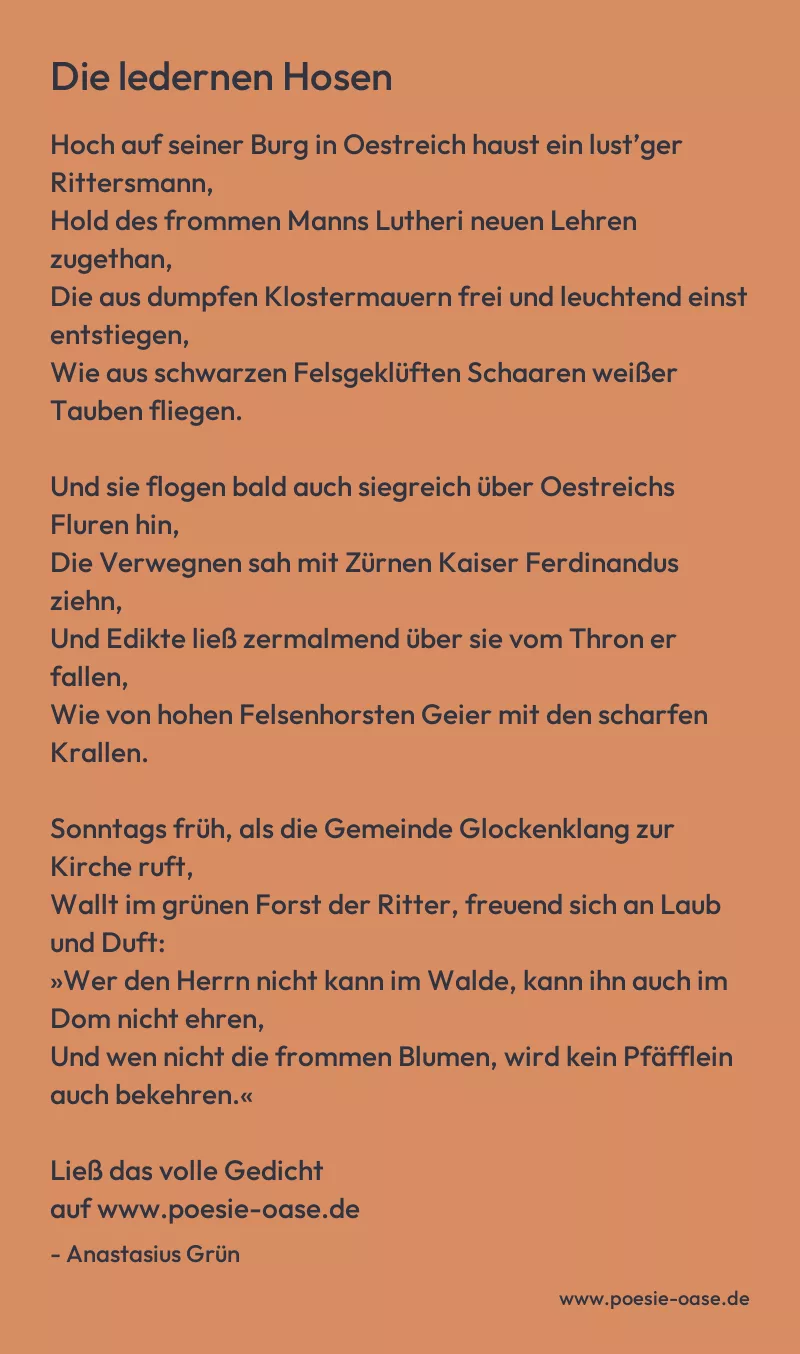Hoch auf seiner Burg in Oestreich haust ein lust’ger Rittersmann,
Hold des frommen Manns Lutheri neuen Lehren zugethan,
Die aus dumpfen Klostermauern frei und leuchtend einst entstiegen,
Wie aus schwarzen Felsgeklüften Schaaren weißer Tauben fliegen.
Und sie flogen bald auch siegreich über Oestreichs Fluren hin,
Die Verwegnen sah mit Zürnen Kaiser Ferdinandus ziehn,
Und Edikte ließ zermalmend über sie vom Thron er fallen,
Wie von hohen Felsenhorsten Geier mit den scharfen Krallen.
Sonntags früh, als die Gemeinde Glockenklang zur Kirche ruft,
Wallt im grünen Forst der Ritter, freuend sich an Laub und Duft:
»Wer den Herrn nicht kann im Walde, kann ihn auch im Dom nicht ehren,
Und wen nicht die frommen Blumen, wird kein Pfäfflein auch bekehren.«
Sieh, da rauscht’ aus Busch und Dickicht stolz ein Edelhirsch empor,
Doch es streckte schnell zu Boden ihn des Ritters Feuerrohr:
»Wer da zu Mittag des Sonntags seinen Braten will genießen,
Ei, der wird dazu das Wildpret doch wohl auch sich dürfen schießen.«
Als der Ritter kehrt zum Schlosse, steht der Pfarrer vor dem Thor,
Stolz, wie im Triumphe, haltend hoch ein Pergament empor:
»Wer des Sonntags, statt der Messe, Feld- und Waidwerks sich beflissen,
Soll’s mit hundert Golddukaten in den Schatz des Kaisers büßen!
Während ihr in Wäldern Hirsche, oder Böcke schießt vielmehr,
Ward verkündet von der Kanzel dieß Edikt so inhaltschwer.
Mögt verzeihen, edler Ritter, wenn ich’s euch bedauernd sage,
Daß das Meß- und Predigtschwänzen selten goldne Früchte trage!«
»Dießmal,« sprach der Ritter lächelnd, »trug’s doch Gold, wenn auch nicht mir!
Doch mir bleibt die Haut des Hirsches: im Edikt steht nichts von ihr!
Heil dem übergnäd’gen Kaiser, der uns doch die Haut will lassen!
Seht, vielleicht zu einem Wamse oder sonst was kann sie passen!« – –
Einst nach Jahren, als der Kaiser heim von ernster Fahrt gekehrt,
Lud er vor den Thron zu Hofe seine Edlen, treu und werth:
Jeder mög’ in seinem Kleide dann des Landes Farben führen,
Oder sonst mit seinem schönsten, köstlichsten Gewand sich zieren!
In dem Kaisersaale wimmelt’s von Gewändern, roth und weiß,
Sammt und Perlen, Gold und Demant glühn und strahlen rings im Kreis,
Drüberhin mit Wohlbehagen scheint des Kaisers Aug’ zu wallen,
Aber plötzlich ernst und zürnend läßt auf Einen er es fallen.
Und er ruft dann halb mit Lächeln, halb mit droh’ndem Ungestüm:
»Seht, ihr Herrn, doch dort den Bauer und sein Hosenungethüm!
Traun, die gelben Lederhosen reichen fast ihm bis zum Kragen!
Freund, warum willst du des Landes oder meine Farb’ nicht tragen?«
»Herr, weil ihr zu oft sie wechselt!« spricht der Ritter drauf mit Muth,
»Doch des Landes Farben passen für uns Bauernvolk nicht gut!
Vor dem rothen grellen Kleide würden scheu uns alle Stiere,
Und das zarte Weiß stets fürchtet, daß es Gras und Laub beschmiere.
In den theuersten Gewändern, Herr, beschied man uns heran,
Drum die köstlichste und schönste meiner Hosen zog ich an,
Denn mit hundert goldnen Füchsen mußt’ ich sie euch selbst bezahlen.
Wer noch kann mit solcher Hose und mit solchem Schneider prahlen?« –
Wackrer Ritter, aus dem Himmel blickst du nun auf ird’schen Kram,
Wo so gänzlich aus der Mode deine Lederhose kam,
Wo in Seid’ und Sammt wir prunken! – Lächelnd doch siehst du die Gecken
Unbewußt, bis an den Kragen, tief in Lederhosen stecken.