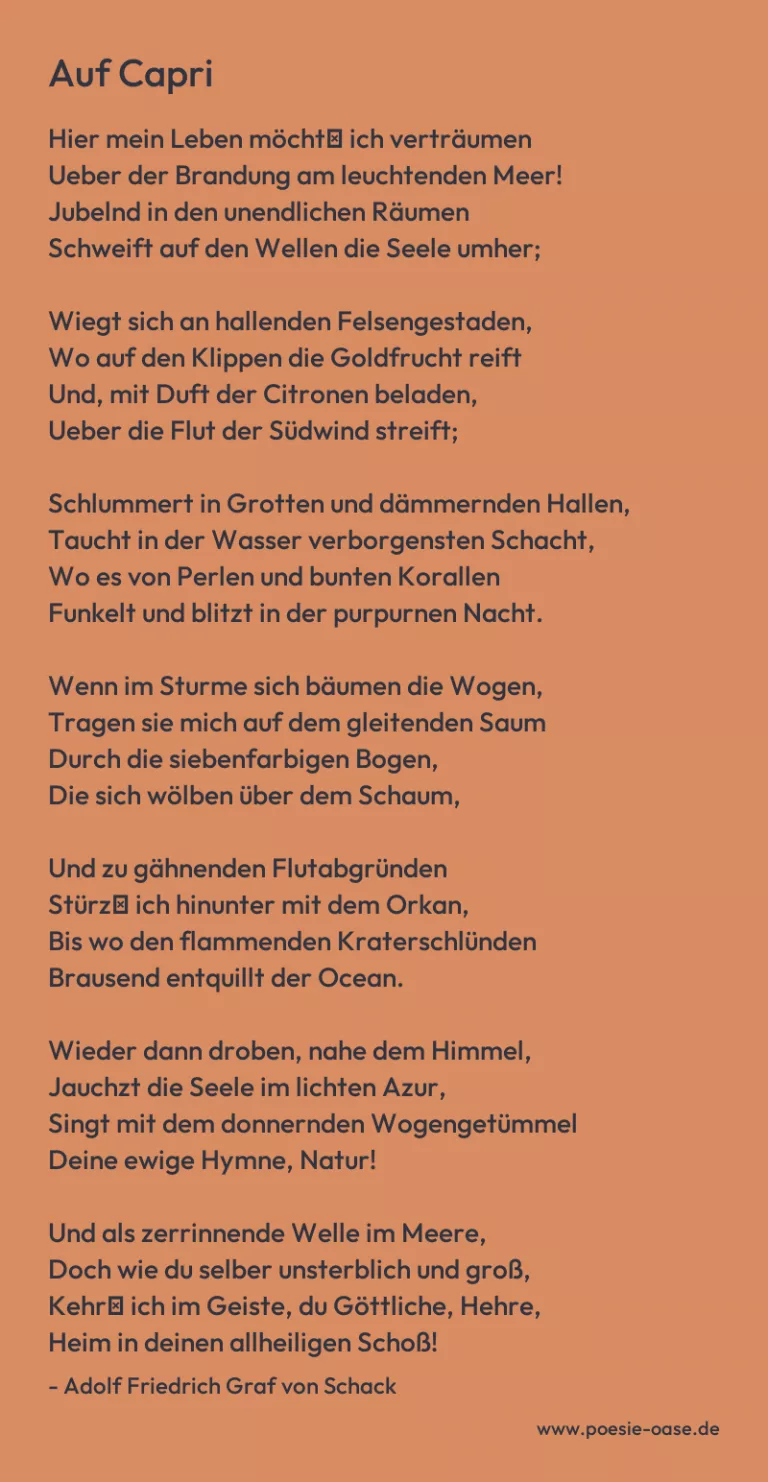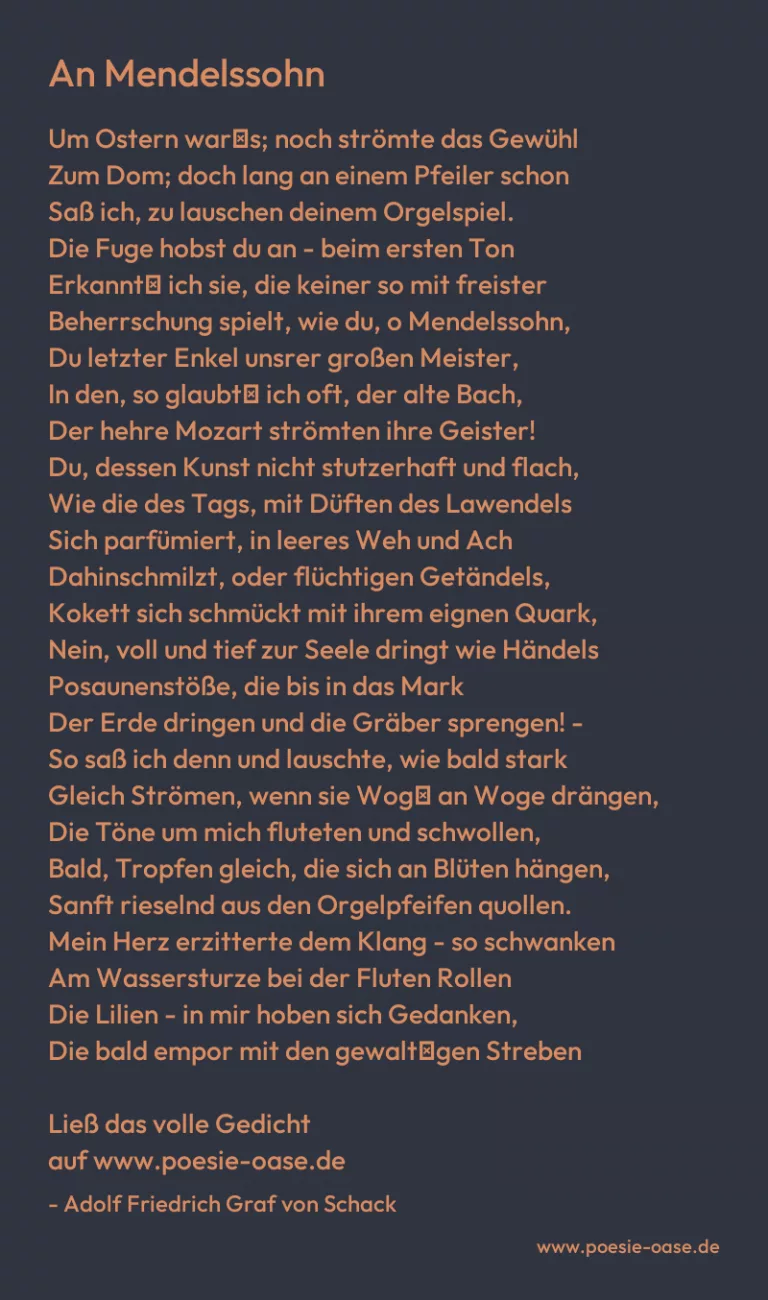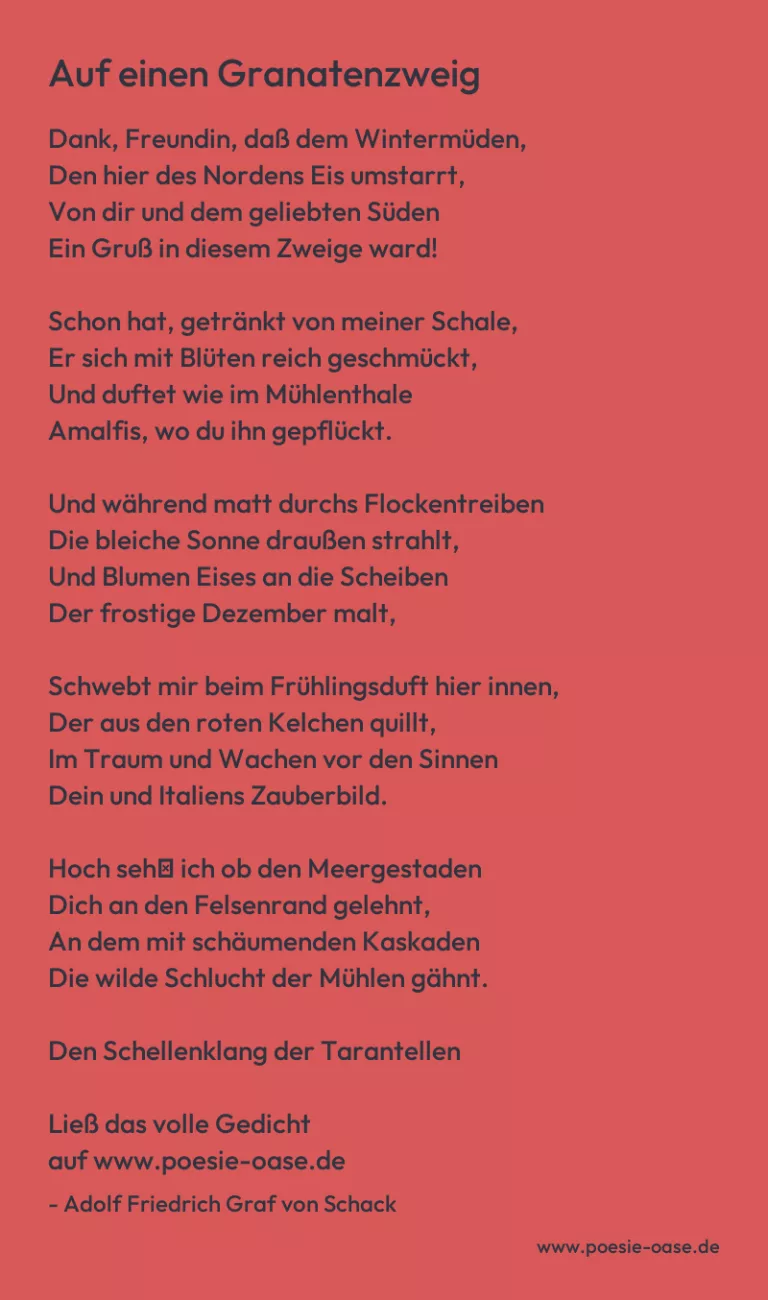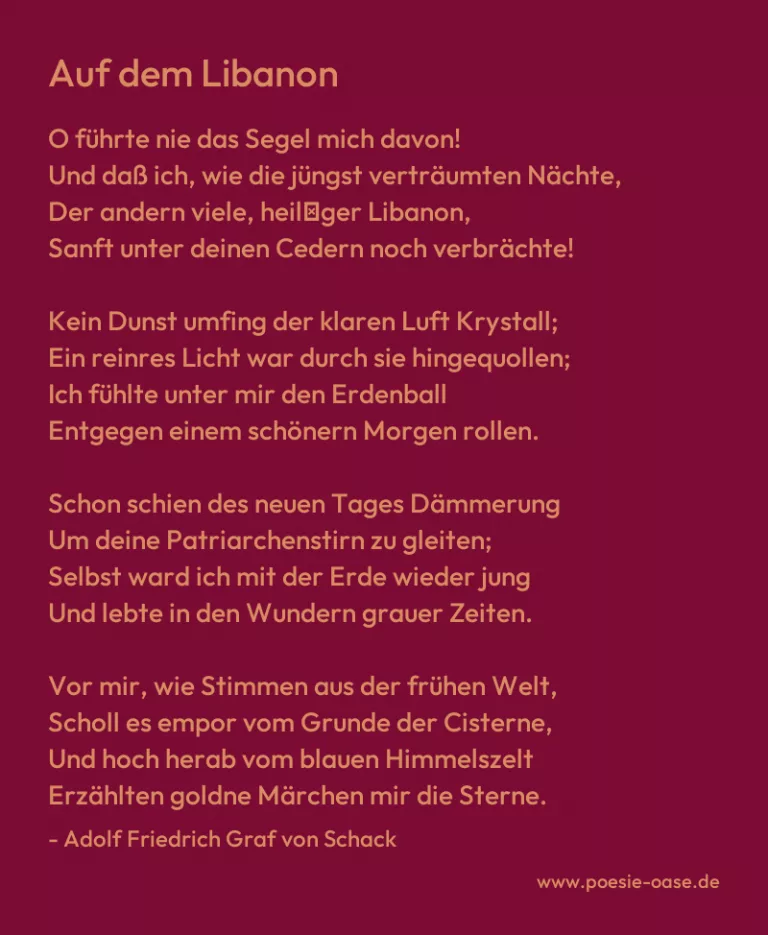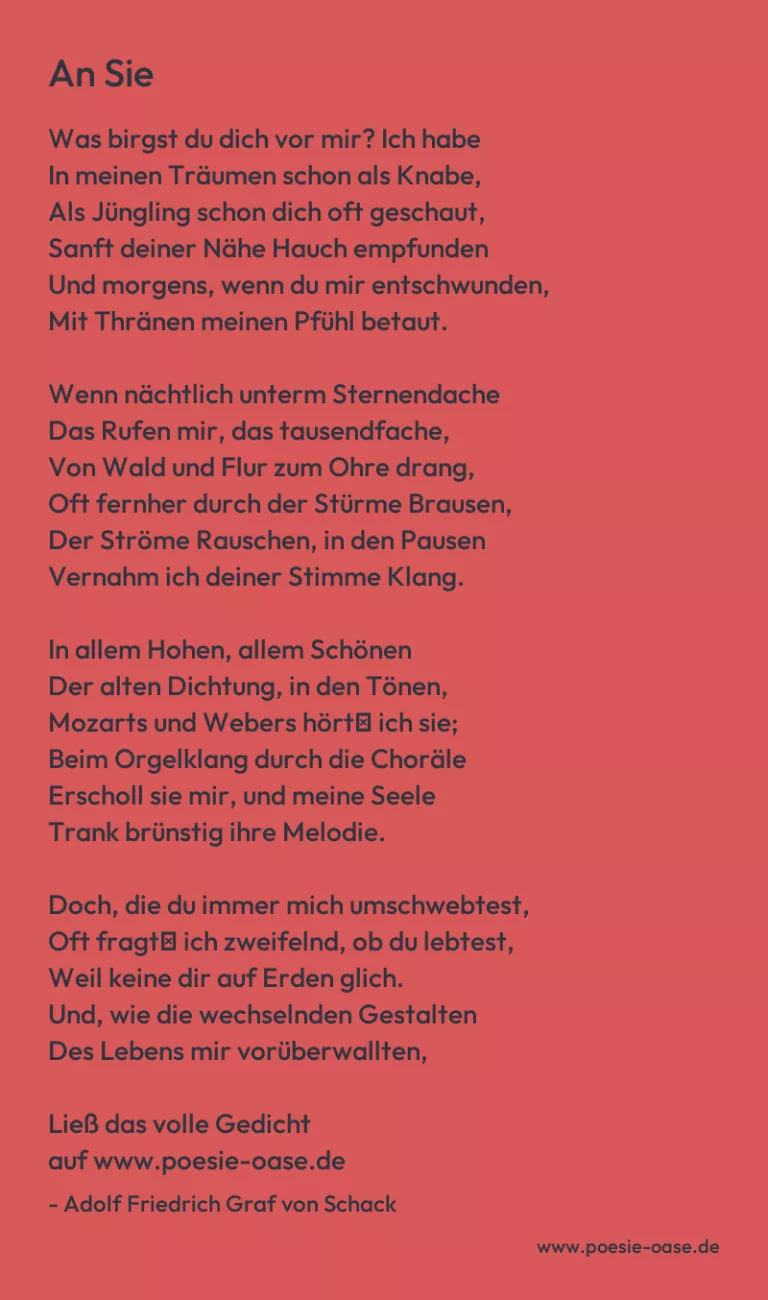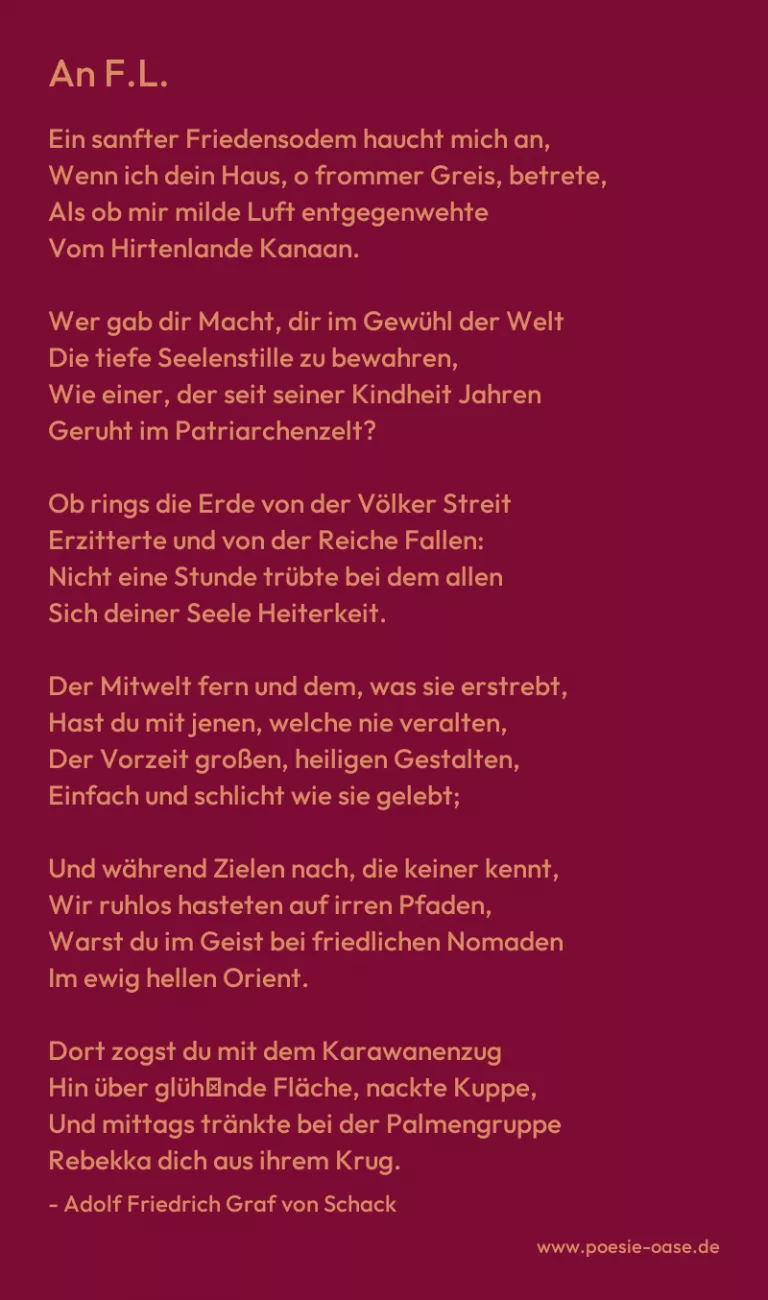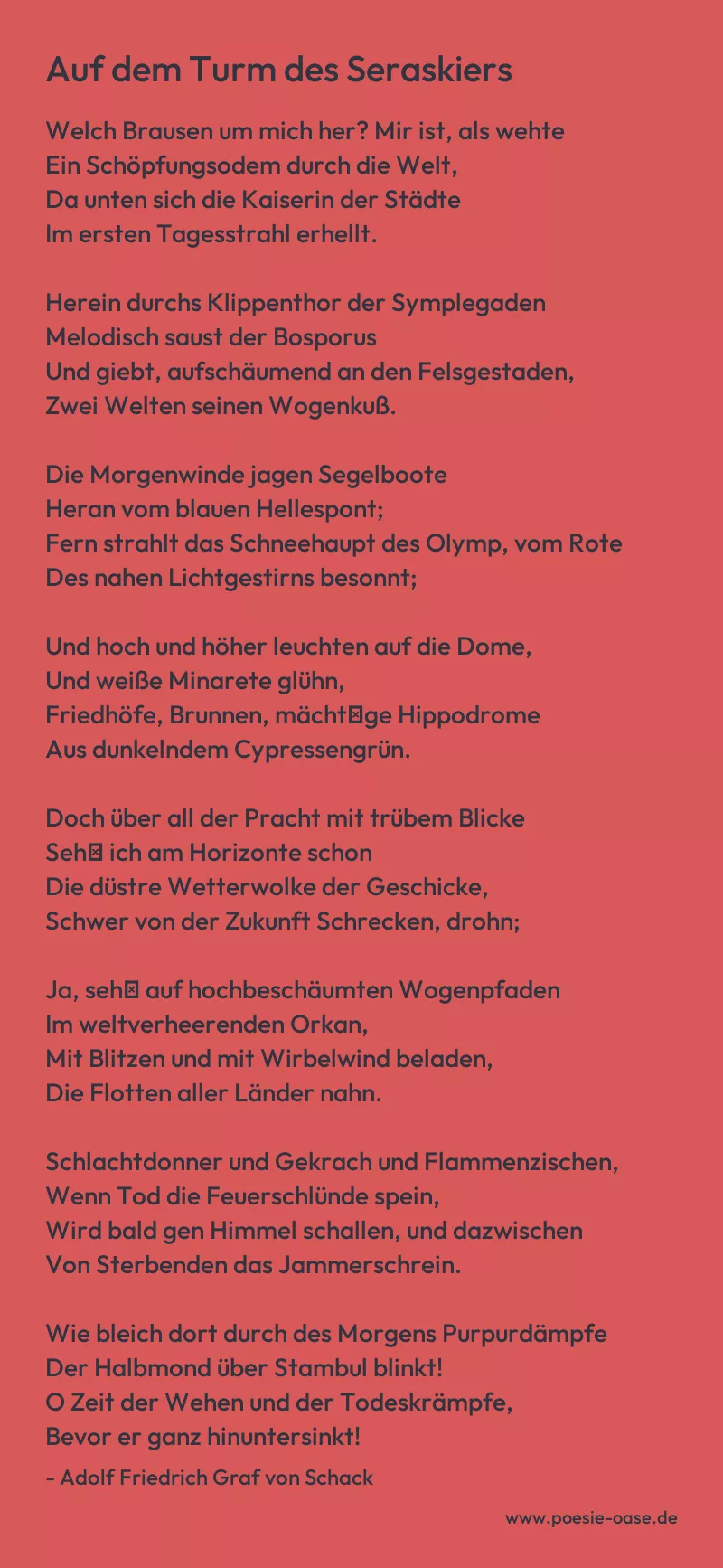Welch Brausen um mich her? Mir ist, als wehte
Ein Schöpfungsodem durch die Welt,
Da unten sich die Kaiserin der Städte
Im ersten Tagesstrahl erhellt.
Herein durchs Klippenthor der Symplegaden
Melodisch saust der Bosporus
Und giebt, aufschäumend an den Felsgestaden,
Zwei Welten seinen Wogenkuß.
Die Morgenwinde jagen Segelboote
Heran vom blauen Hellespont;
Fern strahlt das Schneehaupt des Olymp, vom Rote
Des nahen Lichtgestirns besonnt;
Und hoch und höher leuchten auf die Dome,
Und weiße Minarete glühn,
Friedhöfe, Brunnen, mächt′ge Hippodrome
Aus dunkelndem Cypressengrün.
Doch über all der Pracht mit trübem Blicke
Seh′ ich am Horizonte schon
Die düstre Wetterwolke der Geschicke,
Schwer von der Zukunft Schrecken, drohn;
Ja, seh′ auf hochbeschäumten Wogenpfaden
Im weltverheerenden Orkan,
Mit Blitzen und mit Wirbelwind beladen,
Die Flotten aller Länder nahn.
Schlachtdonner und Gekrach und Flammenzischen,
Wenn Tod die Feuerschlünde spein,
Wird bald gen Himmel schallen, und dazwischen
Von Sterbenden das Jammerschrein.
Wie bleich dort durch des Morgens Purpurdämpfe
Der Halbmond über Stambul blinkt!
O Zeit der Wehen und der Todeskrämpfe,
Bevor er ganz hinuntersinkt!