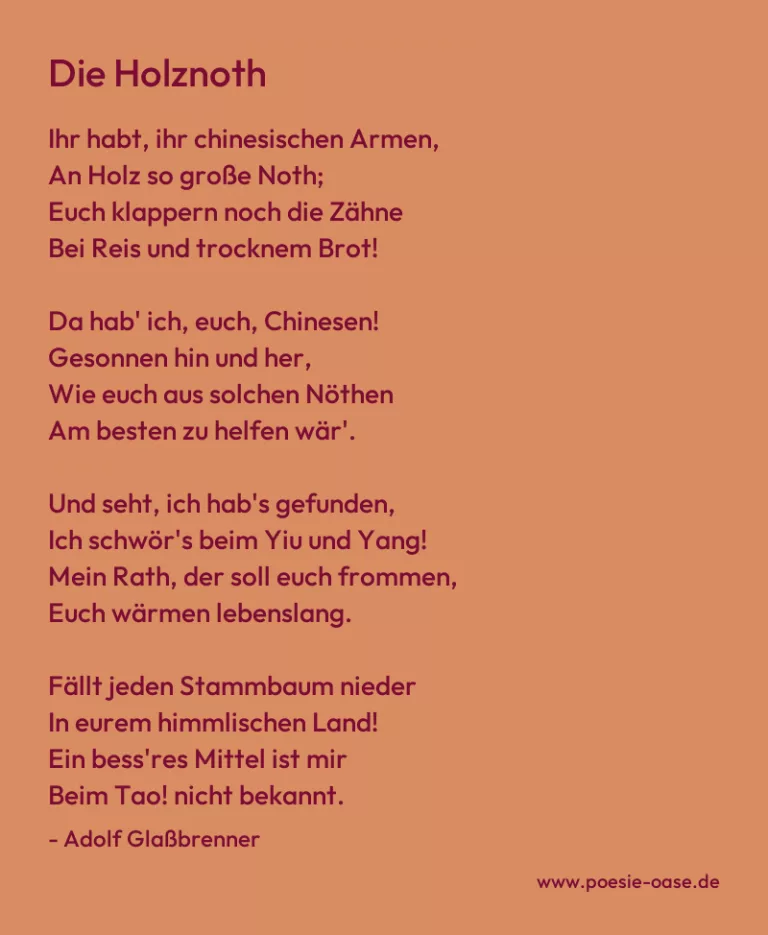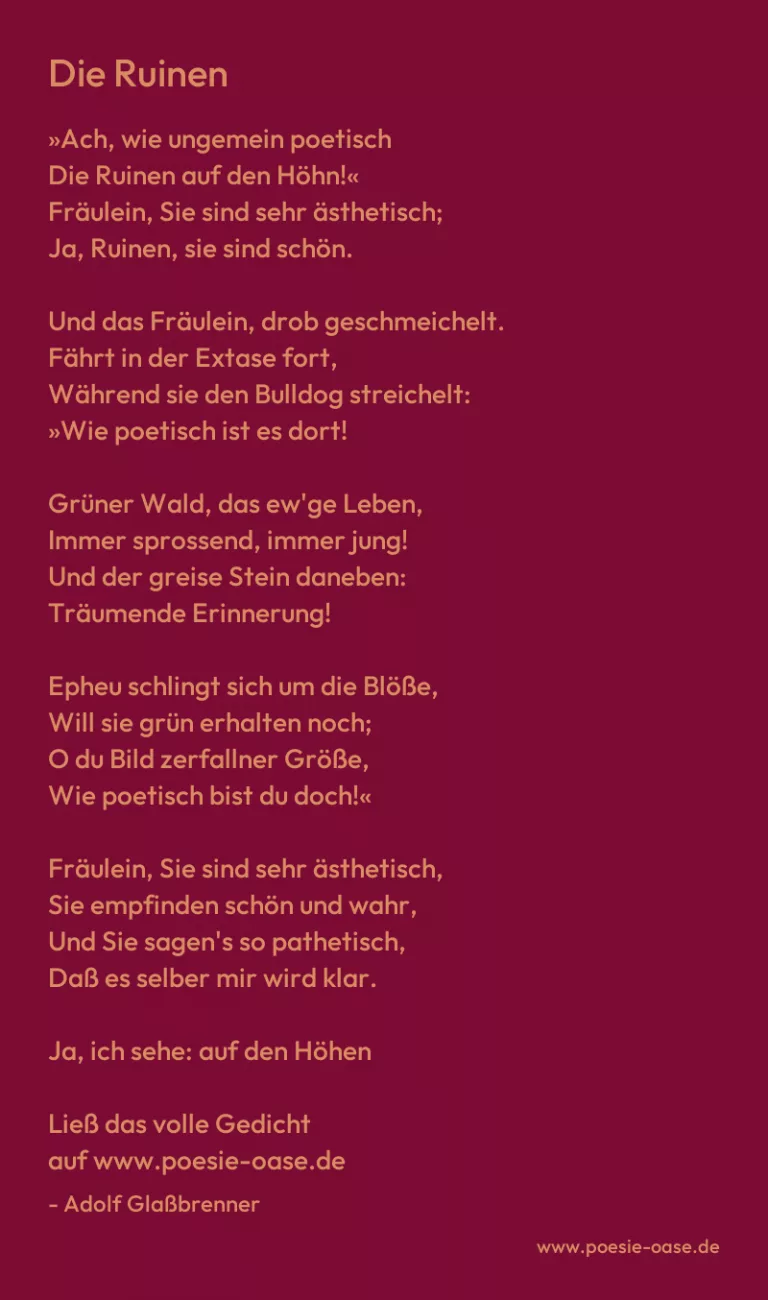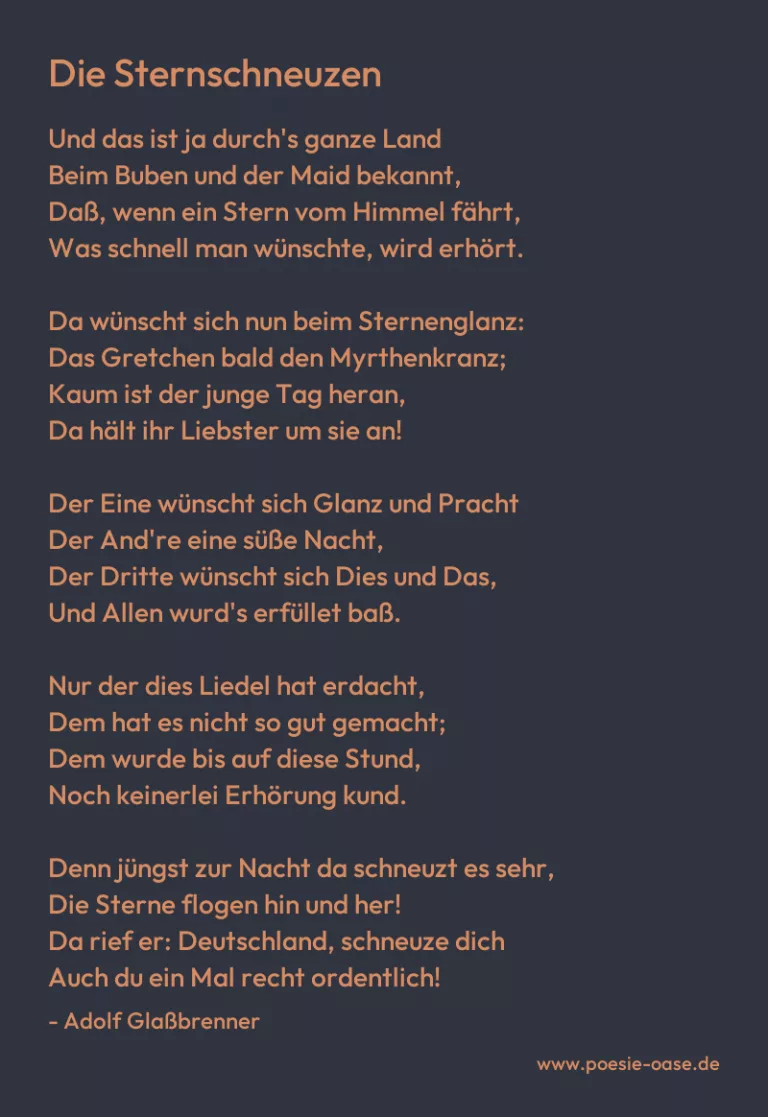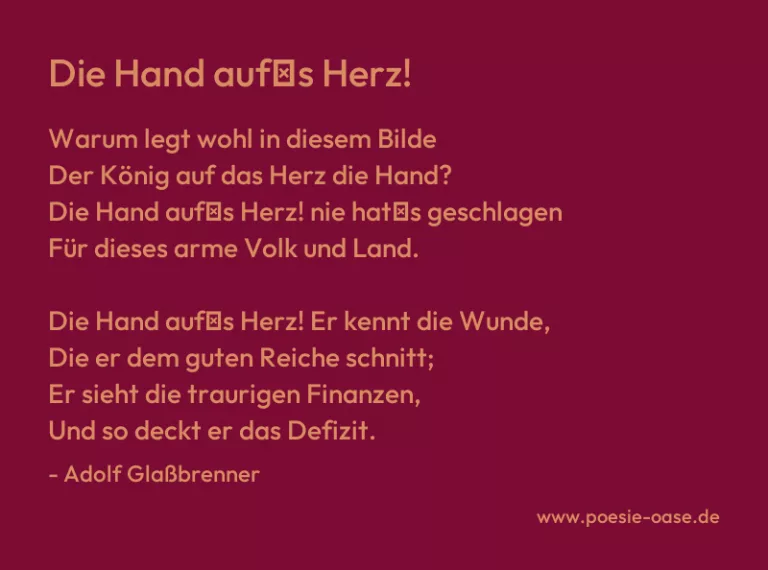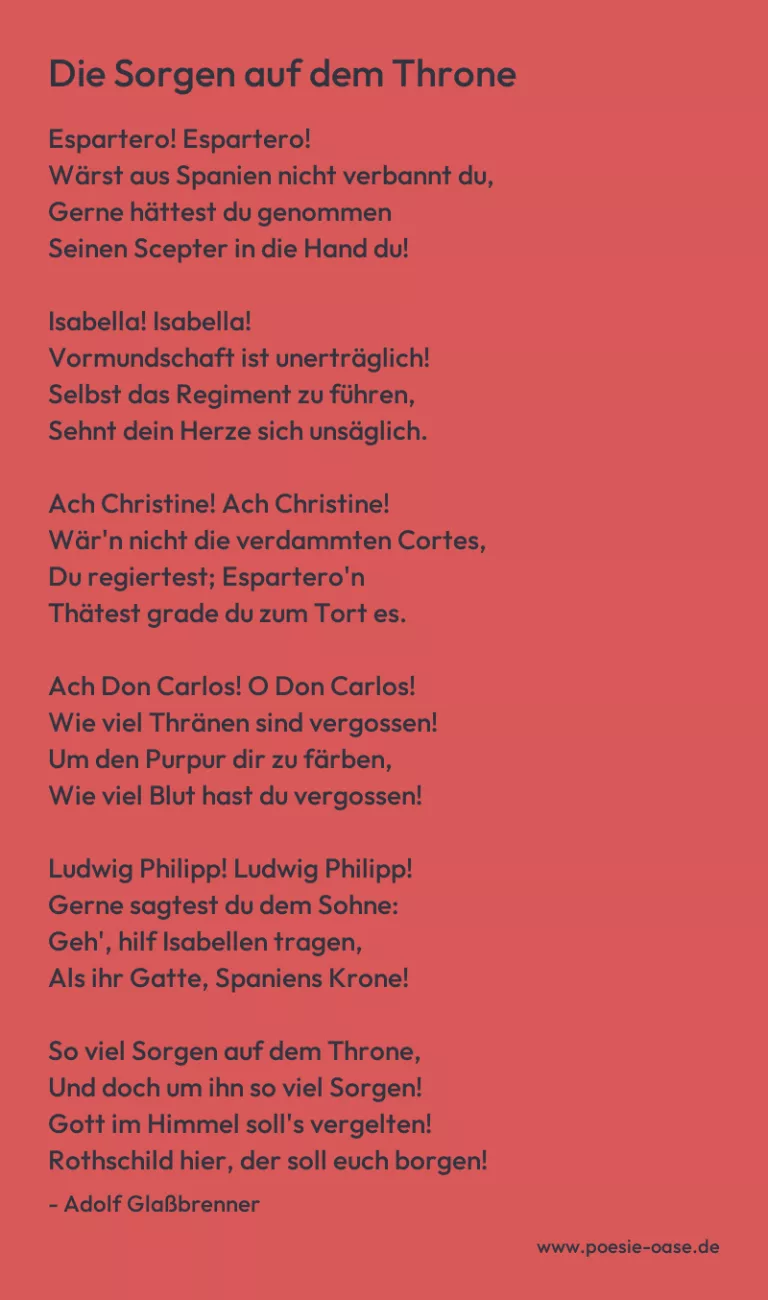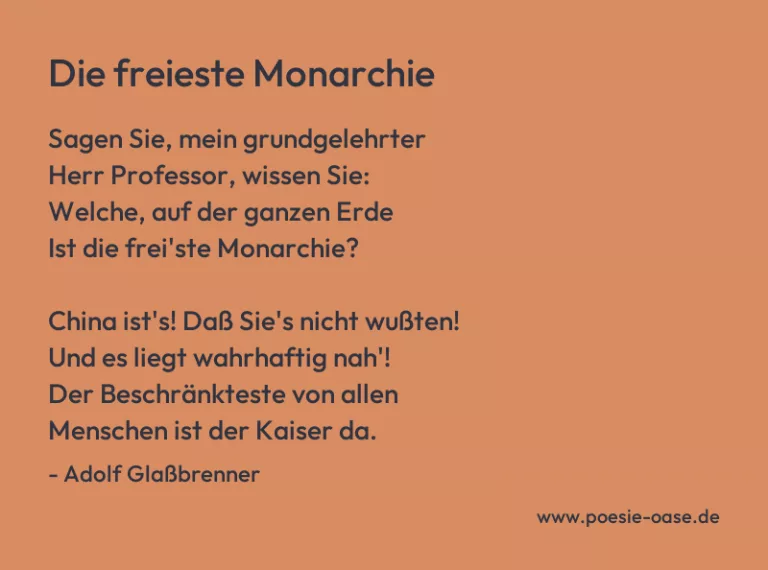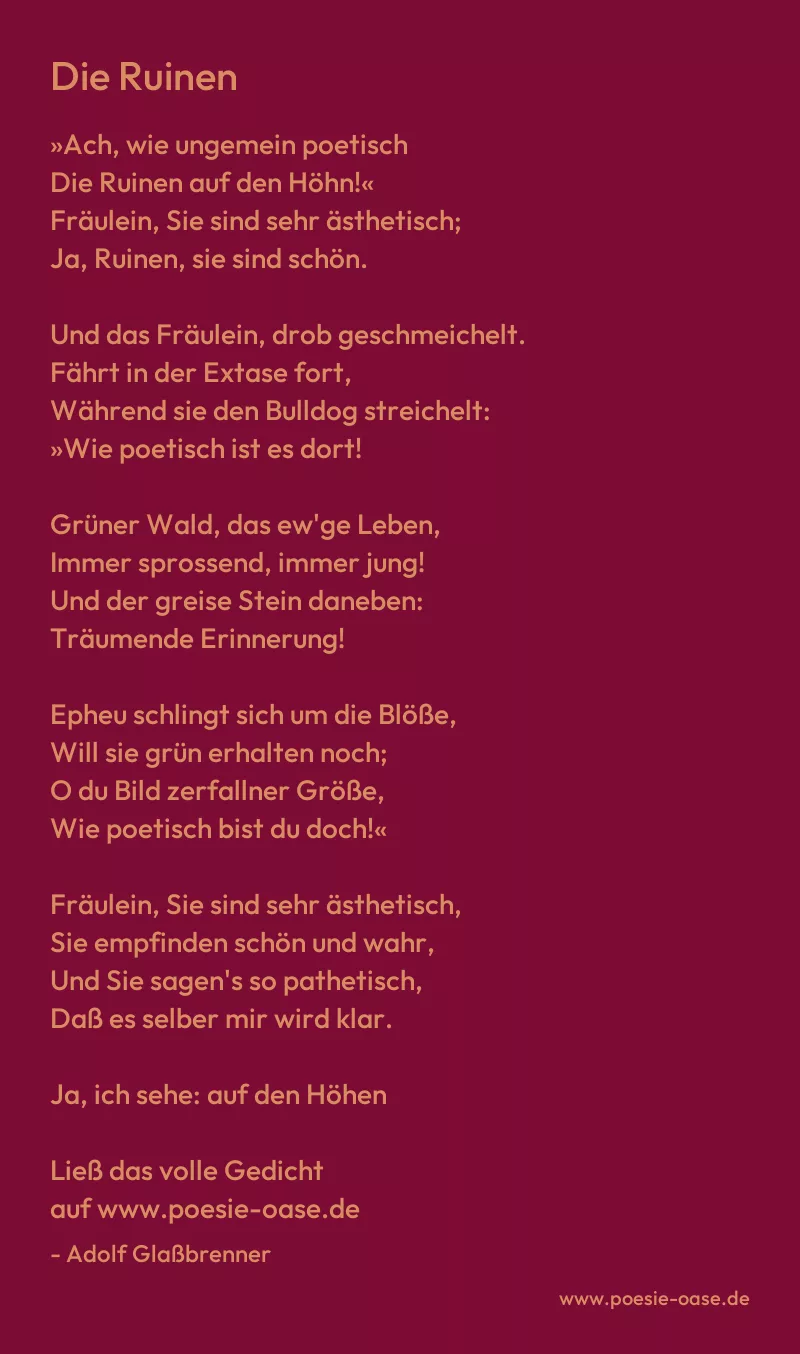»Ach, wie ungemein poetisch
Die Ruinen auf den Höhn!«
Fräulein, Sie sind sehr ästhetisch;
Ja, Ruinen, sie sind schön.
Und das Fräulein, drob geschmeichelt.
Fährt in der Extase fort,
Während sie den Bulldog streichelt:
»Wie poetisch ist es dort!
Grüner Wald, das ew’ge Leben,
Immer sprossend, immer jung!
Und der greise Stein daneben:
Träumende Erinnerung!
Epheu schlingt sich um die Blöße,
Will sie grün erhalten noch;
O du Bild zerfallner Größe,
Wie poetisch bist du doch!«
Fräulein, Sie sind sehr ästhetisch,
Sie empfinden schön und wahr,
Und Sie sagen’s so pathetisch,
Daß es selber mir wird klar.
Ja, ich sehe: auf den Höhen
Sind nur noch Ruinen da!
Wo die alten Zwinger stehen,
Rauscht der Wald Hallelujah!
In die Burgen der Tyrannen
Drang der Geist zerstörend ein,
Trieb die Räuberbrut von dannen,
Warf hinunter Stein auf Stein.
Heil’ger Geist, du ein’ge Dreiheit,
Gott im Menschen, habe Dank!
Auf den Bergen nur ist Freiheit!
Nur im Thal herrscht noch der Zwang.
Heiser schreien dort die Raben
Um den Schutt der Tyrannei,
Ihre Knochen sind begraben,
Und der Geist, der Geist ist frei!
Ja, mein Fräulein, Gottvertrauend
Schau‘ ich auf die stolzen Höhn!
Hochpoetisch, Herzerbauend
Sind Ruinen, wunderschön!
Wunderschön die düstern Mienen
Durch das grüne Laubgewind!
Doch das Schönste an Ruinen
Ist, daß sie Ruinen sind.