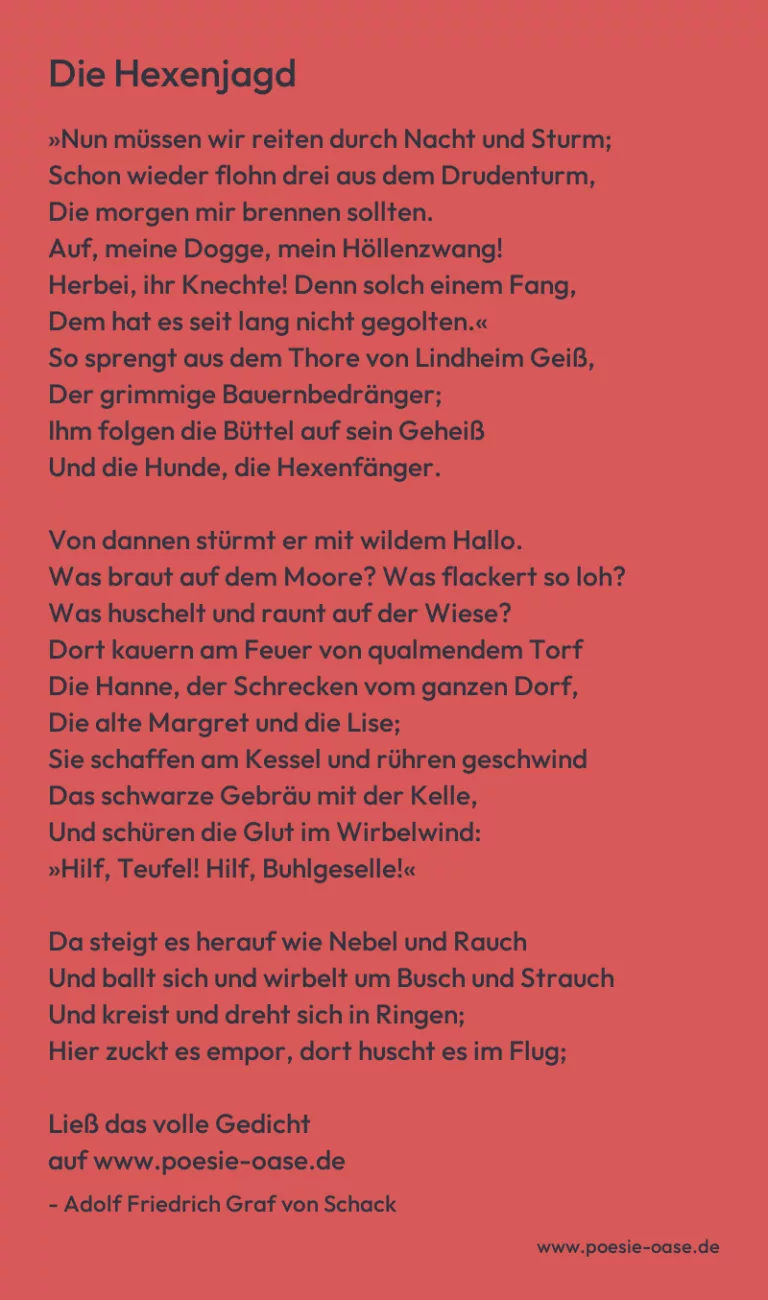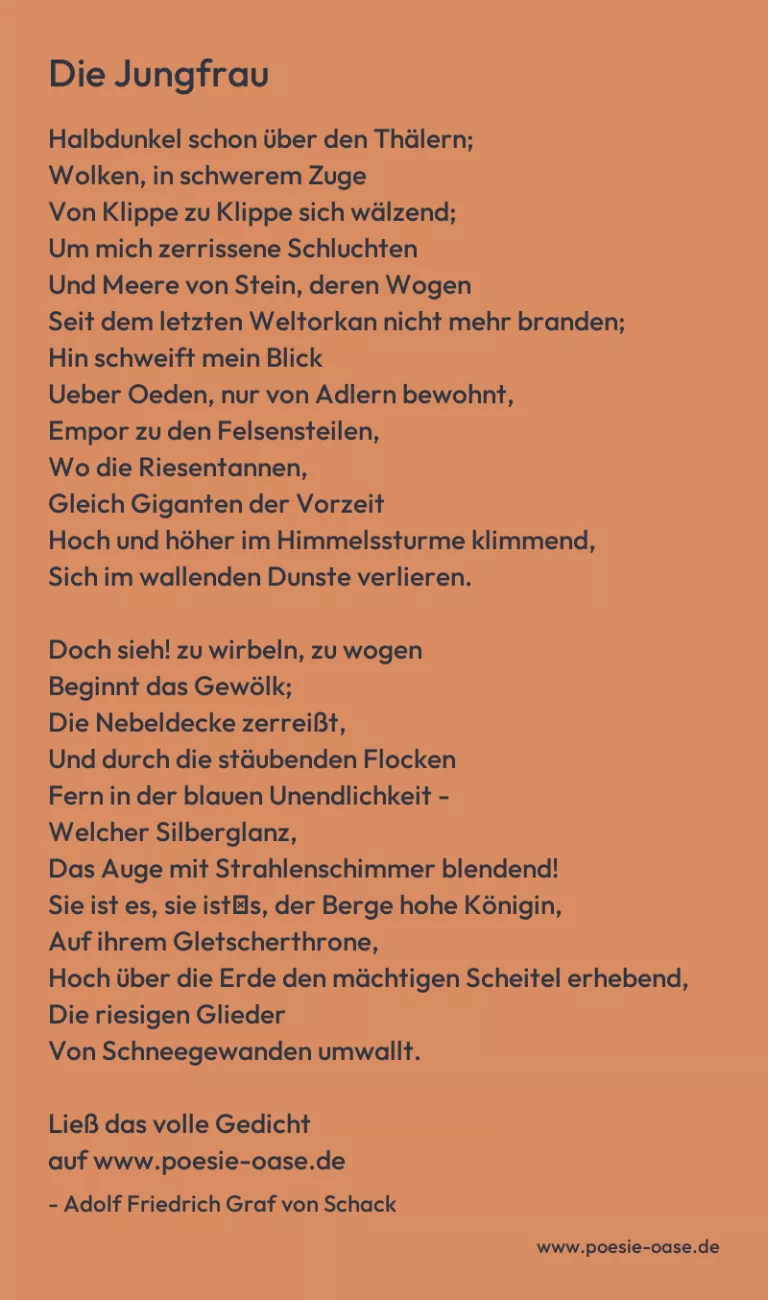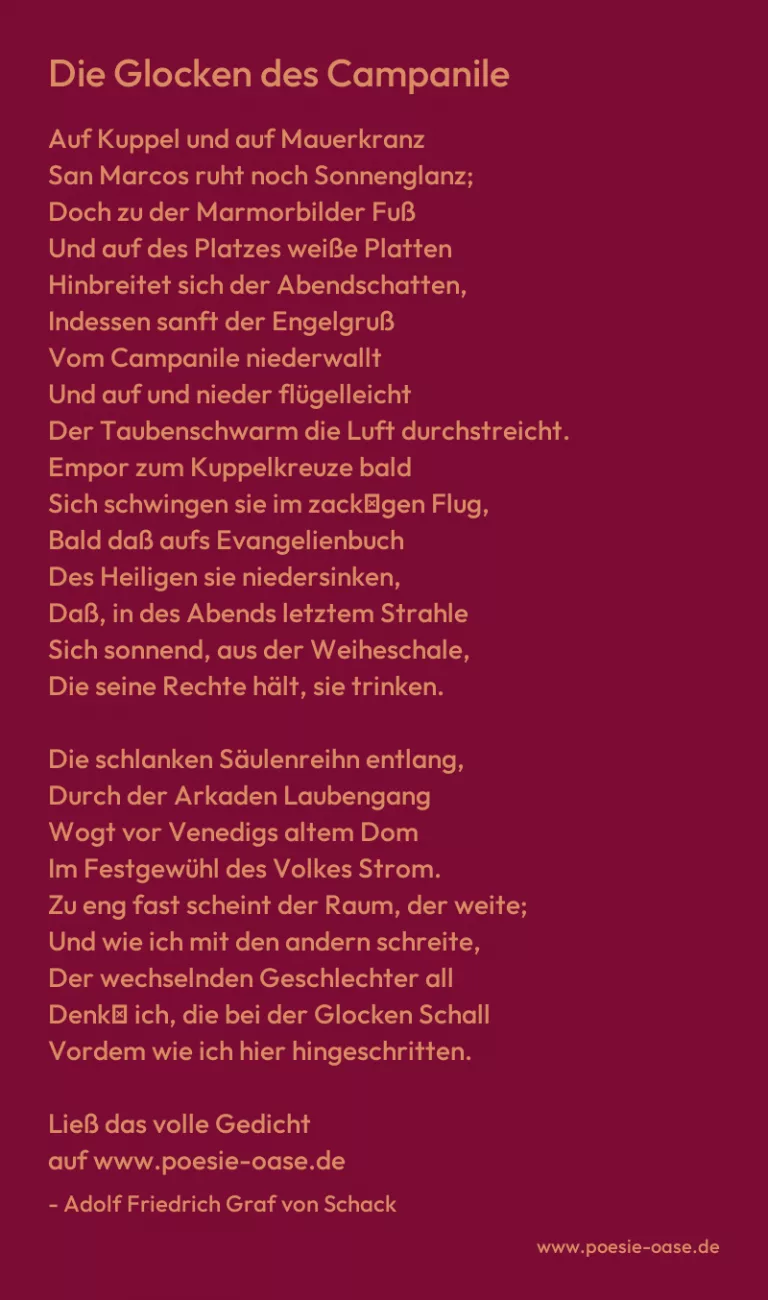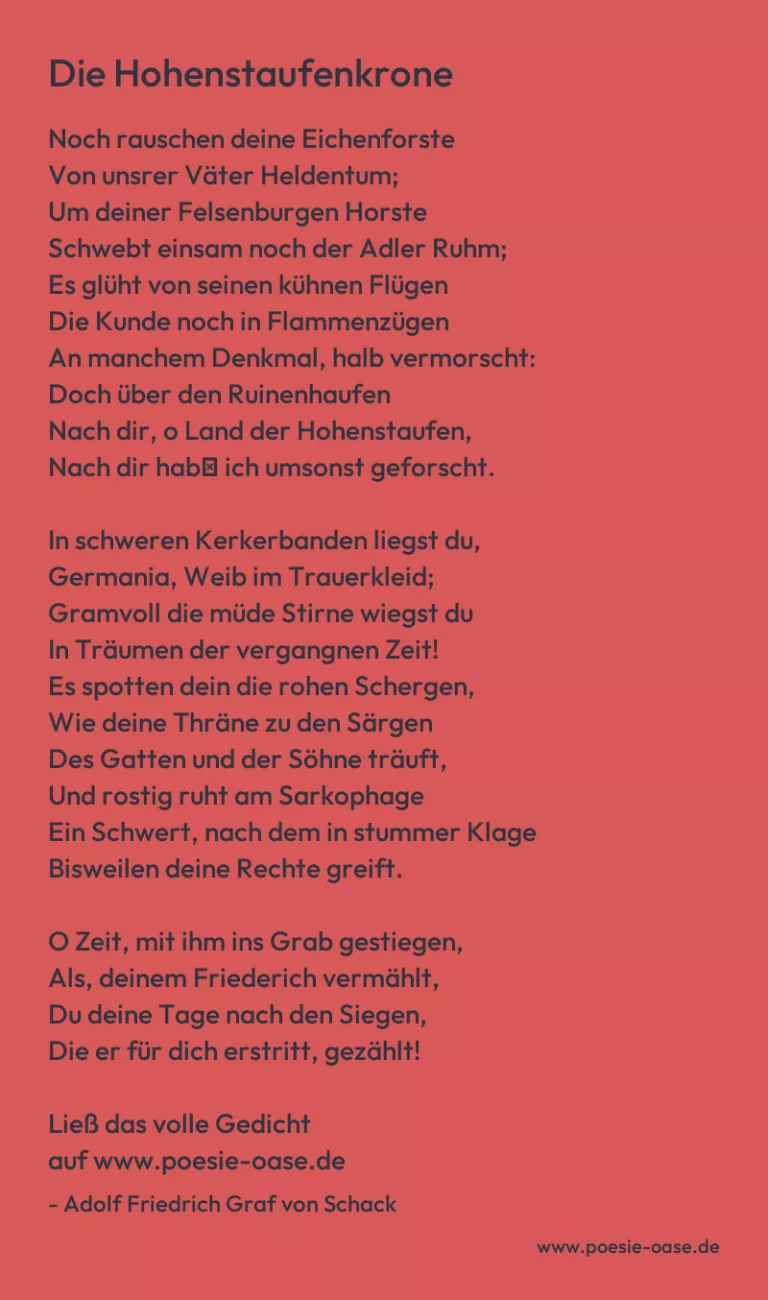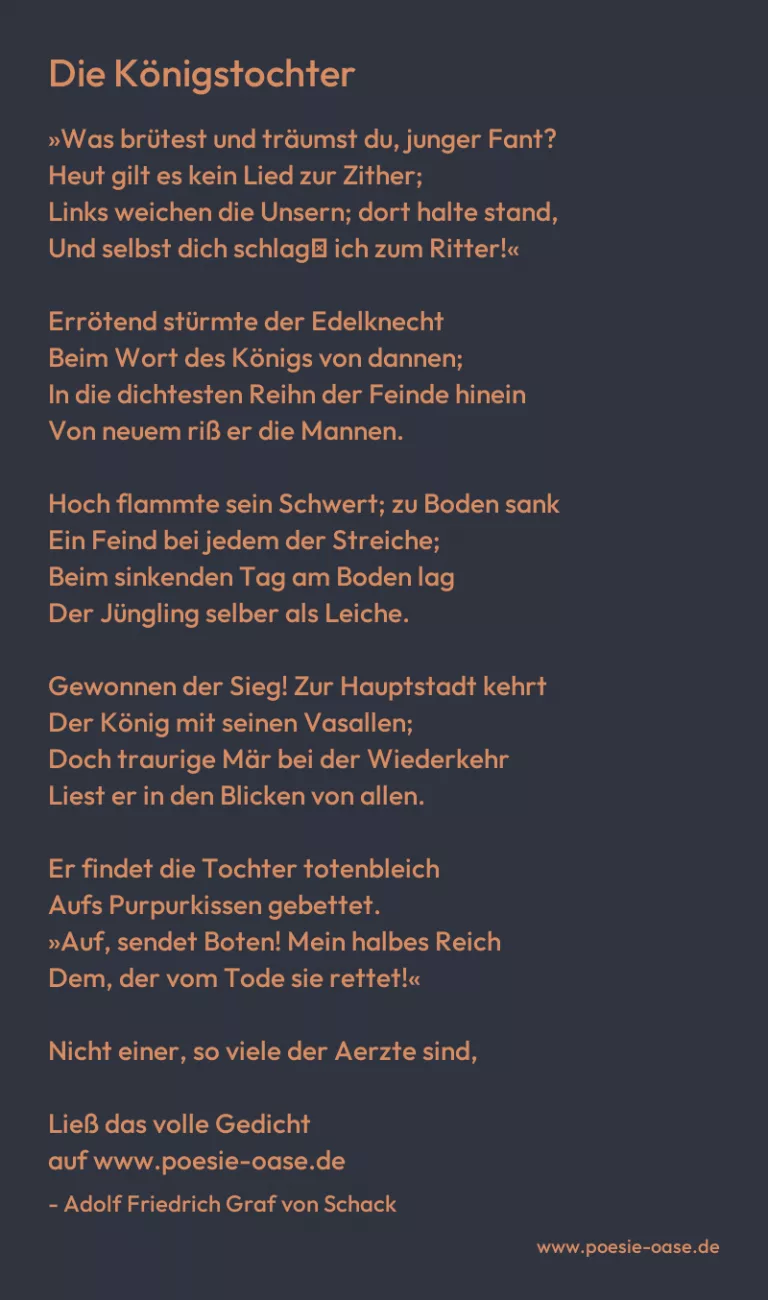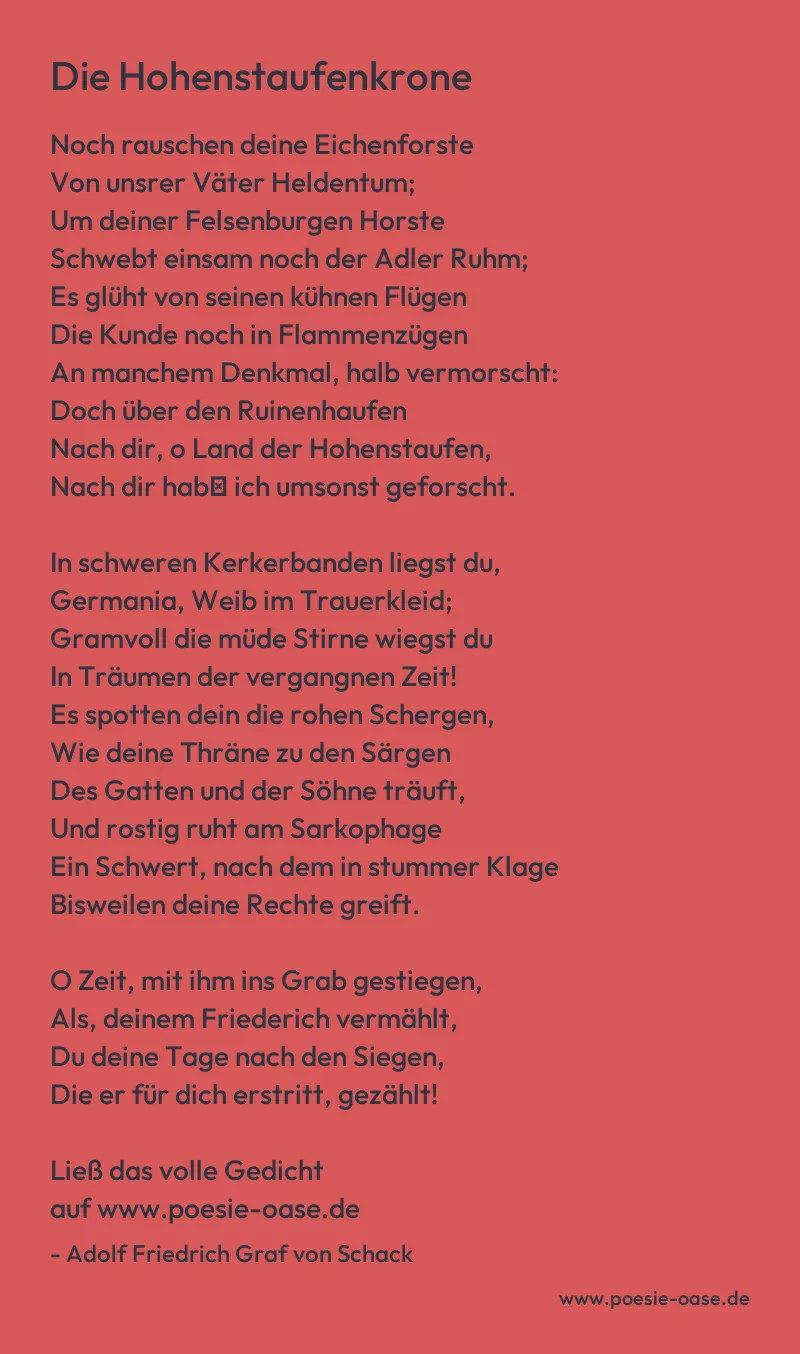Noch rauschen deine Eichenforste
Von unsrer Väter Heldentum;
Um deiner Felsenburgen Horste
Schwebt einsam noch der Adler Ruhm;
Es glüht von seinen kühnen Flügen
Die Kunde noch in Flammenzügen
An manchem Denkmal, halb vermorscht:
Doch über den Ruinenhaufen
Nach dir, o Land der Hohenstaufen,
Nach dir hab′ ich umsonst geforscht.
In schweren Kerkerbanden liegst du,
Germania, Weib im Trauerkleid;
Gramvoll die müde Stirne wiegst du
In Träumen der vergangnen Zeit!
Es spotten dein die rohen Schergen,
Wie deine Thräne zu den Särgen
Des Gatten und der Söhne träuft,
Und rostig ruht am Sarkophage
Ein Schwert, nach dem in stummer Klage
Bisweilen deine Rechte greift.
O Zeit, mit ihm ins Grab gestiegen,
Als, deinem Friederich vermählt,
Du deine Tage nach den Siegen,
Die er für dich erstritt, gezählt!
Als sich vom Rhein zum Hellesponte
Die Welt in deinem Ruhme sonnte,
Und dein Panier mit stolzem Flug
Im alten Wunderland der Träume,
Im Orient, die Purpursäume
Des fernsten Morgenhimmels schlug!
Wo ist das Zeichen, das geweihte,
An dem das Erdenschicksal hing,
Die Krone, die den Kaiser feite,
Mit ihrem goldnen Zauberring?
Wo das Geschlecht, das göttlich schöne,
Die hehren Töchter und die Söhne,
An deiner Mutterbrust gesäugt?
Ach! Antwort giebt der stille Jammer,
Der tiefer in der Totenkammer
Dein Antlitz auf die Erde beugt.
Doch traue, Weib, den alten Sagen,
Von unsern Vätern gern geglaubt!
Es liegt dort, wo die Alpen ragen,
Ein himmelnahes Bergeshaupt;
Rings klaffen mit jahrtausendalten
Schneefeldern ungeheure Spalten;
Kein Wanderer drang je hindurch;
Und auf der höchsten, steilsten Spitze
Hebt sich die Nachbarin der Blitze,
Der Stürme Braut, die Kronenburg.
Als Manfred fiel, der heldenkühne,
In Benevent auf blut′gem Feld,
Als auf Neapels Henkerbühne
Hinsank der junge Kaiserheld,
Da trug von dem verwaisten Throne
Ein Aar die Hohenstaufenkrone
Zu jenem Alpenschlosse fort –
Es blühn und welken die Geschlechter,
Doch Geister schirmen, treue Wächter,
Bis heut des deutschen Reiches Hort.
Einst aber wird ein Held erstehen,
Von edlem deutschem Stamm ein Sproß,
Auf den der Herr im Sturmeswehen
Den Atem seiner Weihe goß;
Es strahlt sein Haupt im Morgenglanze;
Befreiung blitzt auf seiner Lanze,
In seinem Banner rauscht der Sieg,
Und mit den Winken seiner Brauen
Lenkt durch der Schlachten Wettergrauen,
Wie seinen Sklaven, er den Krieg.
Vor ihm vergeht die Macht der Bösen,
In sich zerbricht der alte Bann;
Das deutsche Kleinod einzulösen,
Stürmt er die Kronenburg hinan;
Und sieh! die Eisgewölbe brechen,
Sie lösen sich zu Gletscherbächen,
Schneebrücken stürzen donnernd nach,
Und, hoch die Alpenhäupter zündend,
Ein neues Erdenjahr verkündend,
Hebt strahlend sich der junge Tag.
Hernieder dann aus den Ruinen,
Die teure Krone in der Hand,
Steigt bei dem Donner der Lawinen
Der Kaiser in sein deutsches Land;
Ihn feiern die Drommetenstöße,
Der auf das Haupt der alten Größe
Den Kranz der jungen Freiheit drückt;
Ihm prangt die Flamme der Altäre
Und ihm die lautre Freudenzähre,
Die jedes deutsche Auge schmückt.
Dir kündet, Weib, der Klang der Glocken
Das Nahen des ersehnten Herrn;
Entgegen strahlt von seinen Locken
Die Krone dir als Morgenstern;
Und über dir und dem Befreier,
Als Zeuge bei der heil′gen Feier,
Die allen deinen Jammer sühnt,
Rauscht stolz wie einst die deutsche Eiche,
Die mit dem neu erstandnen Reiche
Der Ewigkeit entgegengrünt.