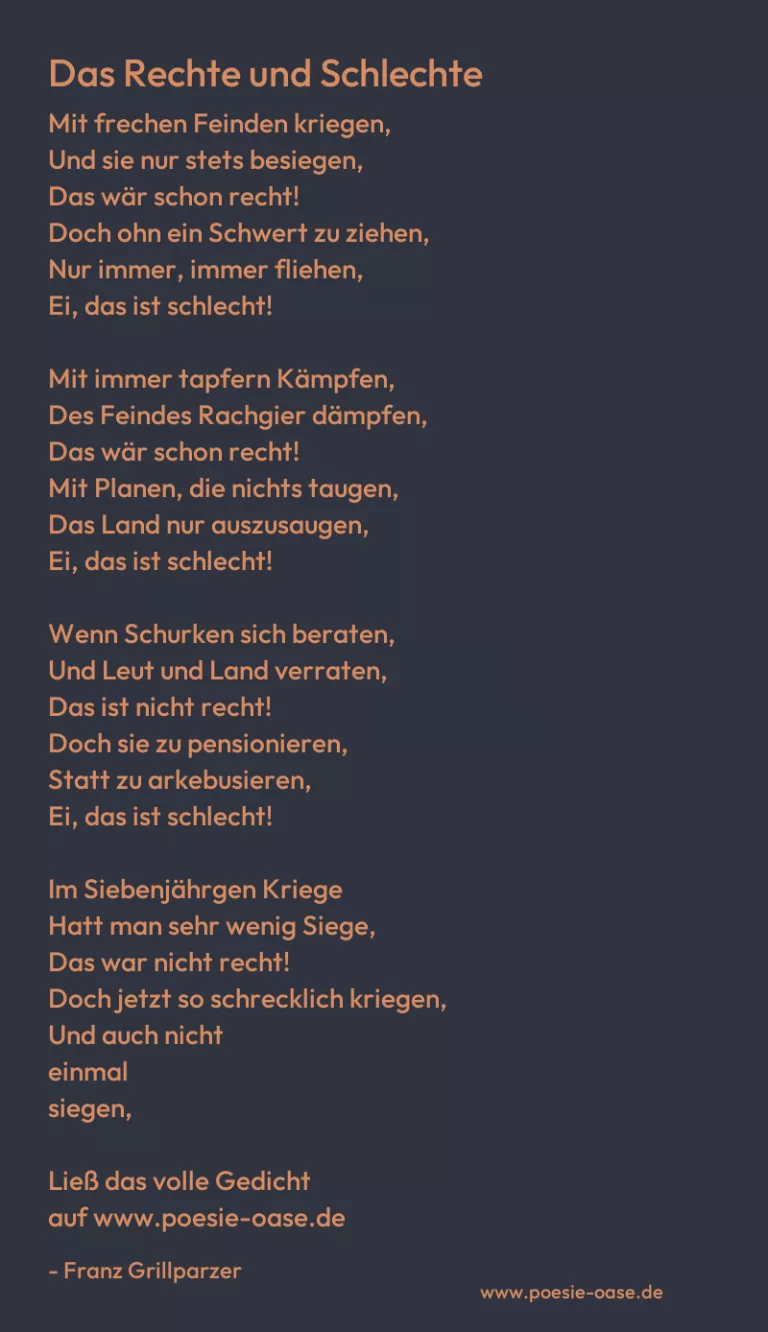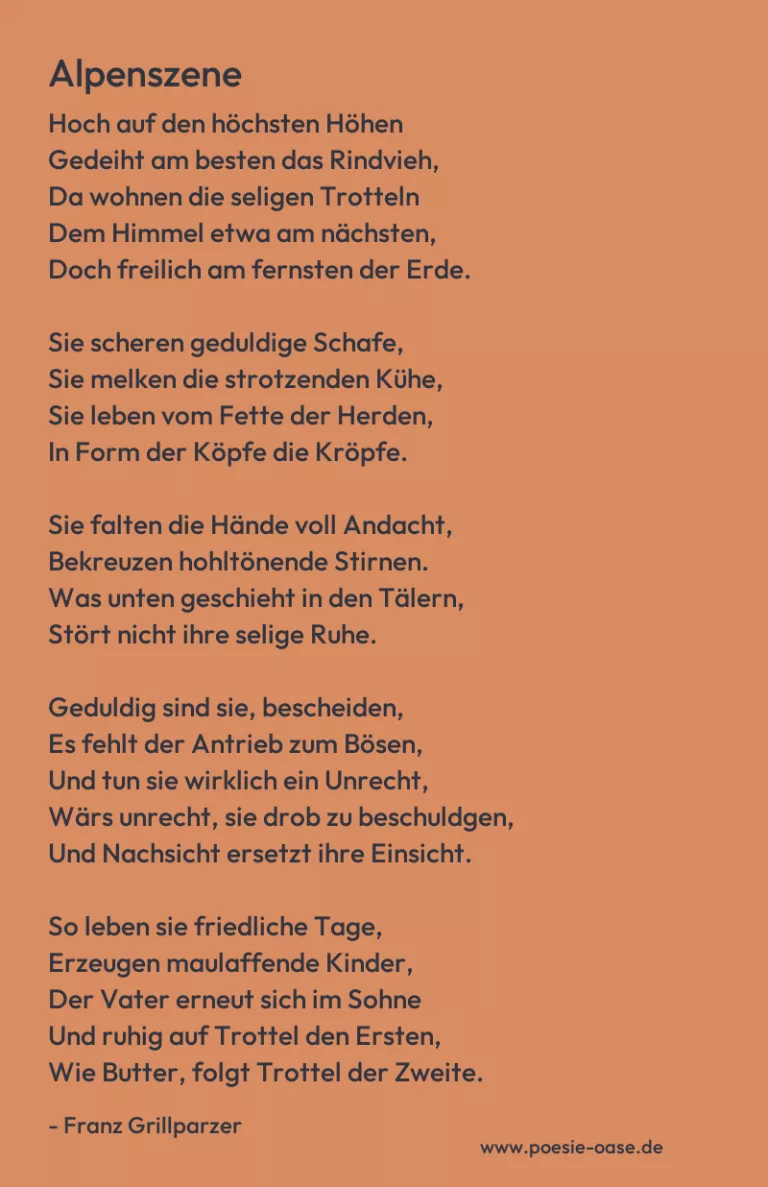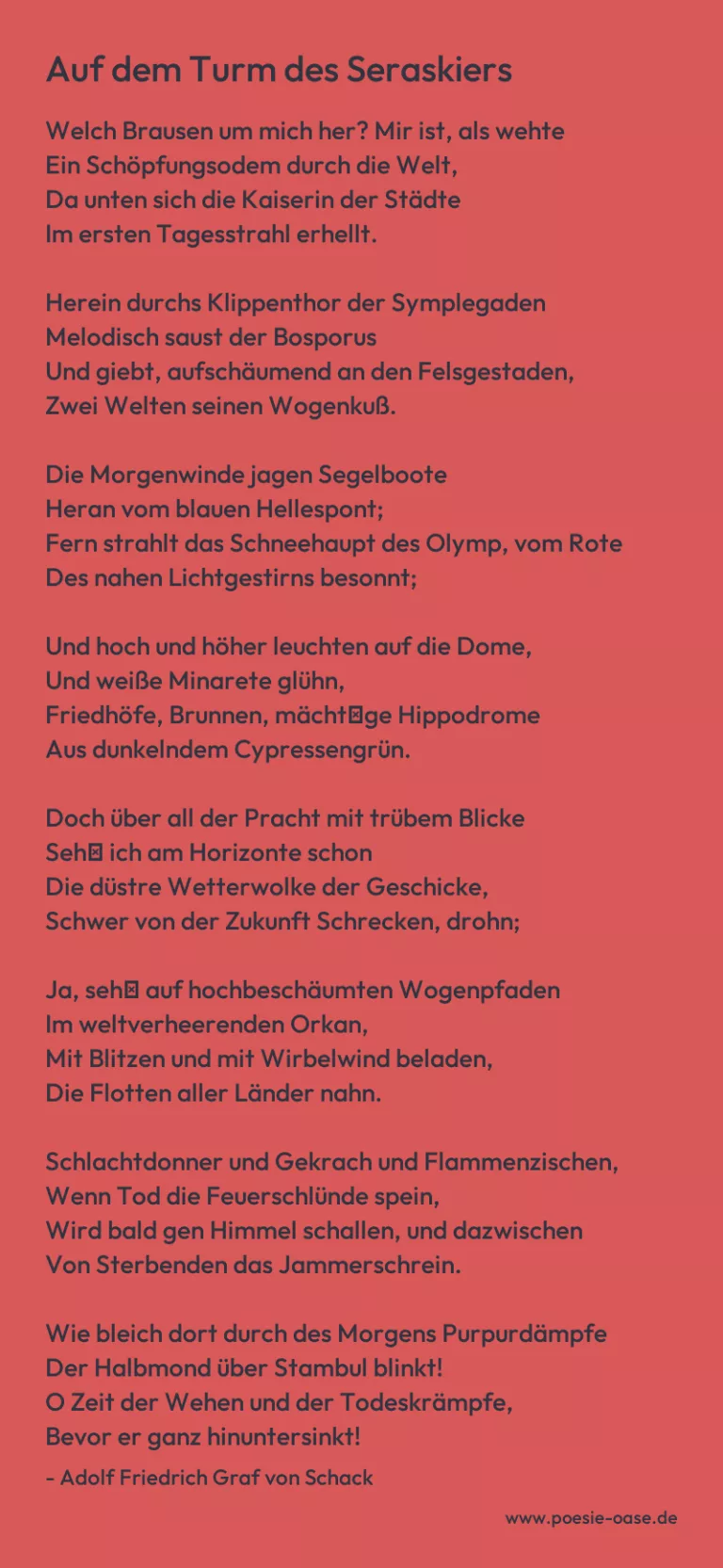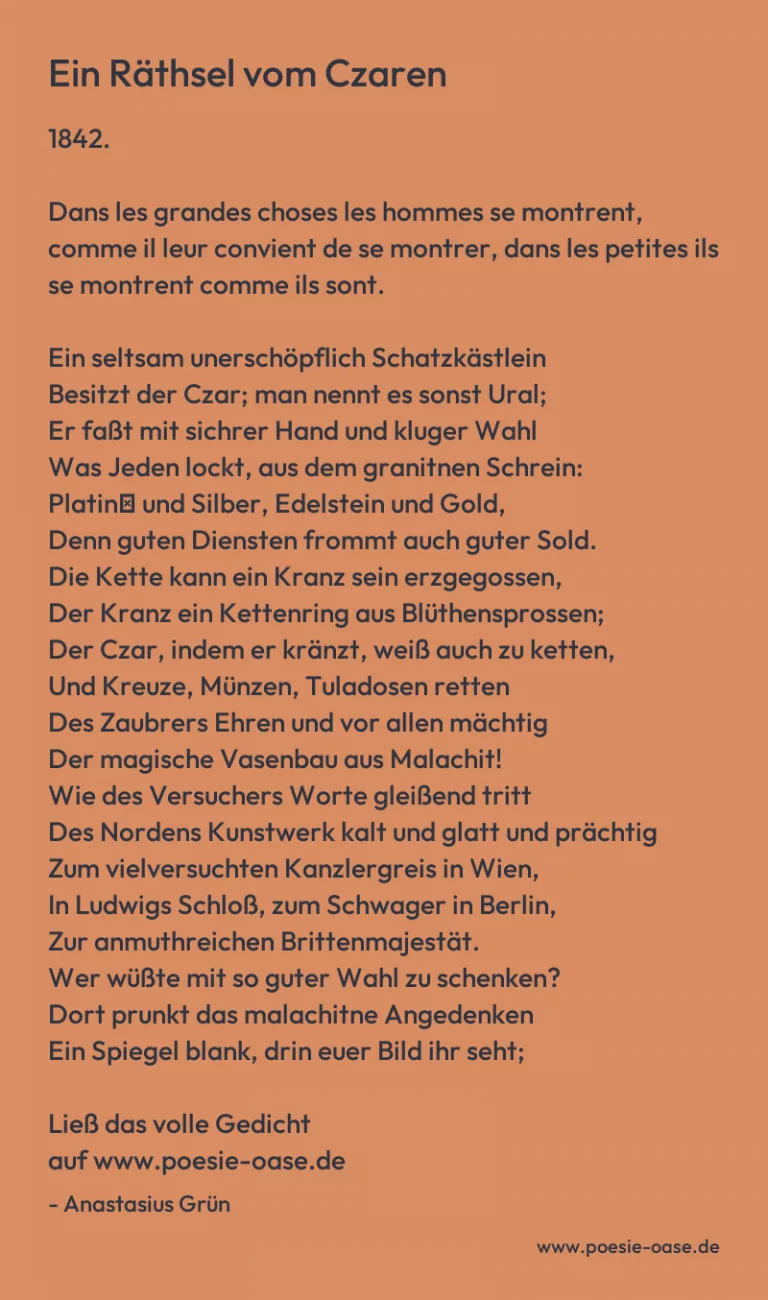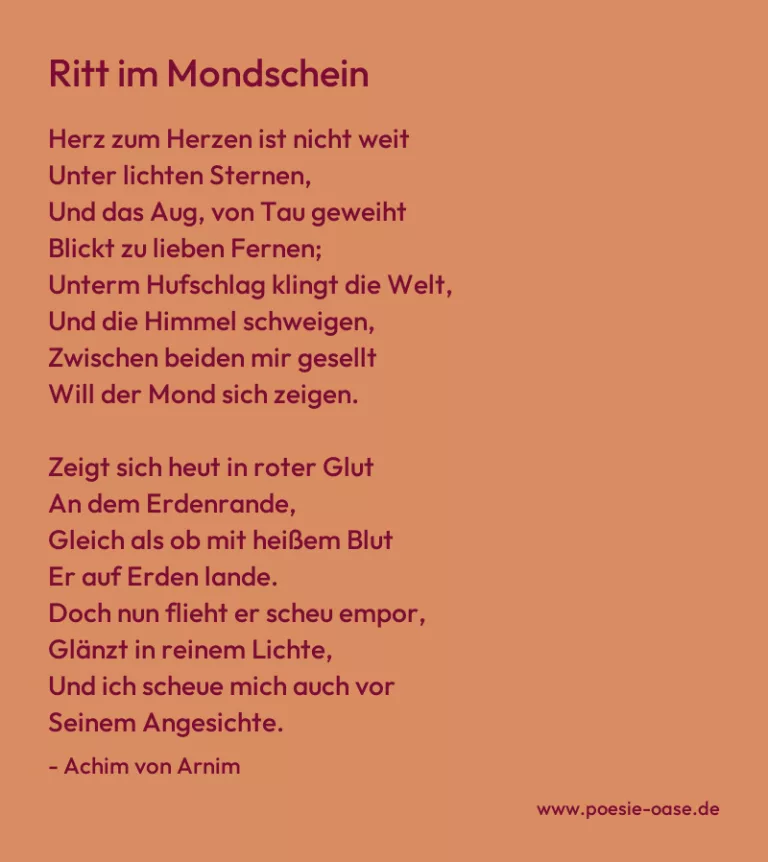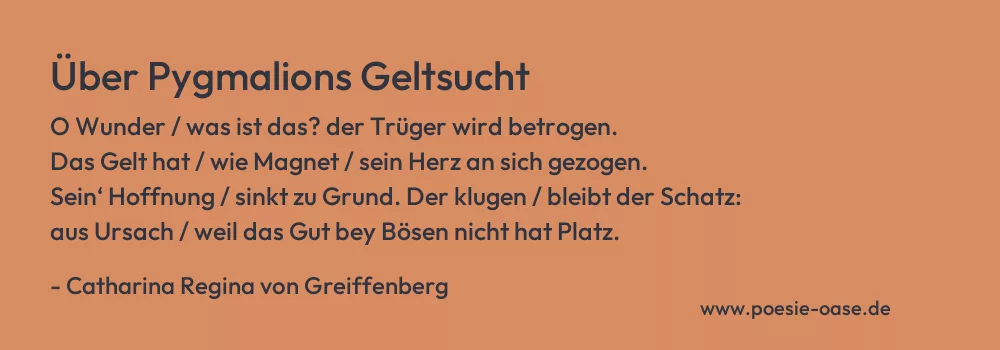Über Pygmalions Geltsucht
O Wunder / was ist das? der Trüger wird betrogen.
Das Gelt hat / wie Magnet / sein Herz an sich gezogen.
Sein‘ Hoffnung / sinkt zu Grund. Der klugen / bleibt der Schatz:
aus Ursach / weil das Gut bey Bösen nicht hat Platz.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
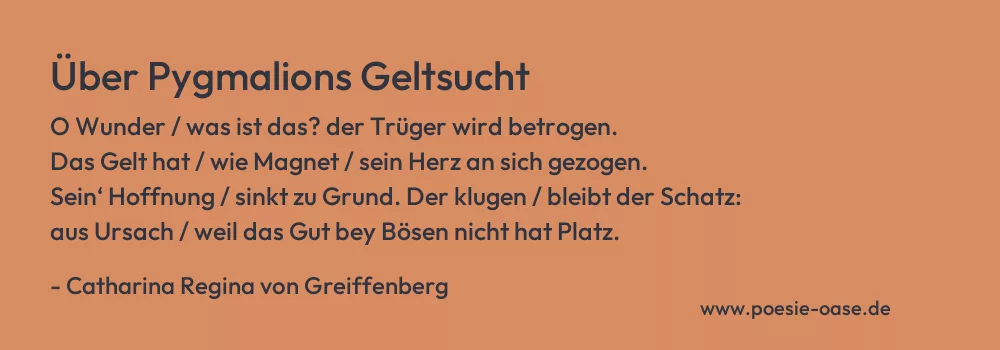
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Epigramm „Über Pygmalions Geltsucht“ von Catharina Regina von Greiffenberg ist eine prägnante moralische Reflexion über die zerstörerische Macht der Habgier. In wenigen Zeilen entfaltet die Dichterin eine Parabel über Täuschung, Verlust und die göttliche Gerechtigkeit.
Bereits der erste Vers stellt eine ironische Verkehrung dar: „Der Trüger wird betrogen.“ Dies deutet darauf hin, dass jemand, der sich auf Täuschung oder Gier verlässt, am Ende selbst zum Opfer wird. Die zweite Zeile verstärkt dies durch das Bild des Geldes als Magneten, der das Herz anzieht – eine Metapher für die zerstörerische Macht des Reichtums, der den Menschen gefangen nimmt. Doch diese Bindung ist nicht dauerhaft: Die Hoffnung des Habgierigen „sinkt zu Grund“, sein Besitz erweist sich als unsicher.
Die letzten beiden Zeilen bieten eine klare moralische Lehre: Der wahre Schatz bleibt den Klugen erhalten, während das Gut bei den Bösen keinen Bestand hat. Dies entspricht der barocken Vorstellung von einer göttlichen Ordnung, in der Reichtum nicht durch Gier, sondern durch Tugend erhalten bleibt.
Mit wenigen, scharf gesetzten Worten entlarvt Greiffenberg die Vergänglichkeit materiellen Besitzes und mahnt zu Weisheit und Mäßigung. Das Gedicht zeigt ihre Fähigkeit, tiefsinnige Reflexionen in knappe, präzise Formulierungen zu fassen, die sowohl eine ironische Pointe als auch eine moralische Lehre enthalten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.