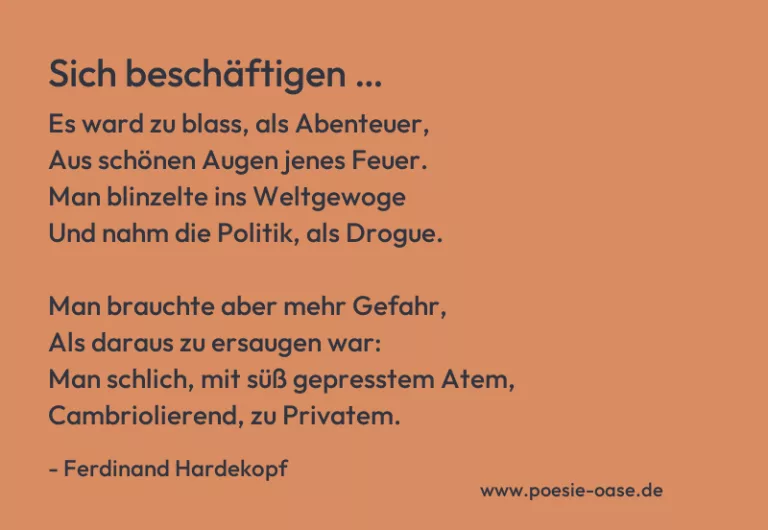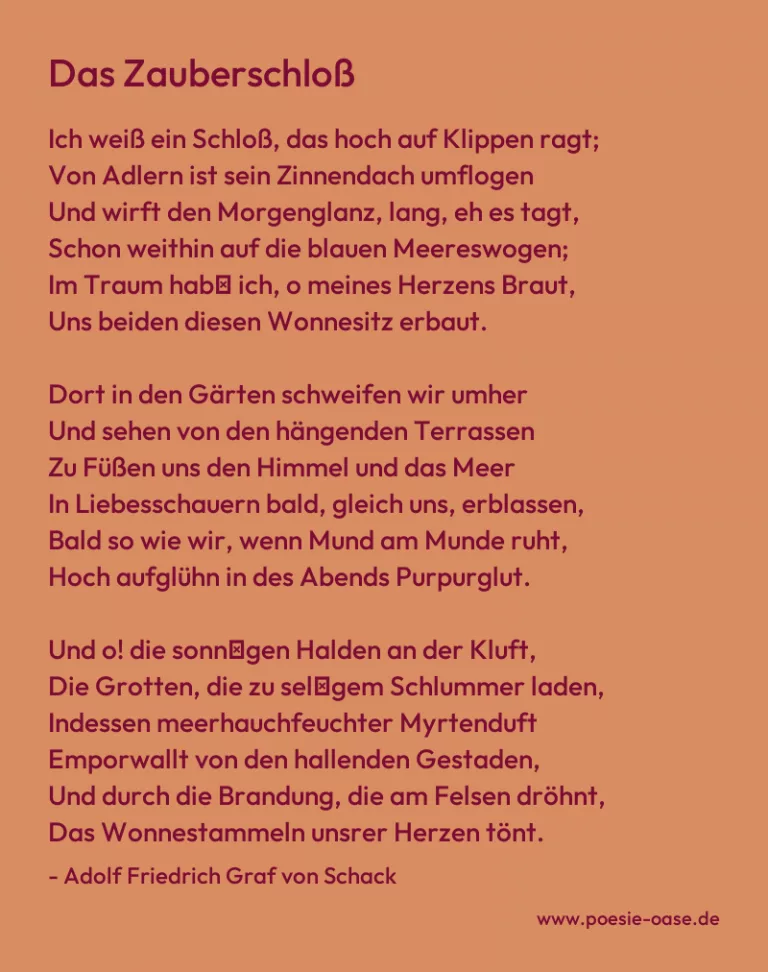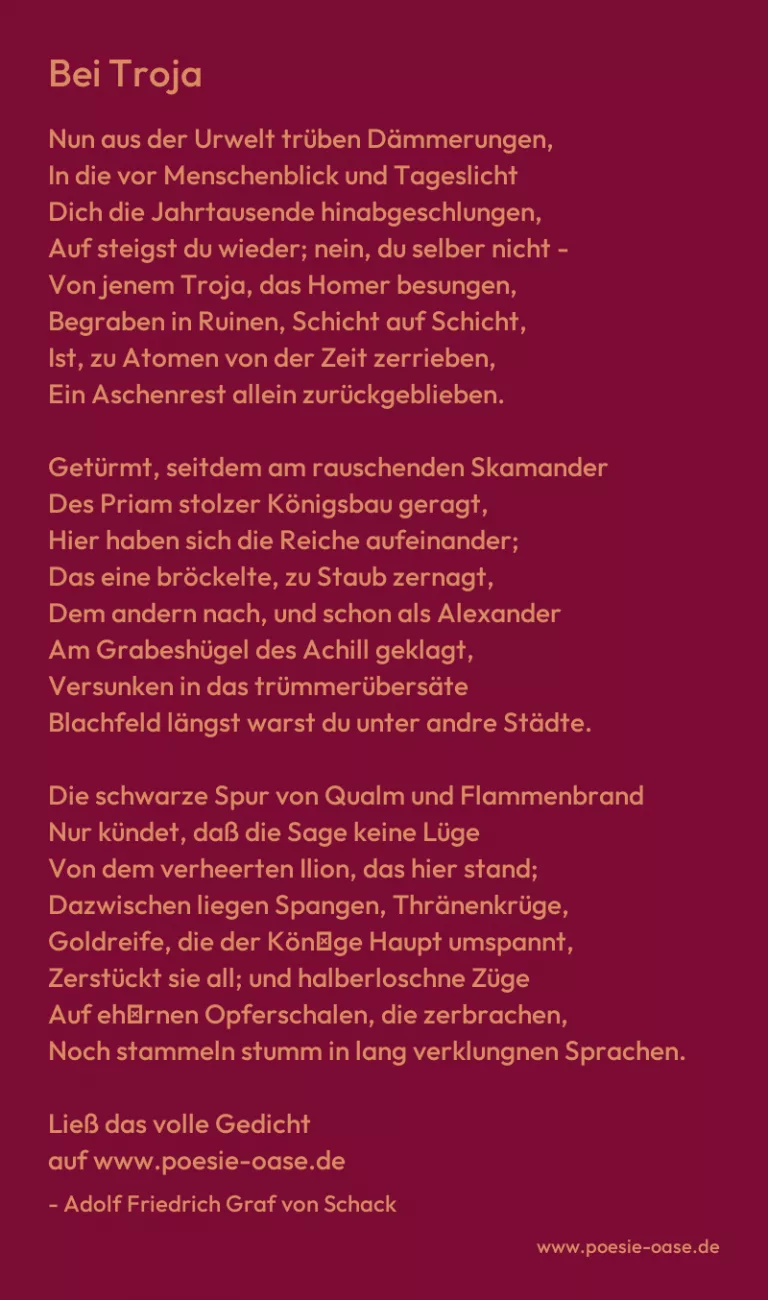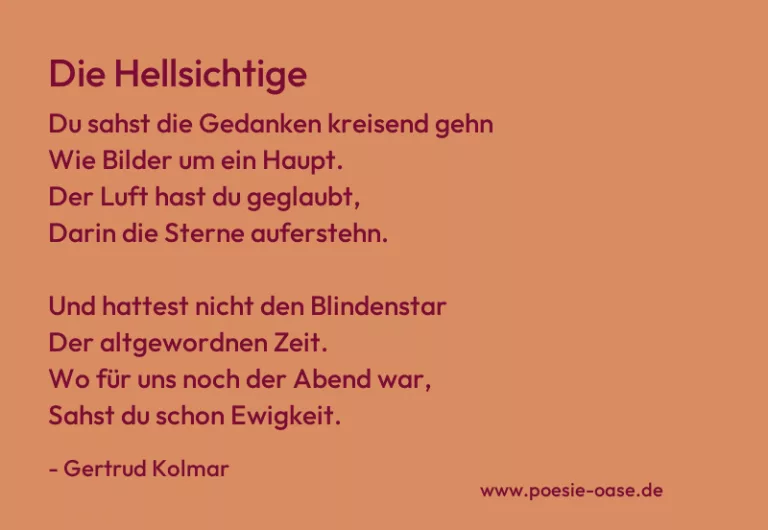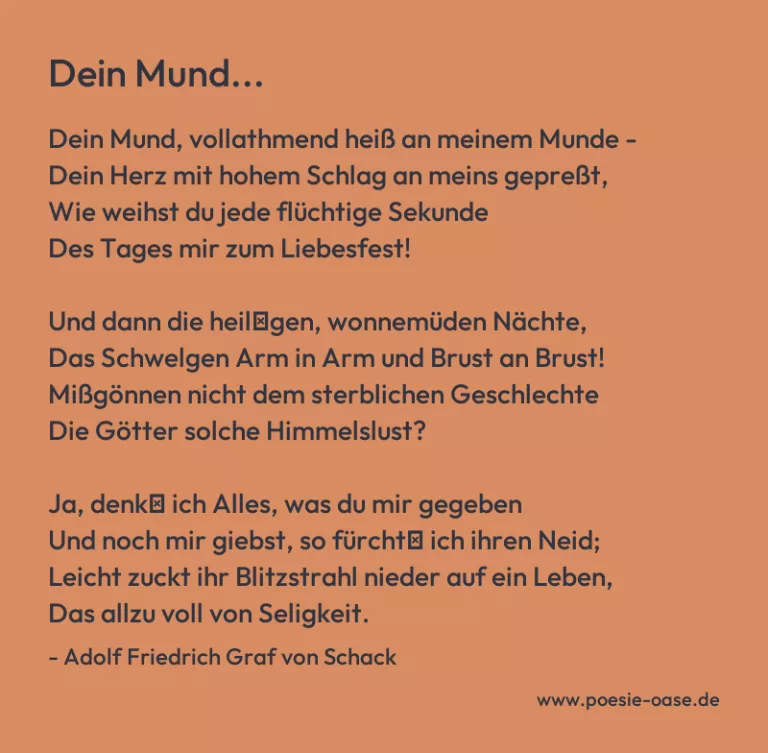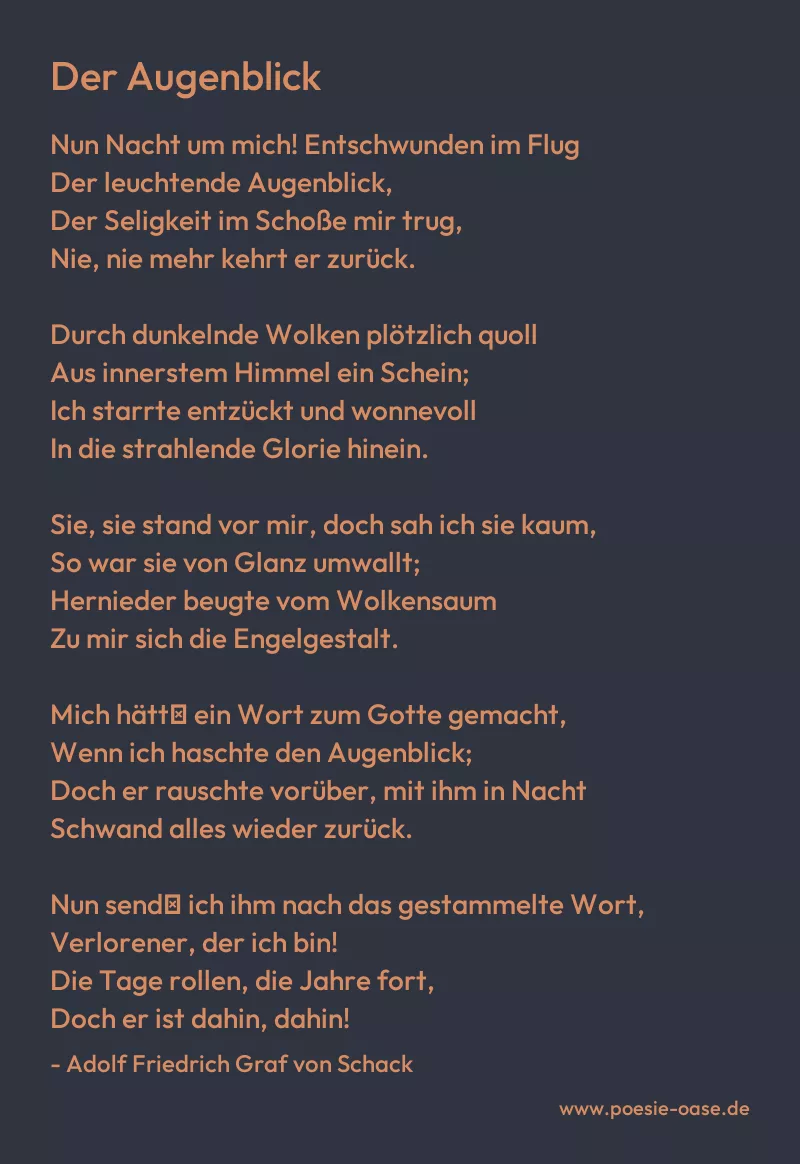Der Augenblick
Nun Nacht um mich! Entschwunden im Flug
Der leuchtende Augenblick,
Der Seligkeit im Schoße mir trug,
Nie, nie mehr kehrt er zurück.
Durch dunkelnde Wolken plötzlich quoll
Aus innerstem Himmel ein Schein;
Ich starrte entzückt und wonnevoll
In die strahlende Glorie hinein.
Sie, sie stand vor mir, doch sah ich sie kaum,
So war sie von Glanz umwallt;
Hernieder beugte vom Wolkensaum
Zu mir sich die Engelgestalt.
Mich hätt′ ein Wort zum Gotte gemacht,
Wenn ich haschte den Augenblick;
Doch er rauschte vorüber, mit ihm in Nacht
Schwand alles wieder zurück.
Nun send′ ich ihm nach das gestammelte Wort,
Verlorener, der ich bin!
Die Tage rollen, die Jahre fort,
Doch er ist dahin, dahin!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
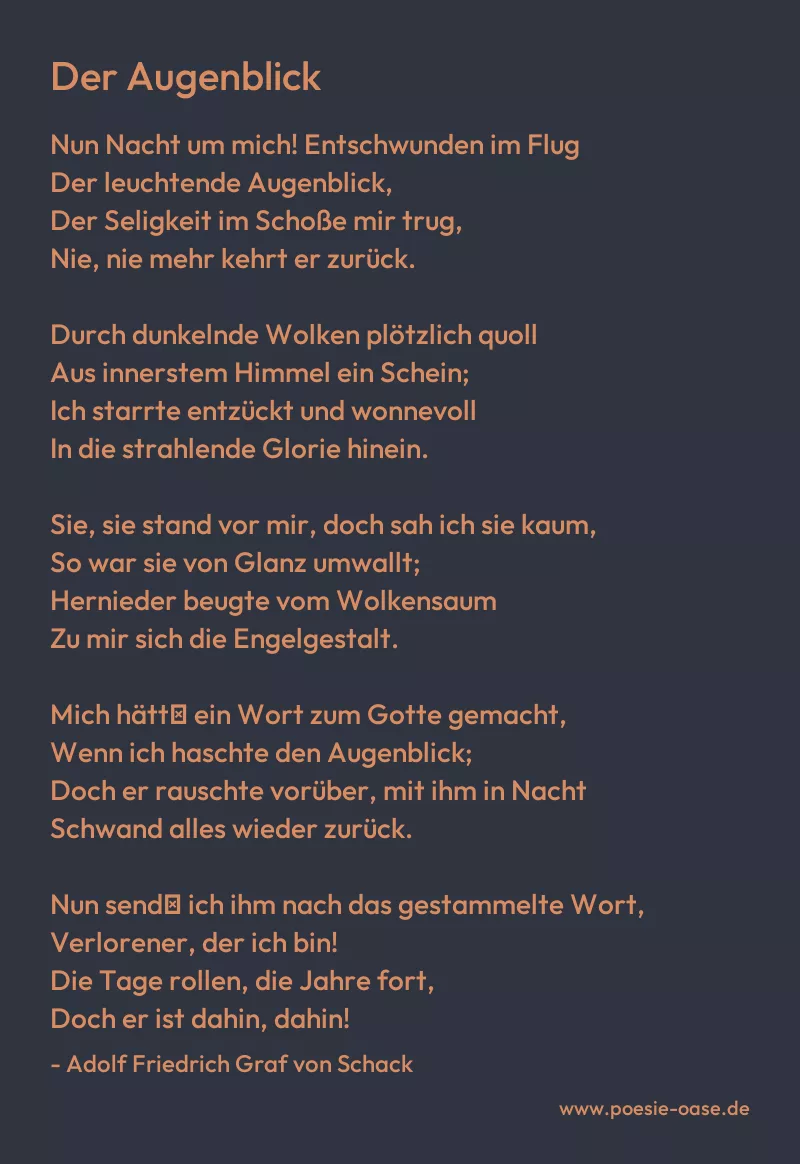
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Augenblick“ von Adolf Friedrich Graf von Schack beschreibt das Gefühl des Verlusts eines bedeutsamen Moments, der unerreichbar und unwiederbringlich ist. Die Eröffnungsstrophe etabliert sofort die melancholische Stimmung des Gedichts, indem sie die „Nacht“ und das „Entschwinden“ des „leuchtenden Augenblicks“ hervorhebt, der einst Glückseligkeit verhieß. Die Wiederholung von „Nie, nie mehr kehrt er zurück“ verstärkt die Verzweiflung und die Erkenntnis, dass dieser Moment für immer verloren ist.
Die zweite Strophe bietet einen Hoffnungsschimmer, der jedoch nur kurz währt. Ein unerwarteter „Schein“ durchbricht die Dunkelheit und erzeugt eine glückselige Erwartung, ein Gefühl des Staunens und der Freude. Die folgende Strophe intensiviert das Erlebnis, indem sie eine „Engelgestalt“ einführt, die von „Glanz umwallt“ ist und sich dem Sprecher zuwendet. Dieser Moment der fast greifbaren Nähe zum Göttlichen birgt ein enormes Potenzial, da das lyrische Ich durch ein einziges Wort „zum Gotte gemacht“ werden könnte.
Die vierte Strophe enthüllt die tragische Pointe des Gedichts. Trotz der großen Chance, die sich bot, entgleitet der „Augenblick“ dem Sprecher, und mit ihm verschwindet alles in der Nacht. Die aktive Form des „haschen“ impliziert hier die Sehnsucht, den Moment festzuhalten, während das „Vorüberrauschen“ das unaufhaltsame Vergehen der Zeit verdeutlicht. Das lyrische Ich versäumt die Gelegenheit, die sich ihm bot, und muss nun mit dem Verlust leben.
In der abschließenden Strophe wird der Schmerz über den Verlust durch das „gestammelte Wort“ ausgedrückt, das dem verlorenen Augenblick nachgesendet wird. Die Wiederholung von „verlorener, der ich bin!“ verdeutlicht die tiefe Verzweiflung und das Gefühl der Isolation, die durch den Verlust des Augenblicks entstanden sind. Die letzte Zeile bekräftigt die Unabänderlichkeit des Verlusts, die Tage und Jahre vergehen, aber der Moment ist „dahin, dahin!“, für immer verloren. Das Gedicht ist ein eindringliches Plädoyer für die Wertschätzung flüchtiger Momente und die Tragik verpasster Chancen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.