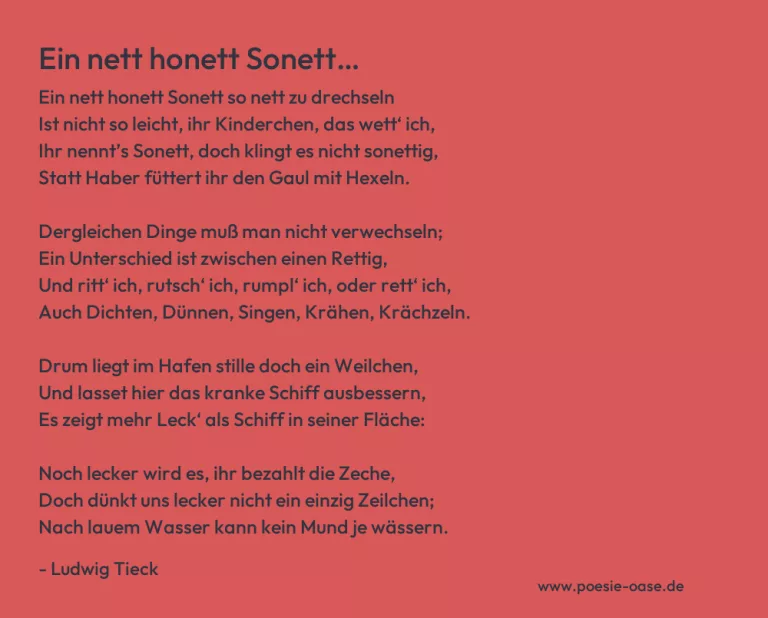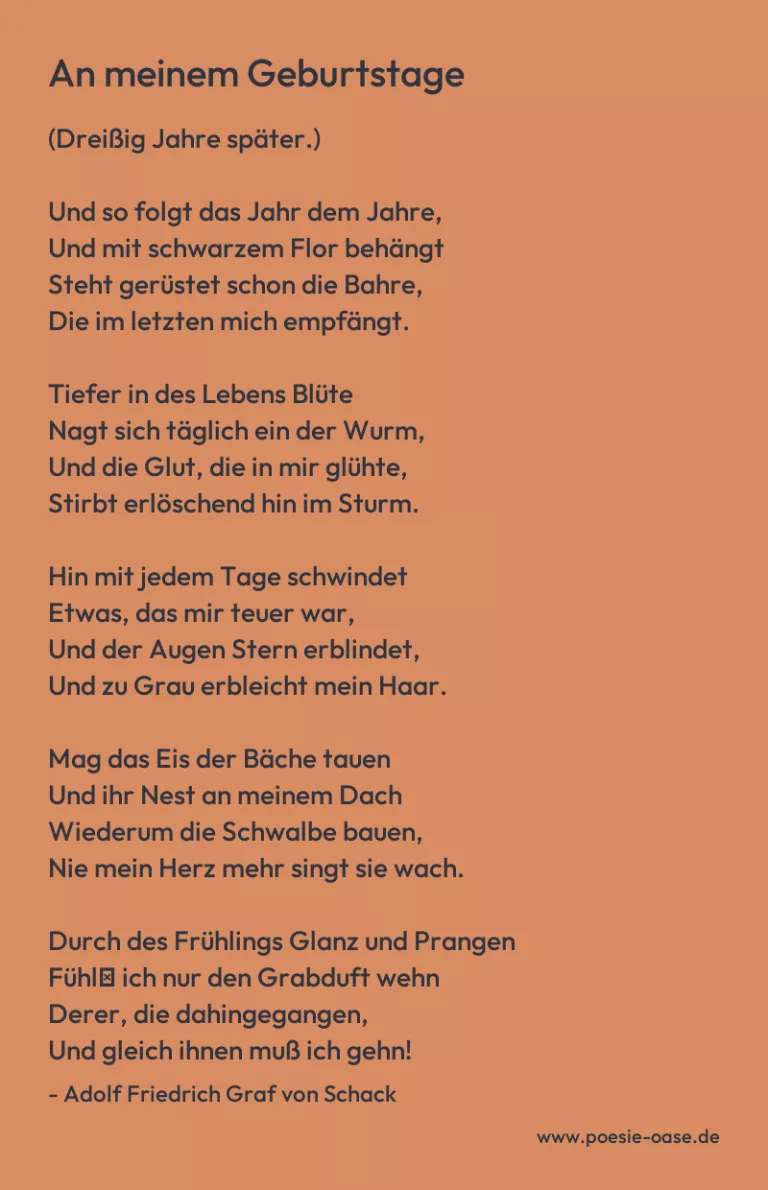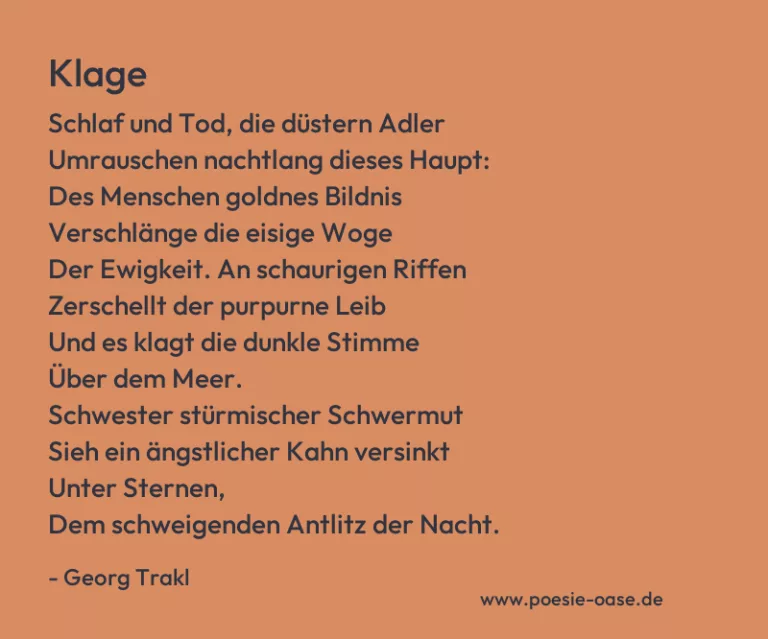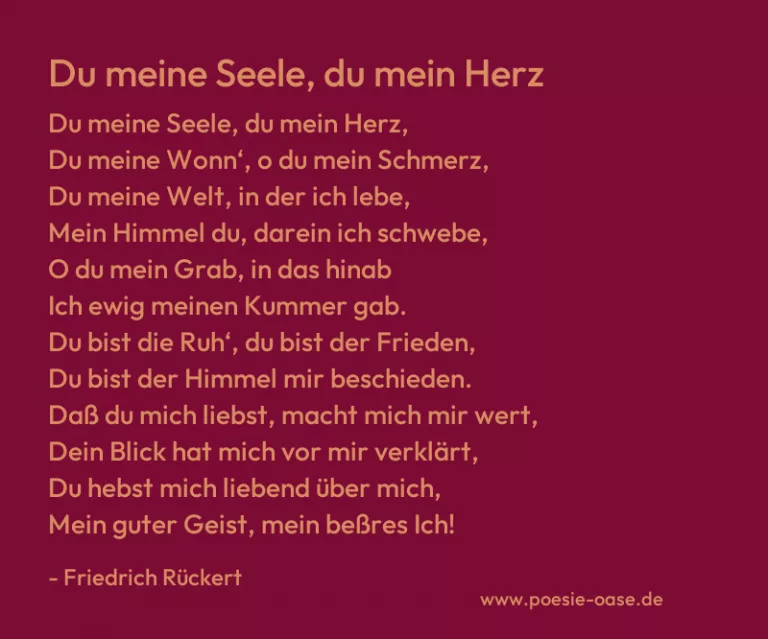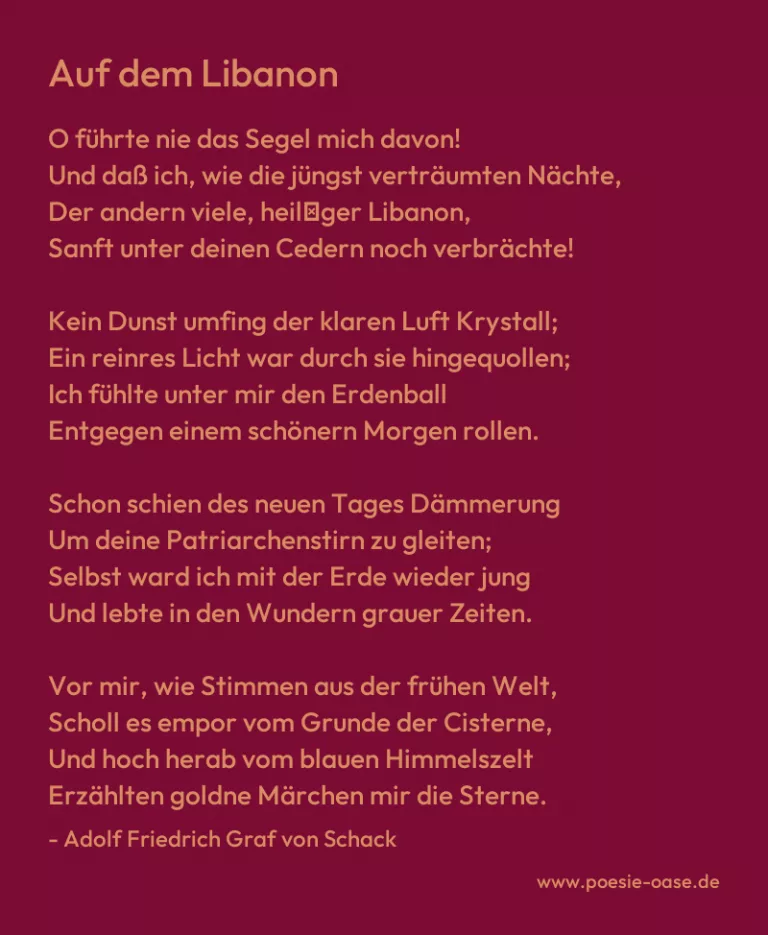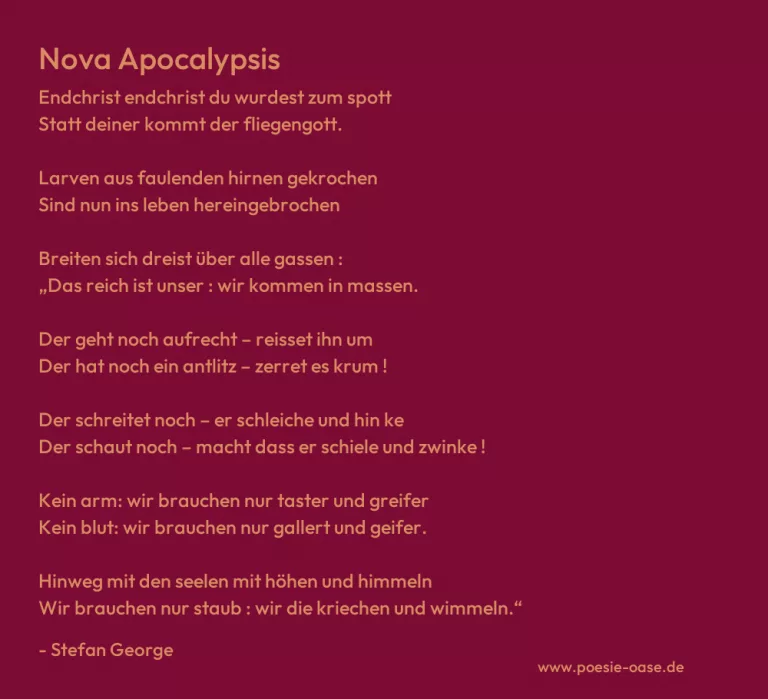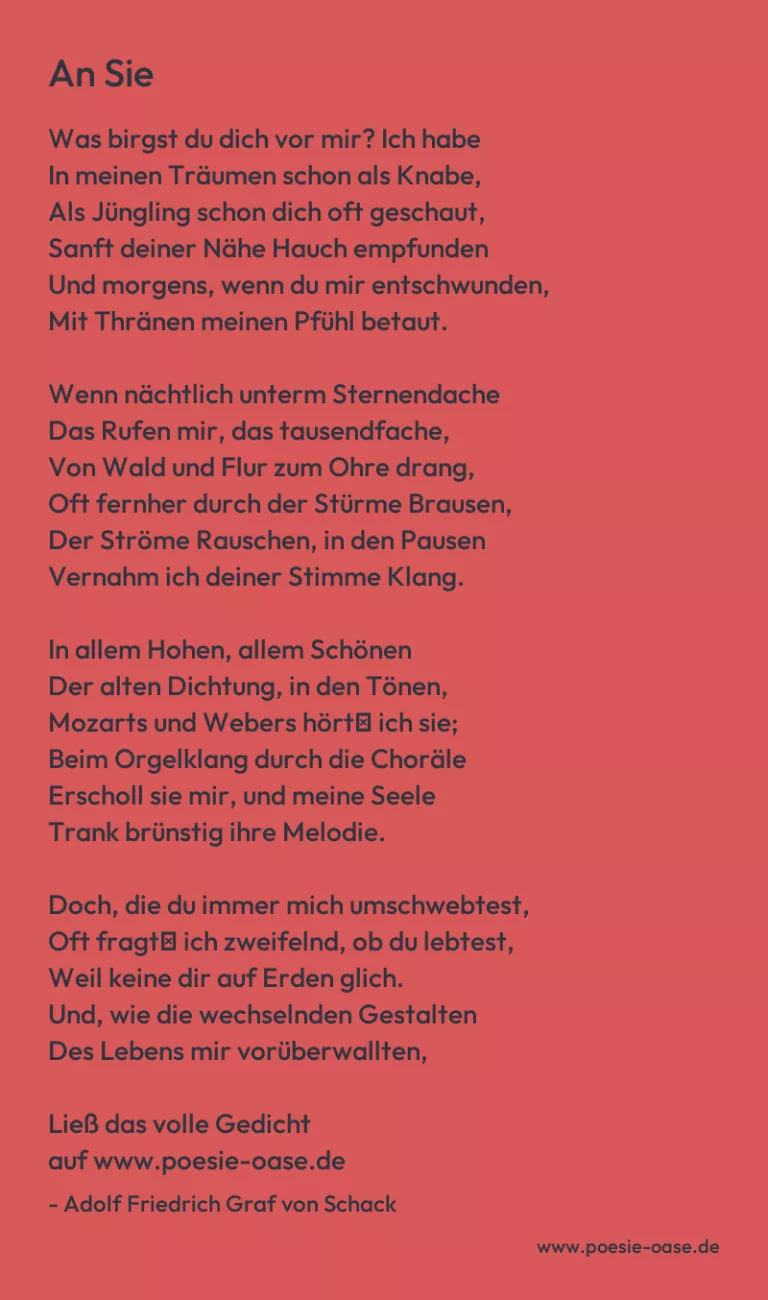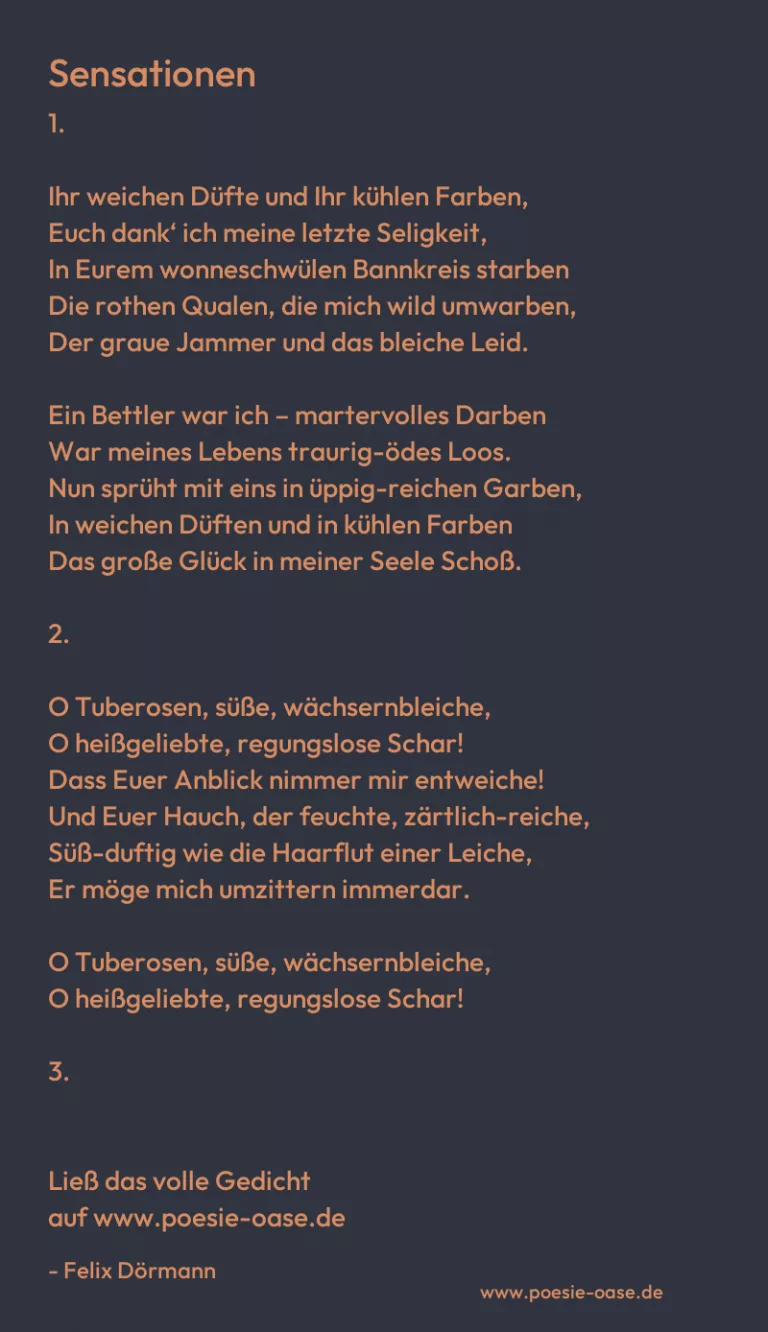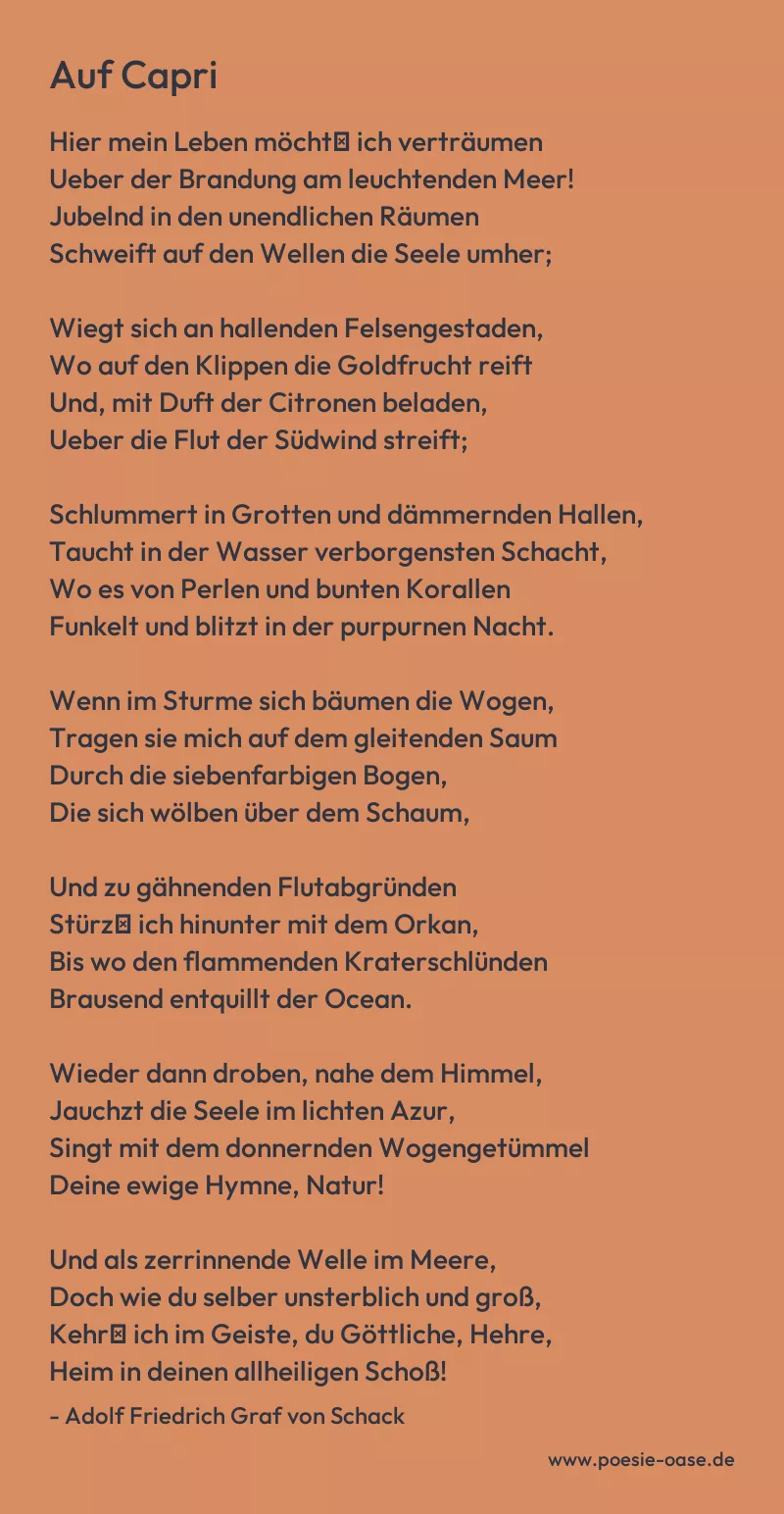Auf Capri
Hier mein Leben möcht′ ich verträumen
Ueber der Brandung am leuchtenden Meer!
Jubelnd in den unendlichen Räumen
Schweift auf den Wellen die Seele umher;
Wiegt sich an hallenden Felsengestaden,
Wo auf den Klippen die Goldfrucht reift
Und, mit Duft der Citronen beladen,
Ueber die Flut der Südwind streift;
Schlummert in Grotten und dämmernden Hallen,
Taucht in der Wasser verborgensten Schacht,
Wo es von Perlen und bunten Korallen
Funkelt und blitzt in der purpurnen Nacht.
Wenn im Sturme sich bäumen die Wogen,
Tragen sie mich auf dem gleitenden Saum
Durch die siebenfarbigen Bogen,
Die sich wölben über dem Schaum,
Und zu gähnenden Flutabgründen
Stürz′ ich hinunter mit dem Orkan,
Bis wo den flammenden Kraterschlünden
Brausend entquillt der Ocean.
Wieder dann droben, nahe dem Himmel,
Jauchzt die Seele im lichten Azur,
Singt mit dem donnernden Wogengetümmel
Deine ewige Hymne, Natur!
Und als zerrinnende Welle im Meere,
Doch wie du selber unsterblich und groß,
Kehr′ ich im Geiste, du Göttliche, Hehre,
Heim in deinen allheiligen Schoß!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
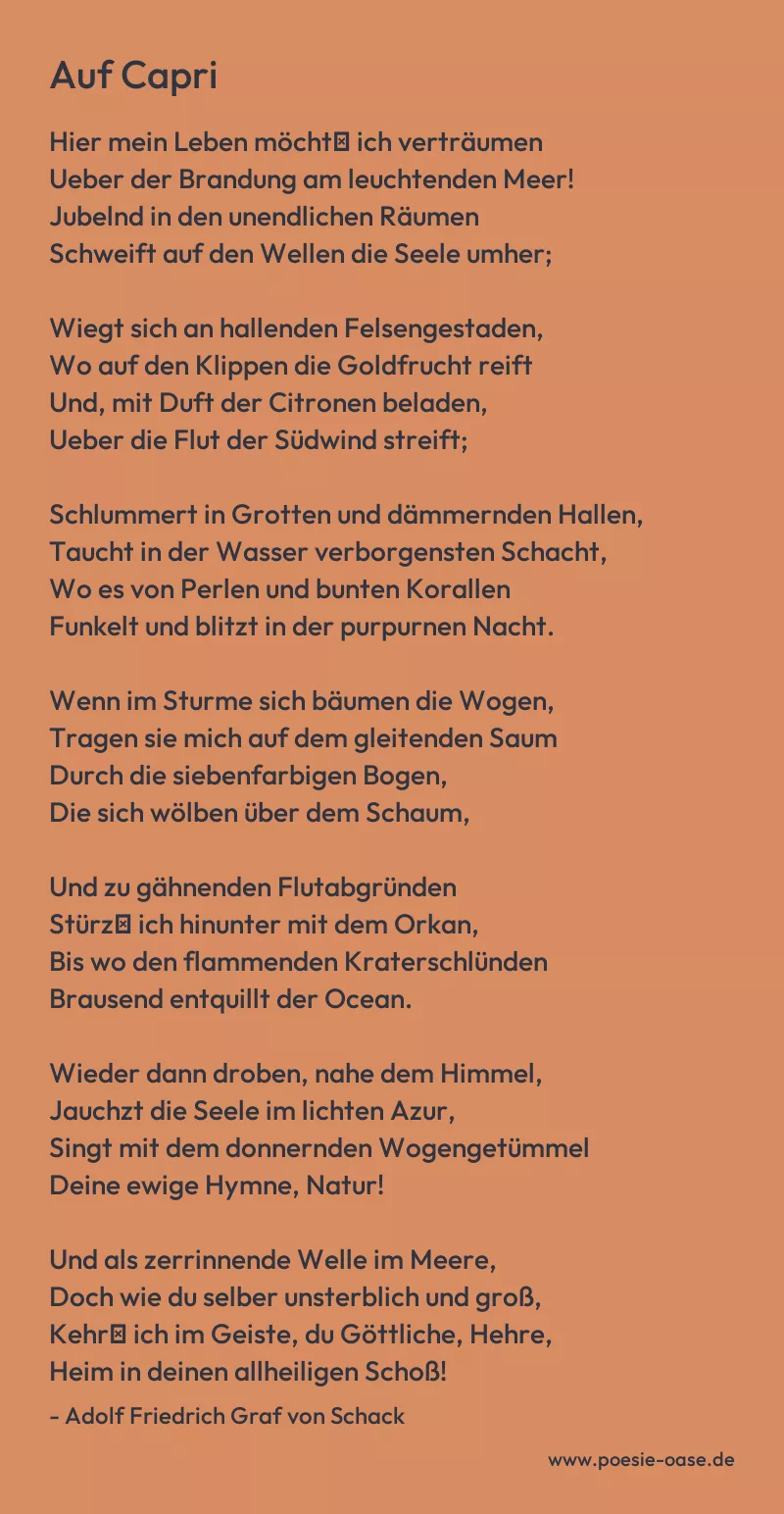
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf Capri“ von Adolf Friedrich Graf von Schack ist eine romantische Hymne auf das Leben und die Natur, die die Sehnsucht nach Freiheit, ungebändigter Schönheit und dem Gefühl der Unendlichkeit widerspiegelt. Der Dichter träumt davon, sein Leben auf Capri zu verbringen, und beschreibt eine innige Verschmelzung mit der Natur, die in intensiven Bildern und Metaphern dargestellt wird. Das Meer, die Küsten, die Grotten, die Stürme und die Farben bilden eine Kulisse für die Entfaltung der Seele, die in den unendlichen Räumen der Natur ihre Erfüllung findet.
Die Interpretation des Gedichts lässt sich in mehrere Ebenen gliedern. Zuerst die physische Ebene: der Dichter wünscht sich, seinen Aufenthalt auf Capri zu verträumen und die Schönheit der Natur mit all seinen Sinnen zu erleben. Dann die spirituelle Ebene: er identifiziert sich mit der Natur selbst, erlebt die Stürme und die Flutabgründe und fühlt sich doch am Ende als Teil des Ganzen, als Welle im Meer der Ewigkeit. Dies drückt eine tiefe Verbundenheit mit dem kosmischen Kreislauf aus, der Geburt, Tod und Wiedergeburt umfasst. Die Seele schweift umher, taucht in die Tiefen und erhebt sich wieder, vereint sich mit der Natur und feiert ihre Ewigkeit.
Die Sprache des Gedichts ist reich an Bildern und Emotionen, die die Leser in seinen Bann ziehen. Die Verwendung von Adjektiven wie „leuchtend“, „hallend“, „dämmernd“ und „purpurn“ erzeugt eine lebendige und sinnliche Atmosphäre. Die Beschreibungen der Wellen, der Goldfrüchte, der Perlen und Korallen laden dazu ein, die Schönheit der Insel Capri hautnah zu erleben. Die Metaphern, wie die „siebenfarbigen Bogen“, die sich über dem Schaum wölben, oder die „flammenden Kraterschlünde“, erwecken ein Gefühl von Größe, Kraft und Unendlichkeit. Die Seele des Dichters verschmilzt mit der Natur, feiert mit ihr und kehrt schließlich in ihren allheiligen Schoß zurück.
Die zentrale Aussage des Gedichts ist die Erhebung der Natur. Der Dichter feiert sie als ewige, unsterbliche Macht, in deren Kreislauf die menschliche Existenz eingebettet ist. Das Gedicht ist nicht nur eine Beschreibung der äußeren Schönheit Capris, sondern auch eine innere Reise, die zur Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit und der Verbundenheit mit dem Großen Ganzen führt. Die Sehnsucht nach Freiheit und die Auflösung des Individuums in der Natur sind typisch für die Romantik, die hier auf poetische Weise zum Ausdruck gebracht werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Auf Capri“ ein Gedicht ist, das die Schönheit, die Erhabenheit und die ewige Kraft der Natur feiert und die Sehnsucht nach Freiheit, Unendlichkeit und Einheit mit dem Kosmos zum Ausdruck bringt. Es ist eine Hommage an die Natur, die uns durch die Schönheit der Welt und die Wiederentdeckung der Seele in eine Welt der Freiheit entführt, die uns lehrt, die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren, während wir Teil des ewigen Kreislaufs sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.