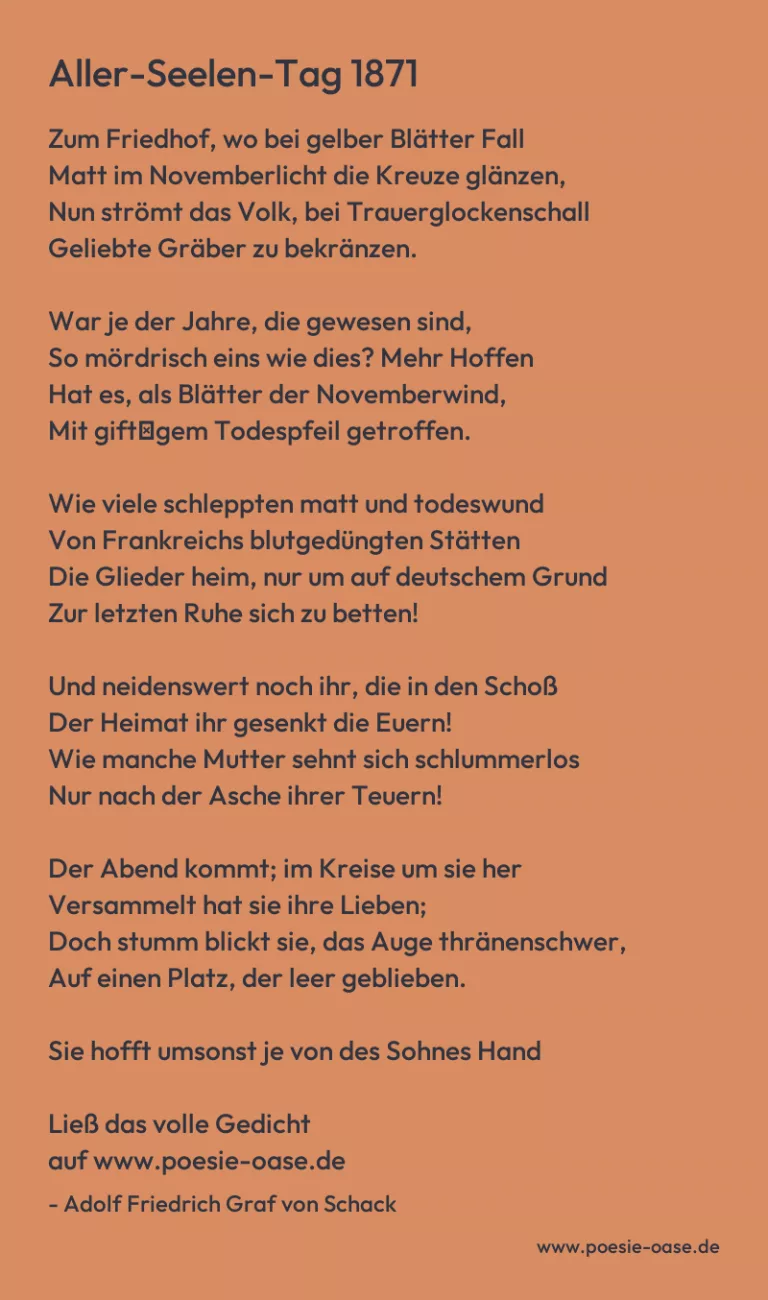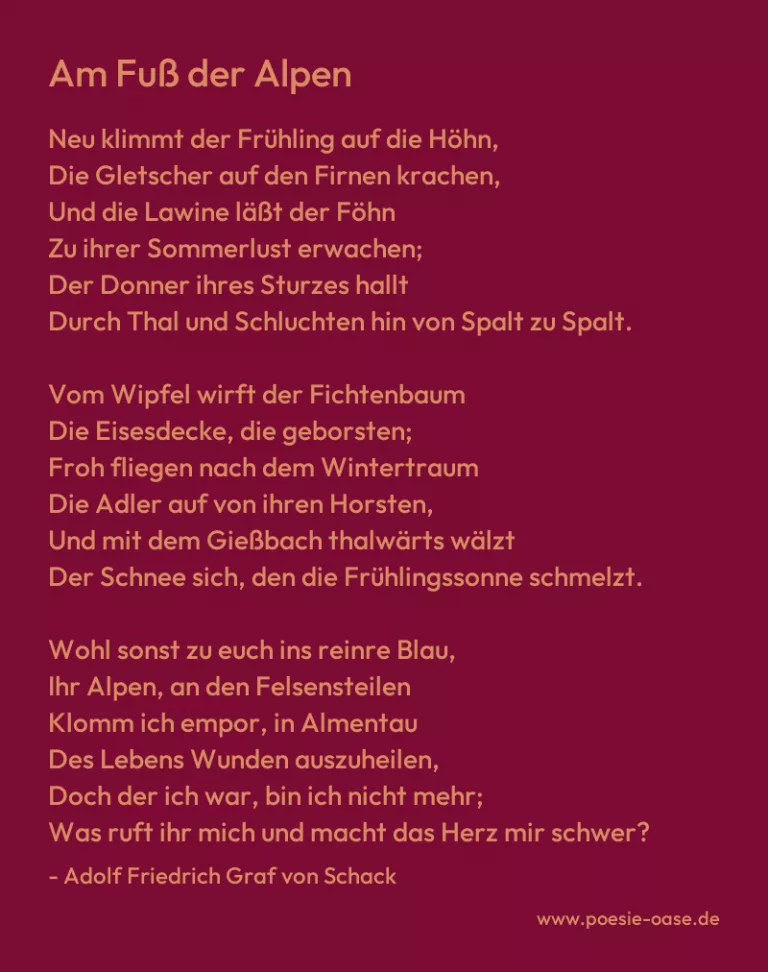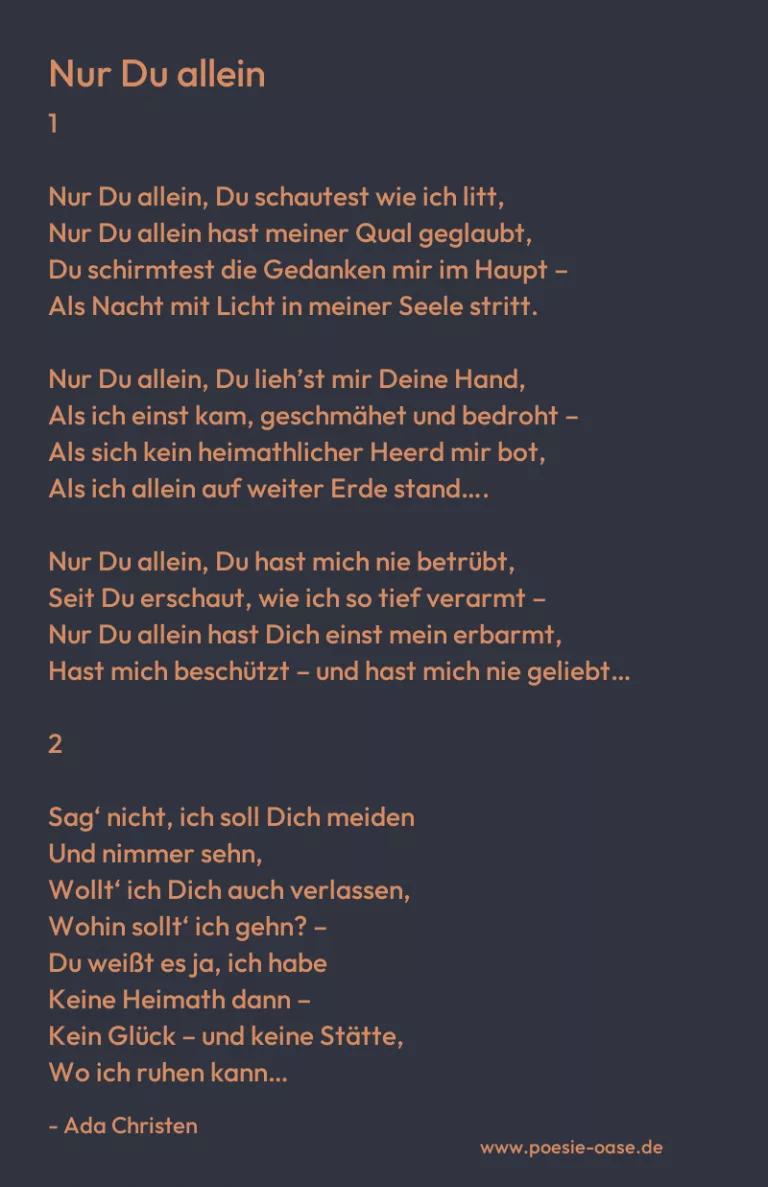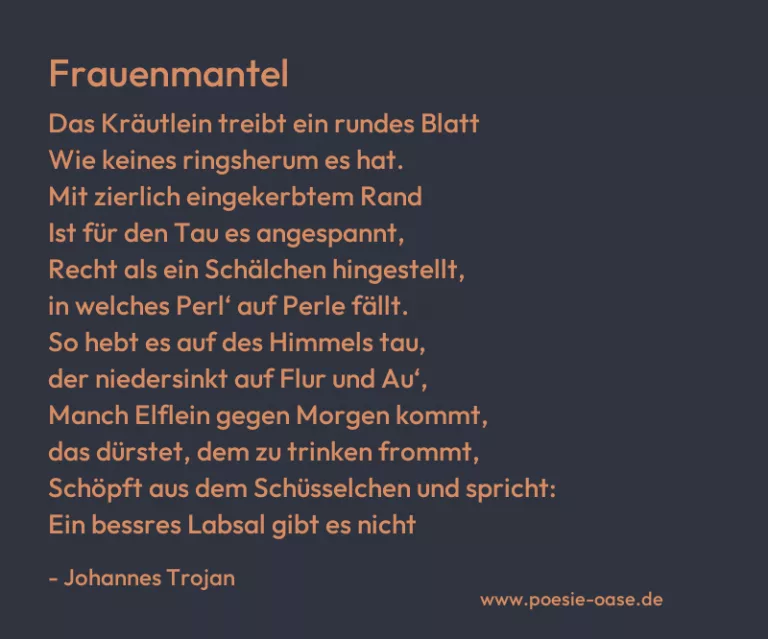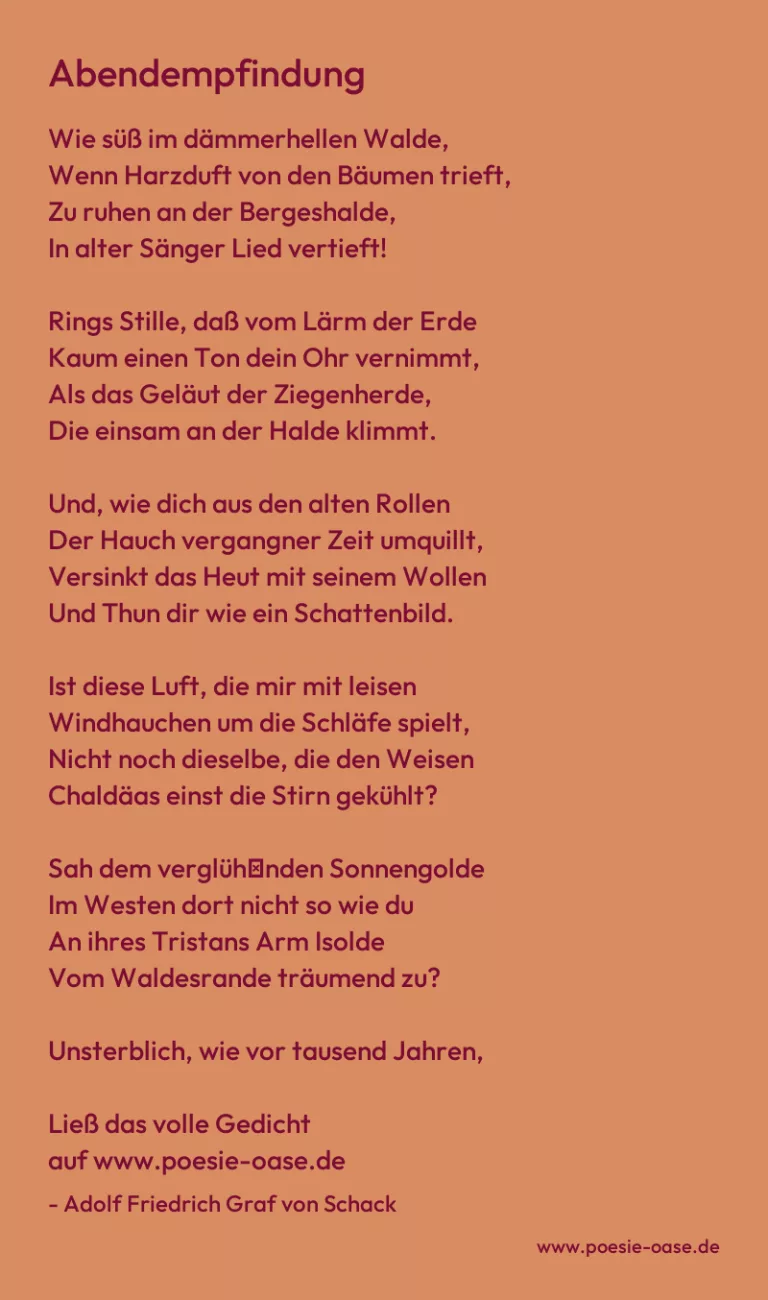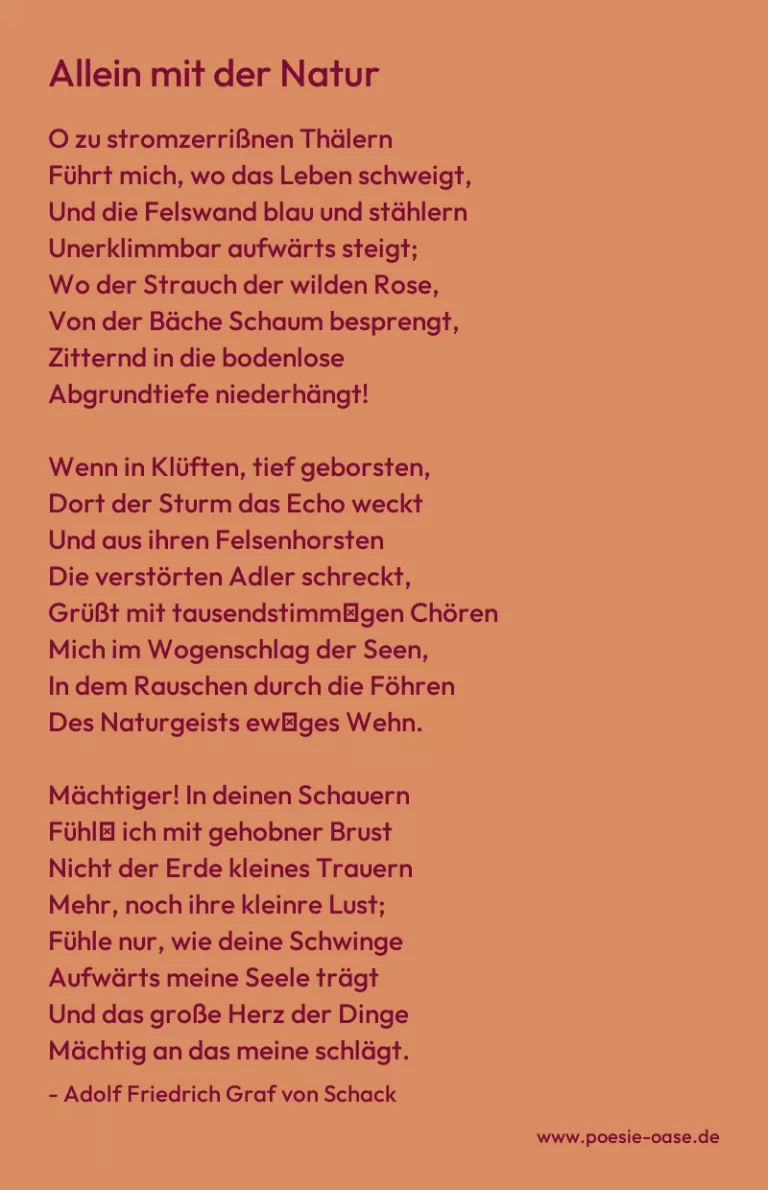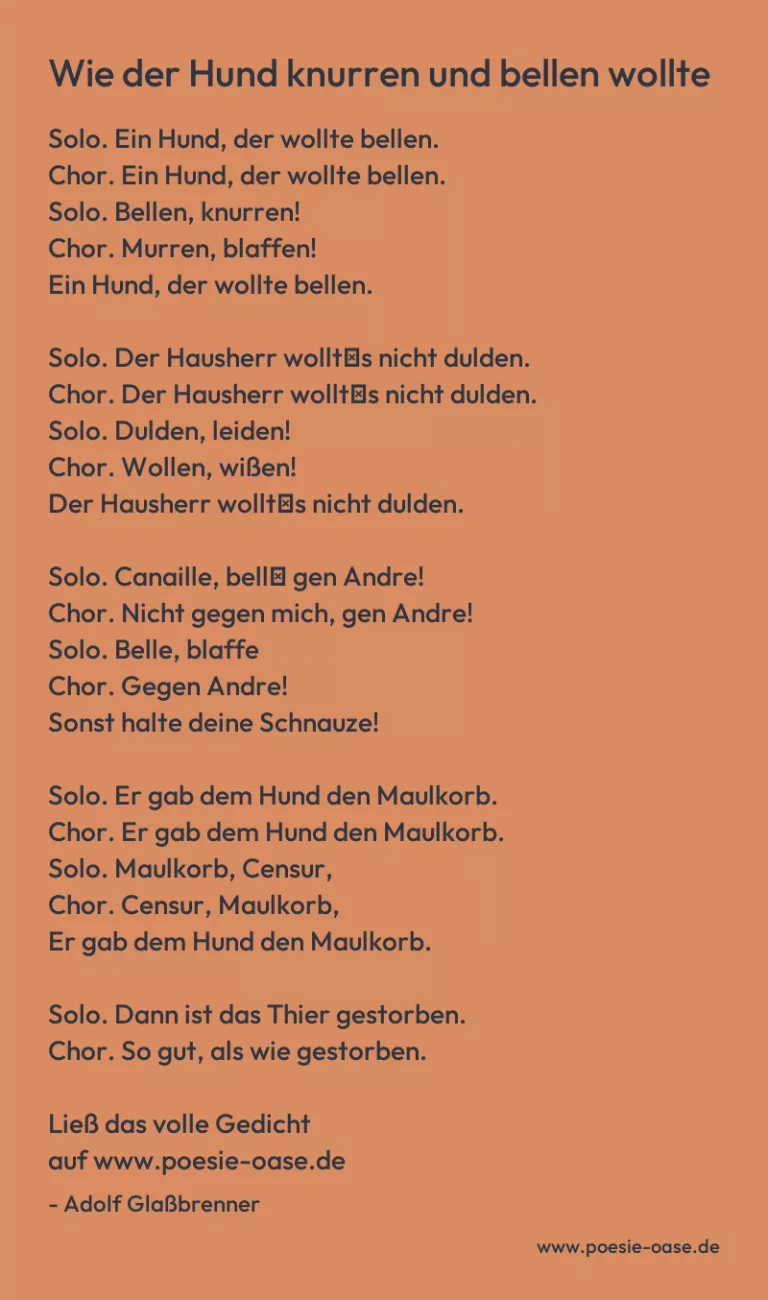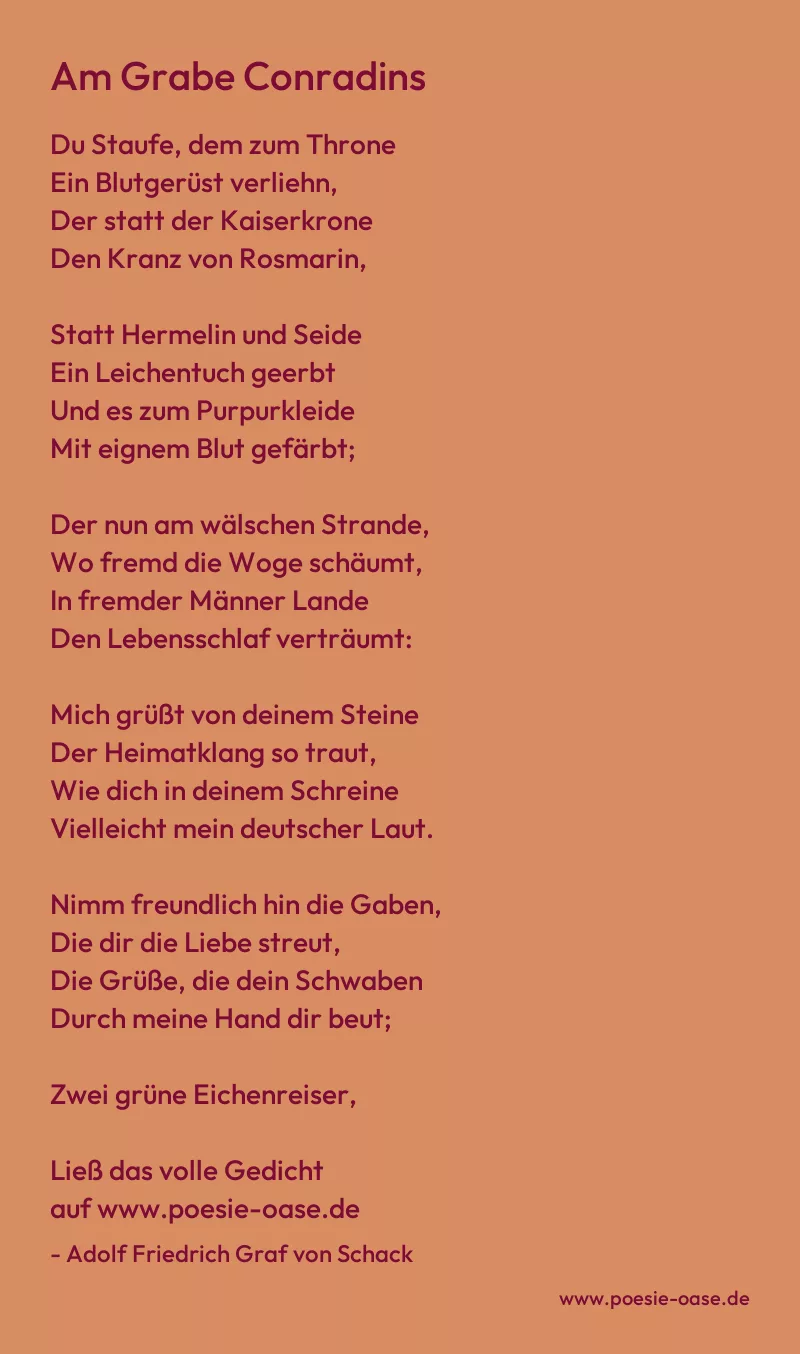Du Staufe, dem zum Throne
Ein Blutgerüst verliehn,
Der statt der Kaiserkrone
Den Kranz von Rosmarin,
Statt Hermelin und Seide
Ein Leichentuch geerbt
Und es zum Purpurkleide
Mit eignem Blut gefärbt;
Der nun am wälschen Strande,
Wo fremd die Woge schäumt,
In fremder Männer Lande
Den Lebensschlaf verträumt:
Mich grüßt von deinem Steine
Der Heimatklang so traut,
Wie dich in deinem Schreine
Vielleicht mein deutscher Laut.
Nimm freundlich hin die Gaben,
Die dir die Liebe streut,
Die Grüße, die dein Schwaben
Durch meine Hand dir beut;
Zwei grüne Eichenreiser,
Am Staufenschloß gepflückt,
Wie sie, du junger Kaiser,
Dir oft das Haupt geschmückt,
Wenn über Alp′ und Kuppe,
Vom Waldesgrün umwogt,
In froher Jägertruppe
Ihr aus zum Birschen zogt.
O schlügen tief und tiefer
Sie Wurzeln in dem Stein,
So wie auf kahlem Schiefer
Die Tannen stolz gedeihn,
Und streuten sie als Bäume,
Von frischem Grün umlaubt,
Dir liebe alte Träume
Ums früh gesunkne Haupt!
Dann statt des dumpfen Ave,
Das durch die Wölbung hallt,
Umspielte dich im Schlafe
Ein Ton, der süßer schallt;
Ein Ton aus besserm Dome,
Aus deutschem Eichenhain,
Ein Gruß vom Donaustrome
Und vom geliebten Rhein,
Und säuselnd stiege nieder
Aus grünem Laub der Klang,
So süß wie Uhlands Lieder
Und Walthers Minnesang.