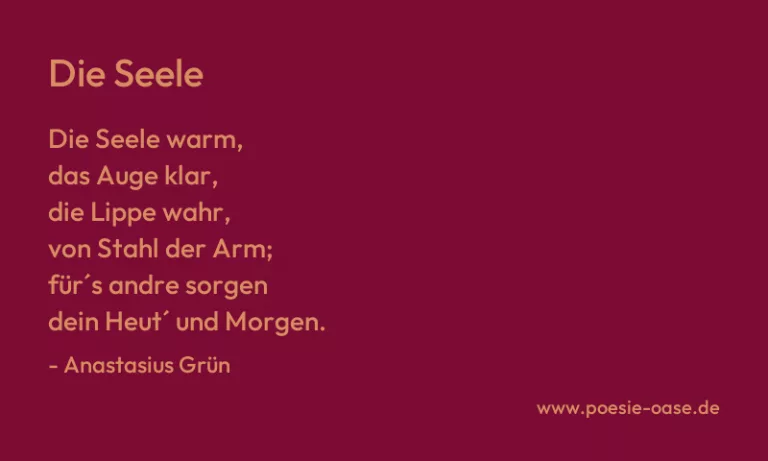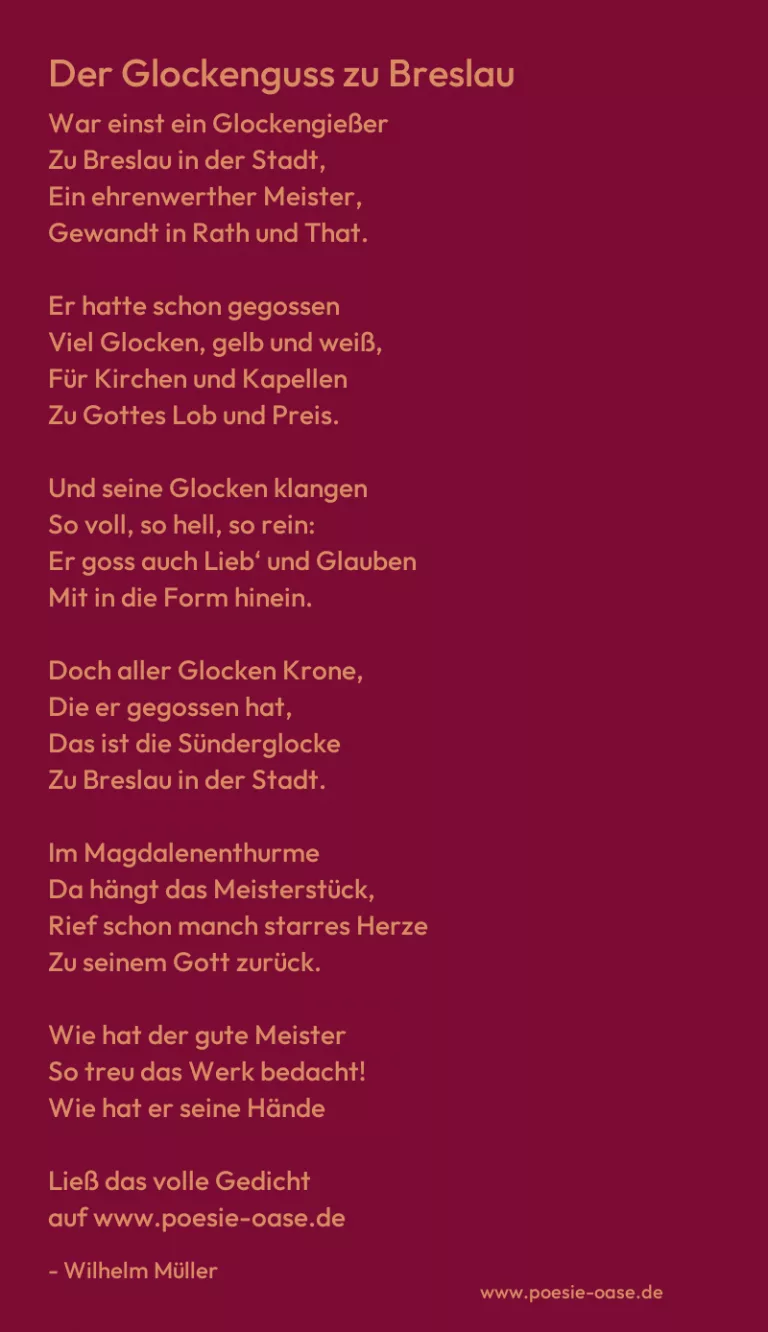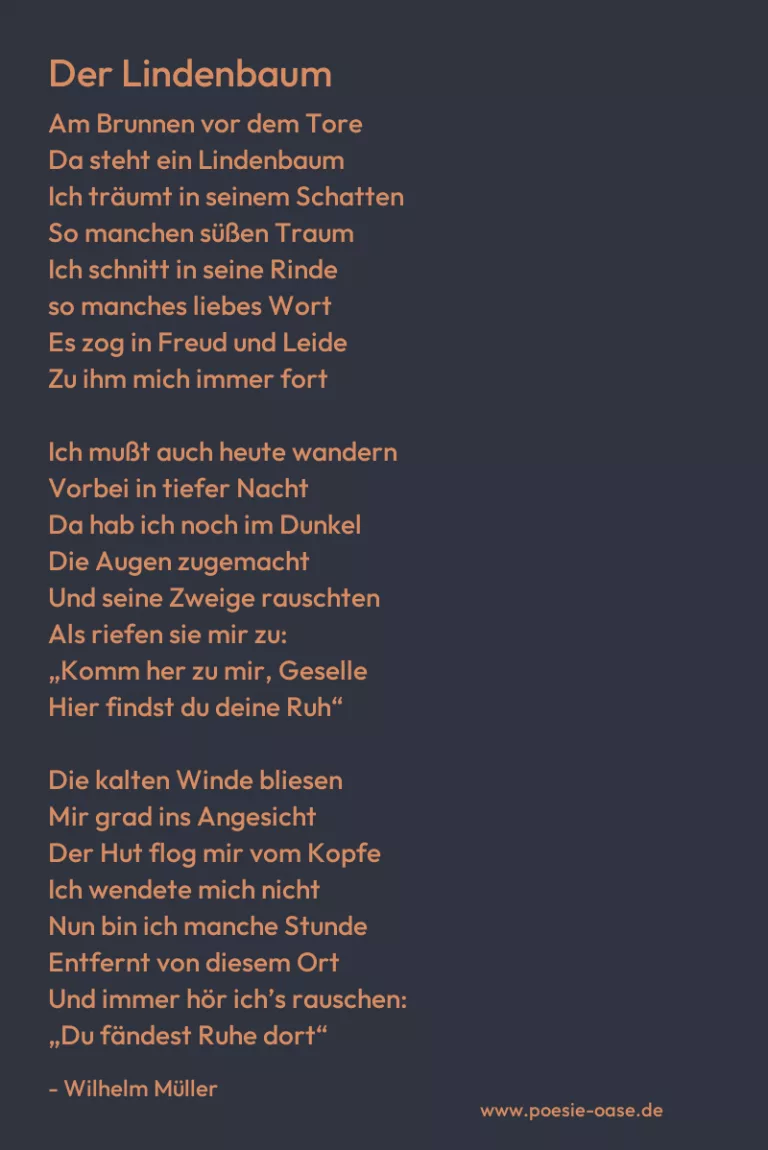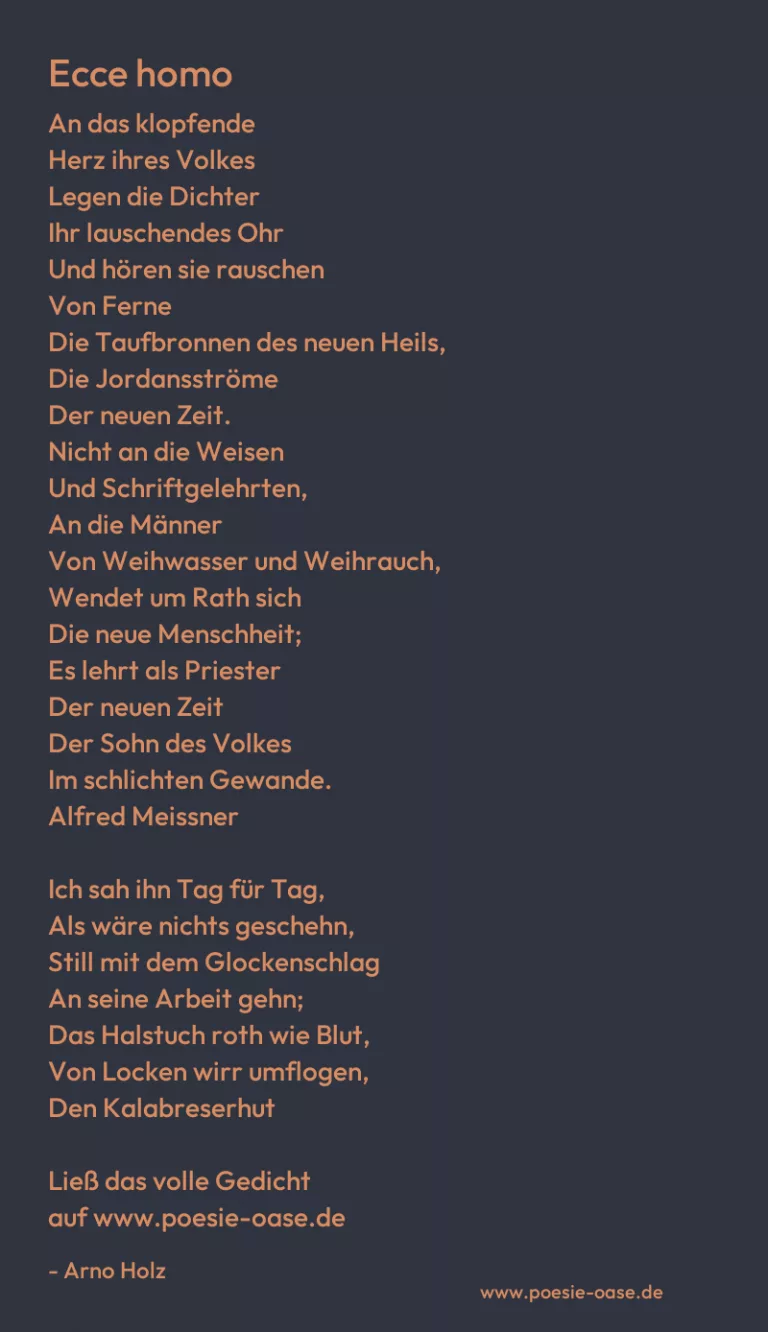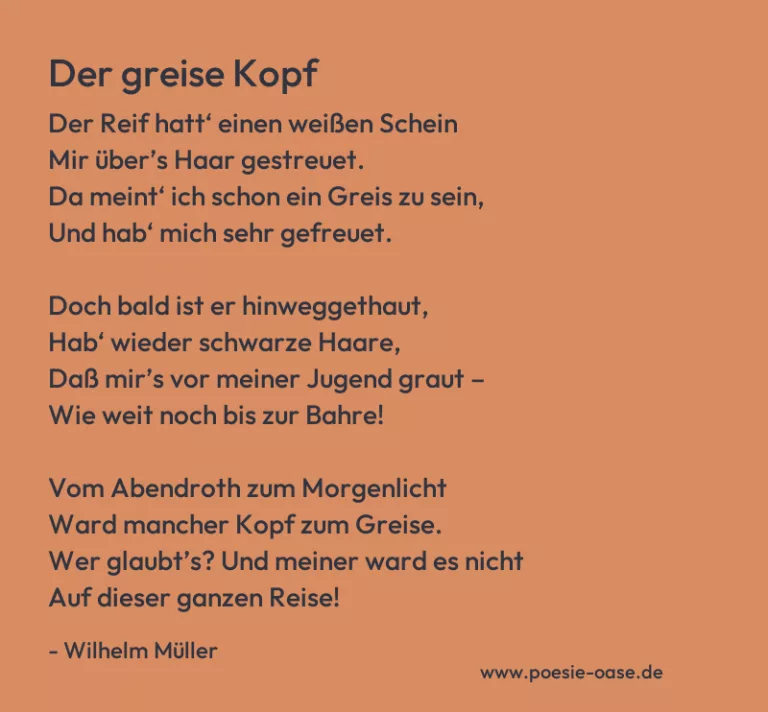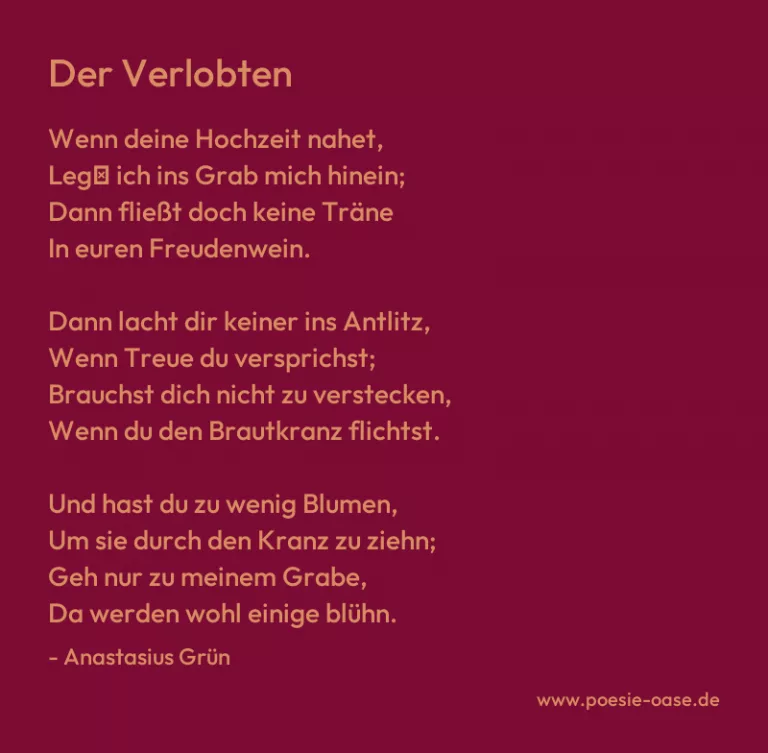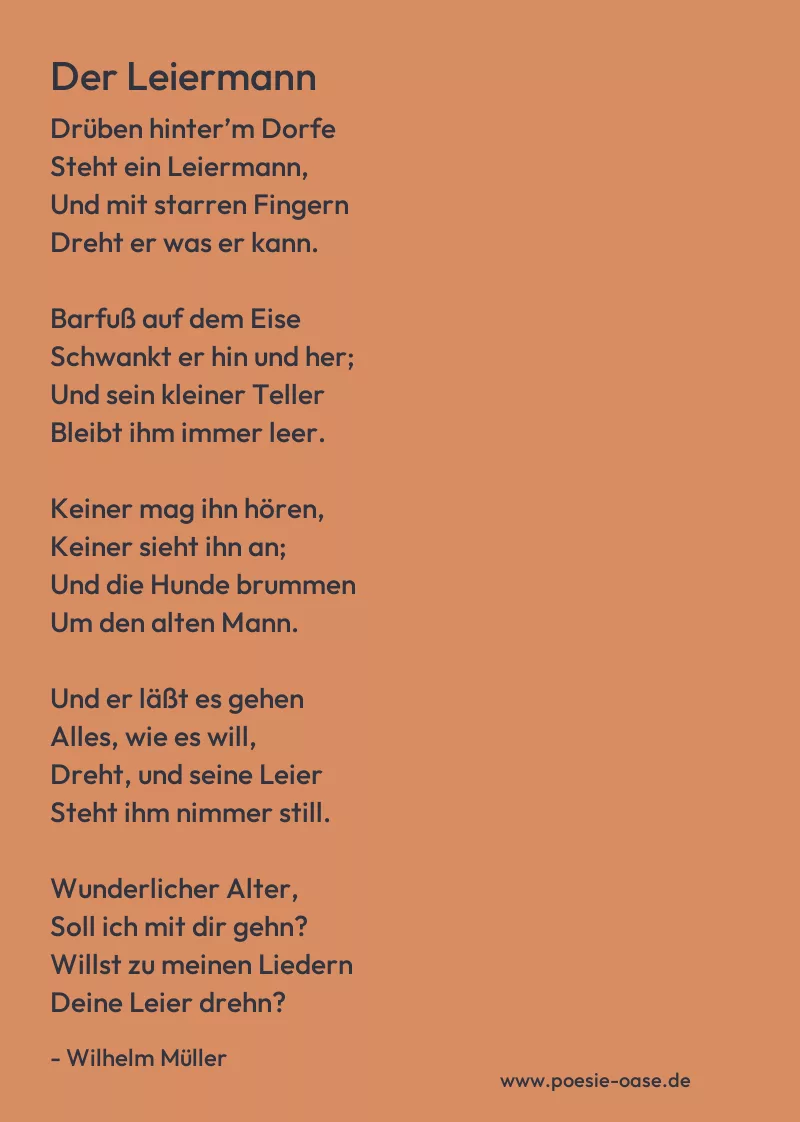Der Leiermann
Drüben hinter’m Dorfe
Steht ein Leiermann,
Und mit starren Fingern
Dreht er was er kann.
Barfuß auf dem Eise
Schwankt er hin und her;
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.
Keiner mag ihn hören,
Keiner sieht ihn an;
Und die Hunde brummen
Um den alten Mann.
Und er läßt es gehen
Alles, wie es will,
Dreht, und seine Leier
Steht ihm nimmer still.
Wunderlicher Alter,
Soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
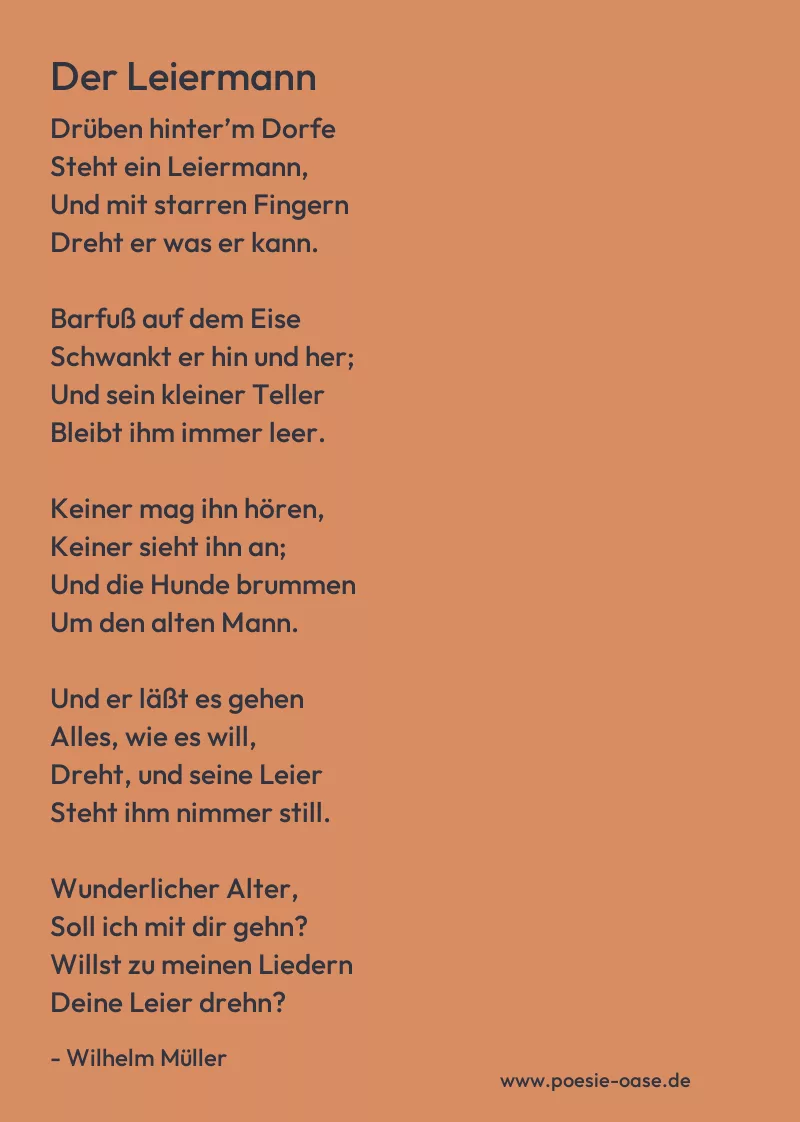
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Leiermann“ von Wilhelm Müller vermittelt eine eindrucksvolle Darstellung von Einsamkeit, Verzweiflung und der scheinbaren Bedeutungslosigkeit des Lebens. Der „Leiermann“, ein alter Mann, spielt mit starren Fingern auf seiner Leier, und obwohl er sich bemüht, „was er kann“, bleibt seine Bemühung unbeachtet und erfolglos. Der Mann, der „barfuß auf dem Eise“ schwankt, ist von der Kälte und Einsamkeit umgeben. Der Eisboden, auf dem er sich bewegt, verstärkt das Bild der Isolation und der Unbeweglichkeit, während der „kleine Teller“ leer bleibt, was seine Armut und den Mangel an Anerkennung für seine Mühen symbolisiert.
In der zweiten Strophe beschreibt Müller die völlige Gleichgültigkeit der Welt gegenüber dem Leiermann. „Keiner mag ihn hören, / Keiner sieht ihn an“ – diese Zeilen verdeutlichen, wie der Mann von der Gesellschaft abgelehnt und ignoriert wird. Selbst die Hunde, die in der Nähe sind, „brummen“ nur um ihn, was seine Ausgrenzung und seine Bedeutungslosigkeit unterstreicht. Diese Szene könnte als Metapher für das Schicksal von Menschen gesehen werden, die von der Gesellschaft vergessen werden und in Armut und Isolation leben, ohne Hoffnung auf Veränderung.
Trotz dieser Abweisung bleibt der Leiermann in seinem Handeln unaufhörlich. Er „lässt es gehen“ und spielt weiter, ohne sich um seine Umstände zu kümmern. Die Leier „steht ihm nimmer still“, was symbolisieren könnte, dass seine Bemühungen in einem endlosen Kreis von Bedeutungslosigkeit gefangen sind – eine endlose Wiederholung ohne Aussicht auf Veränderung. Diese passiv-resignierte Haltung wird verstärkt durch das Bild des Alters, das für den Leiermann steht.
Am Ende des Gedichts kommt die Frage des lyrischen Ichs: „Soll ich mit dir gehn? / Willst zu meinen Liedern / Deine Leier drehn?“ Diese Frage ist sowohl eine Einladung als auch eine Reflexion über die Beziehung zwischen dem Ich und dem Leiermann. Das lyrische Ich scheint von einer gewissen Faszination oder Sympathie für den Leiermann ergriffen zu sein, stellt sich jedoch gleichzeitig die Frage, ob es sich lohnt, diesem Weg der Einsamkeit und des endlosen Wiederholens zu folgen. Der Leiermann wird hier nicht nur als ein symbolisches Bild für das Ende des Lebens und die Vergeblichkeit menschlichen Strebens dargestellt, sondern auch als eine Einladung zu einer Art Verbindung, die sowohl traurig als auch tröstlich erscheint.
Wilhelm Müller zeichnet in diesem Gedicht ein düsteres Bild von Verzweiflung, aber auch von unaufhörlicher Hingabe. Der Leiermann ist ein Symbol für die Bedeutungslosigkeit und das Leiden, aber auch für die unaufhörliche Entschlossenheit, weiterzumachen, selbst wenn niemand zu hören scheint.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.