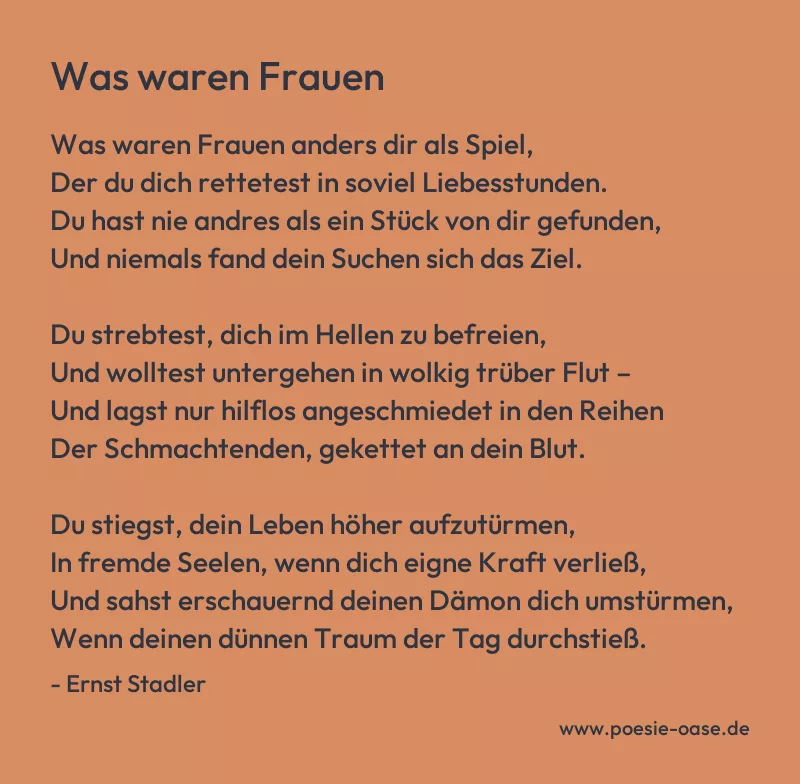Was waren Frauen
Was waren Frauen anders dir als Spiel,
Der du dich rettetest in soviel Liebesstunden.
Du hast nie andres als ein Stück von dir gefunden,
Und niemals fand dein Suchen sich das Ziel.
Du strebtest, dich im Hellen zu befreien,
Und wolltest untergehen in wolkig trüber Flut –
Und lagst nur hilflos angeschmiedet in den Reihen
Der Schmachtenden, gekettet an dein Blut.
Du stiegst, dein Leben höher aufzutürmen,
In fremde Seelen, wenn dich eigne Kraft verließ,
Und sahst erschauernd deinen Dämon dich umstürmen,
Wenn deinen dünnen Traum der Tag durchstieß.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
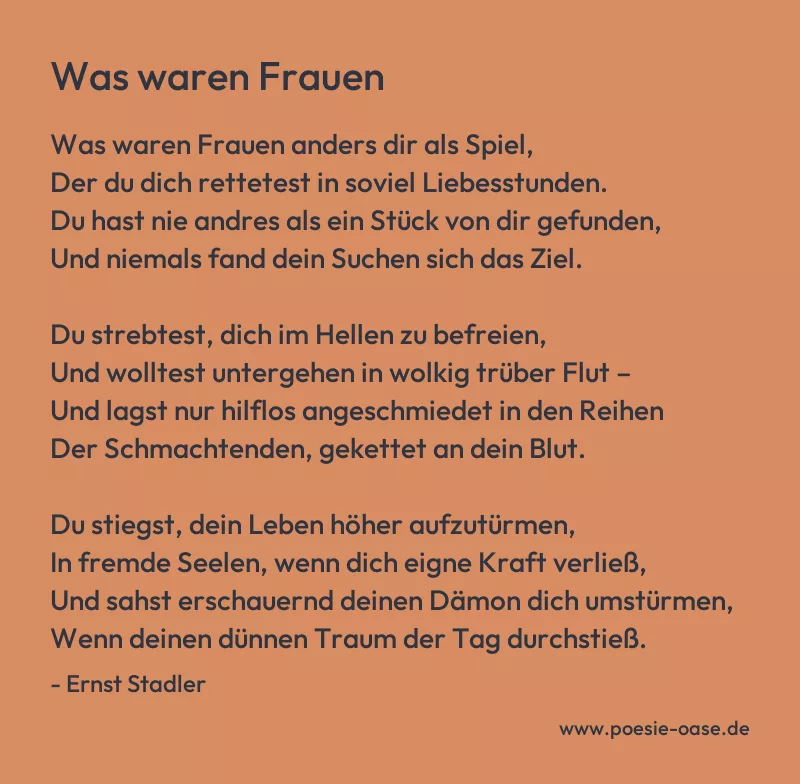
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Was waren Frauen“ von Ernst Stadler ist eine bittere Reflexion über die Beziehung des lyrischen Ichs zu Frauen, die von einem Gefühl der Leere und Selbsttäuschung geprägt ist. Es zeichnet das Bild eines Mannes, der Frauen als Mittel zur Selbstbefriedigung und Zerstreuung betrachtet, aber letztendlich unfähig ist, eine tiefe oder erfüllende Verbindung einzugehen. Die Sprache ist von einer gewissen Distanziertheit und Ernüchterung geprägt, die die Unfähigkeit des Ichs widerspiegelt, wahre Intimität zu erfahren.
In der ersten Strophe wird die oberflächliche Natur der Beziehungen des Ichs zu Frauen deutlich. Sie werden als „Spiel“ betrachtet, in dem er sich „rettete“ und „Liebesstunden“ verbrachte. Diese Worte deuten auf eine Flucht vor der Einsamkeit und eine Suche nach vorübergehender Ablenkung hin. Die Zeile „Du hast nie andres als ein Stück von dir gefunden“ unterstreicht die Ich-Bezogenheit des Mannes und seine Unfähigkeit, die Frauen als eigenständige Individuen zu sehen. Das „Ziel“ seines Suchens bleibt unerreichbar, was auf eine tiefe Unzufriedenheit und ein Gefühl der Sinnlosigkeit hindeutet.
Die zweite Strophe vertieft das Bild der inneren Zerrissenheit und des Scheiterns. Das Ich versucht, sich „im Hellen zu befreien“, was als Versuch interpretiert werden kann, aus dem Kreislauf der Oberflächlichkeit auszubrechen. Doch diese Bemühungen scheitern, und er landet in einer „wolkig trüber Flut“, in der er „hilflos angeschmiedet“ und von seinem „Blut“ gefesselt ist. Diese Bilder deuten auf ein Gefühl der Ohnmacht, der Unfreiheit und der Selbstzerstörung hin. Die Bindung an das eigene Blut könnte als ein Hinweis auf die Abhängigkeit von Trieben und Begierden interpretiert werden, die ihn gefangen halten.
Die dritte Strophe offenbart die verzweifelte Suche des Ichs nach Transzendenz und die Erkenntnis der eigenen Grenzen. Der Versuch, „in fremde Seelen“ einzudringen, wenn die eigene Kraft versagt, deutet auf eine Suche nach Erfüllung und Sinn in anderen Menschen hin. Doch auch diese Bemühungen scheitern, und das Ich wird von seinem „Dämon“ heimgesucht, wenn der „dünne Traum“ durch den Tag durchstoßen wird. Dies symbolisiert die Konfrontation mit der Realität, die das Scheitern der Illusionen und die Rückkehr zur Ernüchterung mit sich bringt. Insgesamt ist das Gedicht eine ergreifende Auseinandersetzung mit der menschlichen Suche nach Liebe und Erfüllung, die durch die Unfähigkeit des Ichs, wahre Intimität zu erfahren, geprägt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.