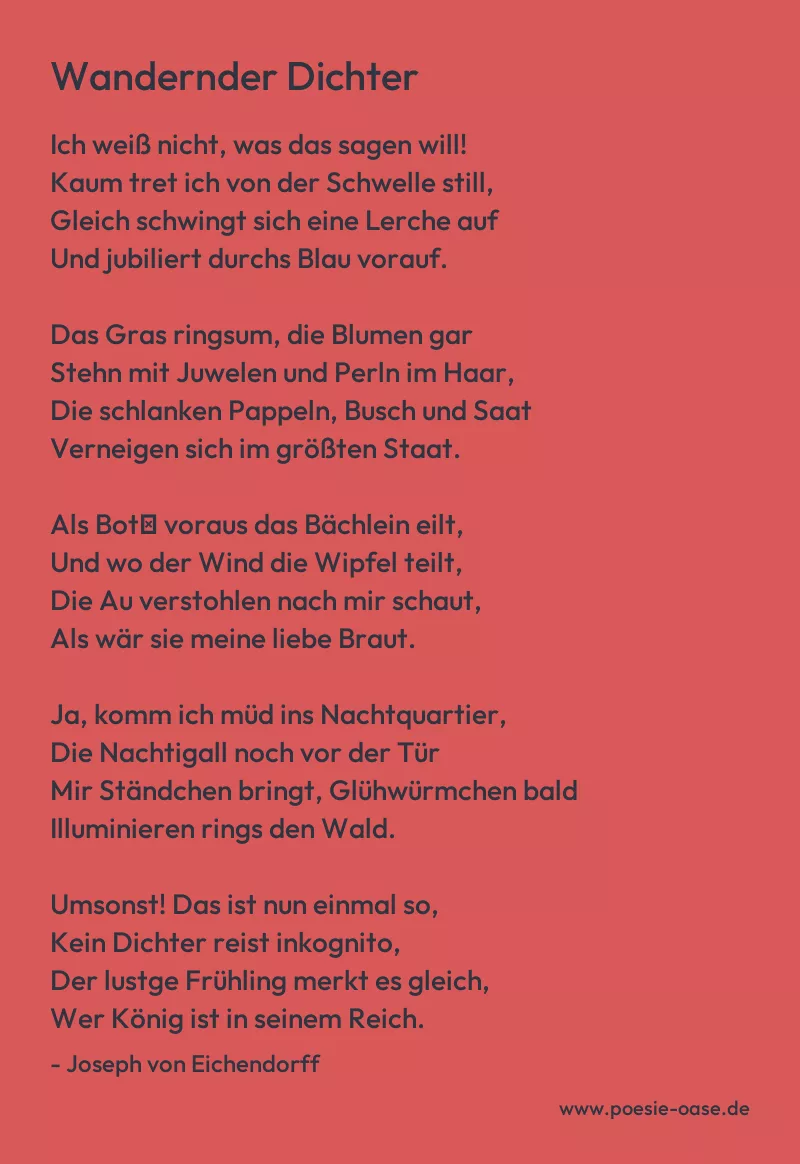Wandernder Dichter
Ich weiß nicht, was das sagen will!
Kaum tret ich von der Schwelle still,
Gleich schwingt sich eine Lerche auf
Und jubiliert durchs Blau vorauf.
Das Gras ringsum, die Blumen gar
Stehn mit Juwelen und Perln im Haar,
Die schlanken Pappeln, Busch und Saat
Verneigen sich im größten Staat.
Als Bot′ voraus das Bächlein eilt,
Und wo der Wind die Wipfel teilt,
Die Au verstohlen nach mir schaut,
Als wär sie meine liebe Braut.
Ja, komm ich müd ins Nachtquartier,
Die Nachtigall noch vor der Tür
Mir Ständchen bringt, Glühwürmchen bald
Illuminieren rings den Wald.
Umsonst! Das ist nun einmal so,
Kein Dichter reist inkognito,
Der lustge Frühling merkt es gleich,
Wer König ist in seinem Reich.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
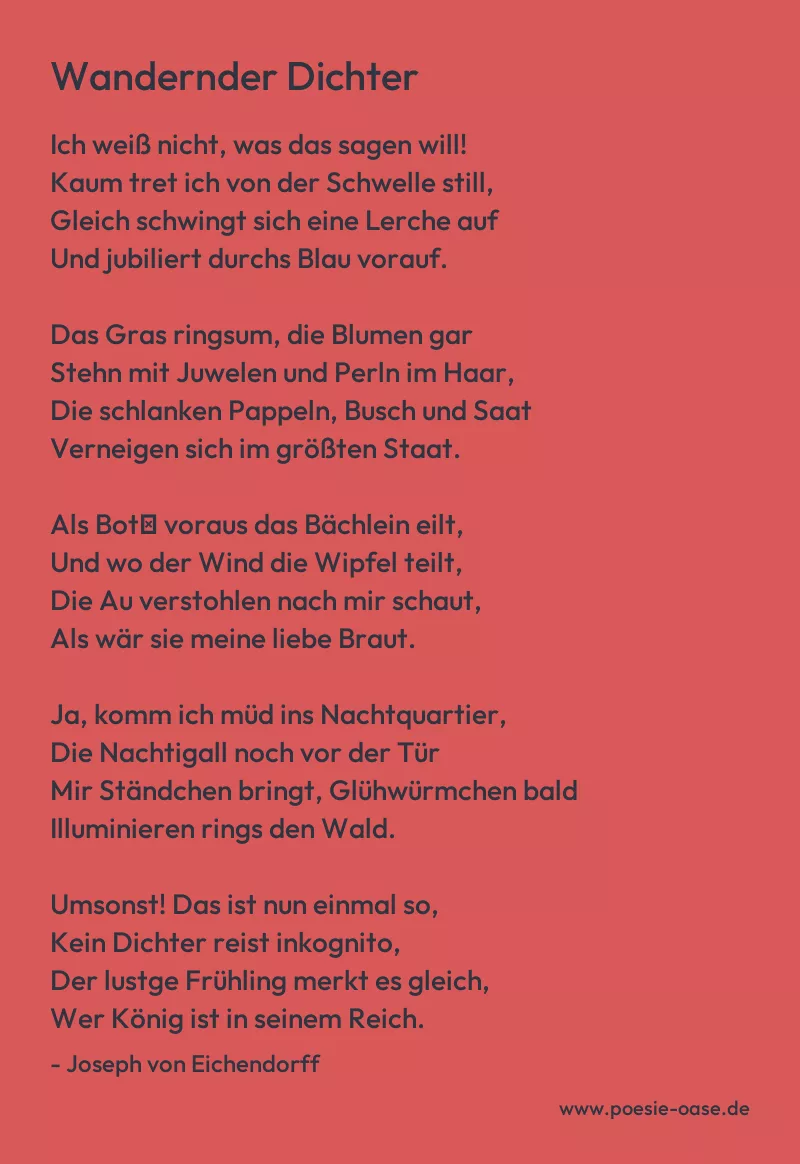
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wandernder Dichter“ von Joseph von Eichendorff ist eine heitere und selbstironische Reflexion über die Rolle und Wahrnehmung des Dichters in der Natur. Der Dichter scheint von der Natur als eine Art König empfangen und beachtet zu werden, wobei die Elemente und Geschöpfe um ihn herum eine lebendige, geradezu theatralische Inszenierung seines Auftritts veranstalten. Die Verse spiegeln die romantische Vorstellung wider, dass der Dichter mit der Natur auf besondere Weise verbunden ist und eine besondere Wertschätzung erfährt.
Die erste Strophe etabliert sofort die lebendige Reaktion der Natur auf die Anwesenheit des Dichters. Das Auftreten der Lerche und ihre jubelnde Begleitung durch den blauen Himmel deuten auf eine freudige Begrüßung hin, welche die Wertschätzung der Natur für den Dichter symbolisiert. Die darauffolgenden Strophen setzen diese Inszenierung fort und erweitern sie um weitere Elemente: Die Blumen, das Gras, die Pappeln und das Bächlein, die sich in einer Art Zeremonie dem Dichter zuwenden. Diese übertriebene, fast kitschige Darstellung unterstreicht die Ironie und den humorvollen Ton des Gedichts.
In der dritten Strophe erreicht die Natur ihren Höhepunkt der Aufmerksamkeit, indem die Au – das Wiesenland – den Dichter als seine „liebe Braut“ wahrnimmt, was die romantische Verbundenheit zwischen Dichter und Natur zusätzlich verdeutlicht. Auch in der Nacht setzt sich die Feier fort: Die Nachtigall bringt ein Ständchen, und die Glühwürmchen erleuchten den Wald. Diese detailreichen Beschreibungen verstärken den Eindruck einer überwältigenden, ja fast übertriebenen Würdigung des Dichters.
Die abschließende Strophe enthüllt die Moral des Gedichts: Der Dichter kann, wie ein König, seine Identität nicht verbergen, da der Frühling – als Repräsentant der Natur – ihn sofort erkennt und würdigt. Die letzten Zeilen unterstreichen die Ironie, dass der Dichter, unweigerlich von der Natur wahrgenommen und gefeiert wird, ohne die Möglichkeit zu haben, inkognito zu reisen. Das Gedicht feiert die einzigartige Position des Dichters in der Welt und nimmt zugleich seine Selbstwahrnehmung mit einem Augenzwinkern aufs Korn.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.