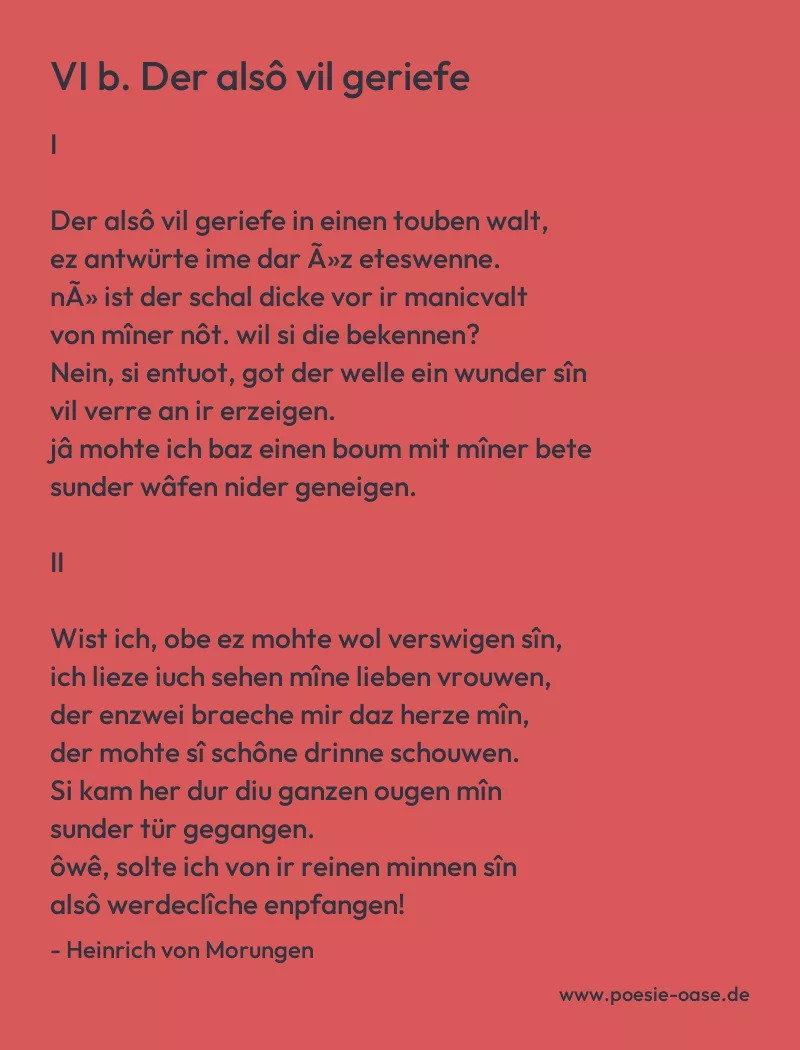VI b. Der alsô vil geriefe
I
Der alsô vil geriefe in einen touben walt,
ez antwürte ime dar ûz eteswenne.
nû ist der schal dicke vor ir manicvalt
von mîner nôt. wil si die bekennen?
Nein, si entuot, got der welle ein wunder sîn
vil verre an ir erzeigen.
jâ mohte ich baz einen boum mit mîner bete
sunder wâfen nider geneigen.
II
Wist ich, obe ez mohte wol verswigen sîn,
ich lieze iuch sehen mîne lieben vrouwen,
der enzwei braeche mir daz herze mîn,
der mohte sî schône drinne schouwen.
Si kam her dur diu ganzen ougen mîn
sunder tür gegangen.
ôwê, solte ich von ir reinen minnen sîn
alsô werdeclîche enpfangen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
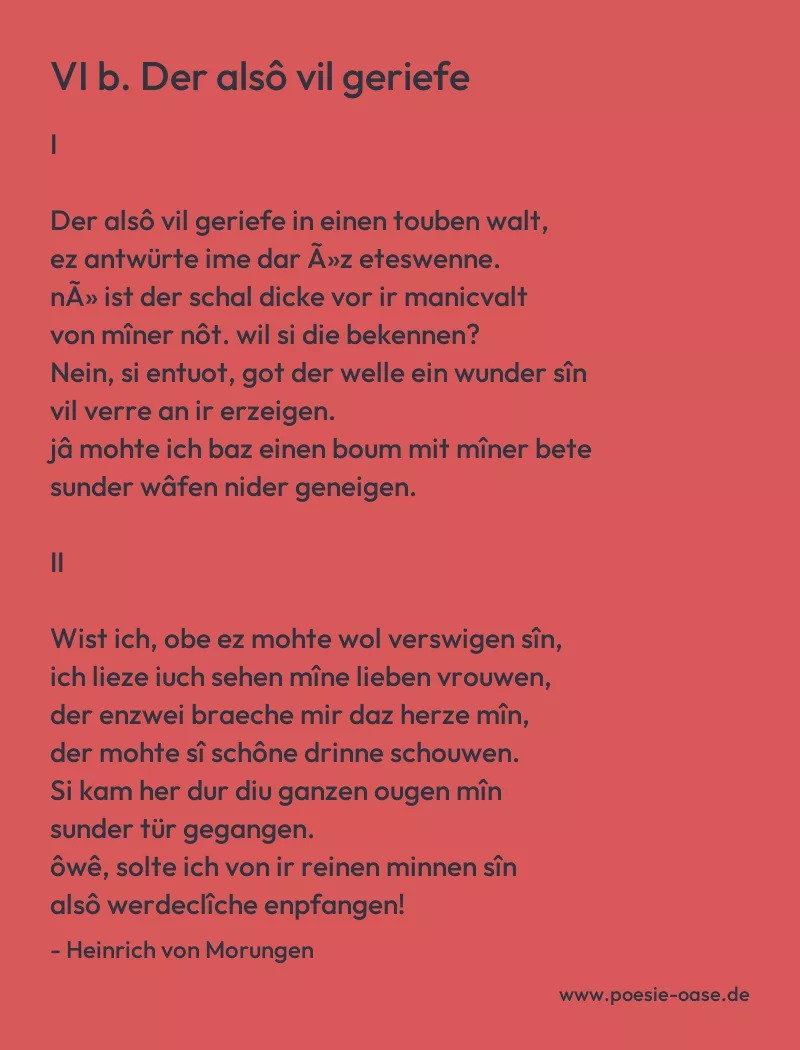
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „VI b. Der alsô vil geriefe“ von Heinrich von Morungen ist eine Minnedichtung, die von der unerwiderten Liebe und der daraus resultierenden Verzweiflung des Sprechers handelt. Das Gedicht ist in zwei Strophen unterteilt, die jeweils durch unterschiedliche Bilder und Emotionen geprägt sind.
In der ersten Strophe drückt der Sprecher seine tiefe Trauer und Hoffnungslosigkeit aus. Er vergleicht seine vergeblichen Rufe in einen „touben walt“ (tauben Wald), der nicht antwortet, mit seiner Situation in der Liebe. Der Wald symbolisiert hier die Gleichgültigkeit der Geliebten. Der Sprecher fragt sich, ob sie sein Leid überhaupt wahrnimmt, und konstatiert dann, dass sie es nicht tut. Er sehnt sich nach einem „Wunder“, das seine Situation verändert, und wünscht sich, die Geliebte möge seine Not erkennen. Seine Verzweiflung wird durch den Vergleich verstärkt, dass er „baz einen boum mit mîner bete / sunder wâfen nider geneigen“ (besser einen Baum mit meiner Bitte ohne Waffen niedersenken) könnte, als die Geliebte zu erweichen. Dies verdeutlicht die scheinbar unüberwindbare Natur seiner unerwiderten Liebe.
Die zweite Strophe offenbart die Sehnsucht des Sprechers und die Intensität seiner Liebe. Er sehnt sich danach, seine geliebte Frau der Welt zu zeigen. Der Ausdruck „der enzwei braeche mir daz herze mîn“ (die mein Herz entzweibrechen würde) unterstreicht die Zerrissenheit, die die Liebe verursacht. Die Vorstellung, dass sie durch seine „ganzen ougen“ (ganzen Augen) in ihn eingedrungen ist, ohne eine Tür zu benötigen, deutet auf eine tiefe und unaufhaltsame Verbindung hin, die aber leider unerwidert zu sein scheint. Die Sehnsucht nach der Liebe und dem Glück des Empfangens wird durch das „ôwê“ (ach weh) verstärkt, welches die Tragik der Situation noch weiter unterstreicht und seine Erwartungen an die Reinheit seiner Liebe verdeutlicht.
Das Gedicht ist typisch für die Minnedichtung des Mittelalters. Es thematisiert die leidenschaftliche Liebe, das Leiden des Liebenden und die Sehnsucht nach Vereinigung. Die Sprache ist geprägt von tiefen Emotionen und poetischen Bildern. Die Verwendung des Reimschemas und der einfachen Sprache verstärkt die Intensität der Gefühle und macht das Gedicht auch für heutige Leser zugänglich. Morungen verwendet in diesem Gedicht eine subtile Kombination von Verzweiflung und Sehnsucht, die die Tragik der unerwiderten Liebe auf eindrucksvolle Weise darstellt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.