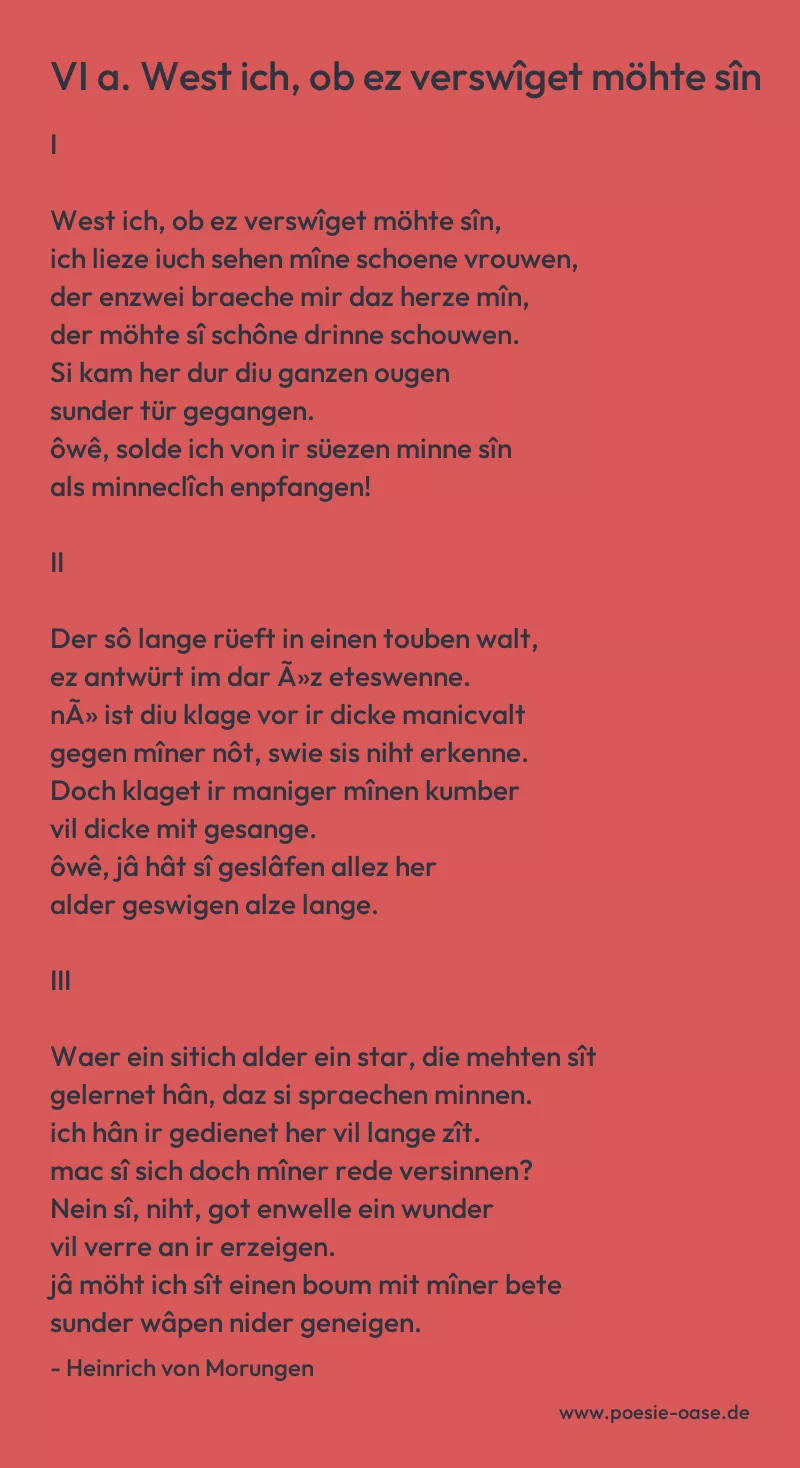VI a. West ich, ob ez verswîget möhte sîn
I
West ich, ob ez verswîget möhte sîn,
ich lieze iuch sehen mîne schoene vrouwen,
der enzwei braeche mir daz herze mîn,
der möhte sî schône drinne schouwen.
Si kam her dur diu ganzen ougen
sunder tür gegangen.
ôwê, solde ich von ir süezen minne sîn
als minneclîch enpfangen!
II
Der sô lange rüeft in einen touben walt,
ez antwürt im dar ûz eteswenne.
nû ist diu klage vor ir dicke manicvalt
gegen mîner nôt, swie sis niht erkenne.
Doch klaget ir maniger mînen kumber
vil dicke mit gesange.
ôwê, jâ hât sî geslâfen allez her
alder geswigen alze lange.
III
Waer ein sitich alder ein star, die mehten sît
gelernet hân, daz si spraechen minnen.
ich hân ir gedienet her vil lange zît.
mac sî sich doch mîner rede versinnen?
Nein sî, niht, got enwelle ein wunder
vil verre an ir erzeigen.
jâ möht ich sît einen boum mit mîner bete
sunder wâpen nider geneigen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
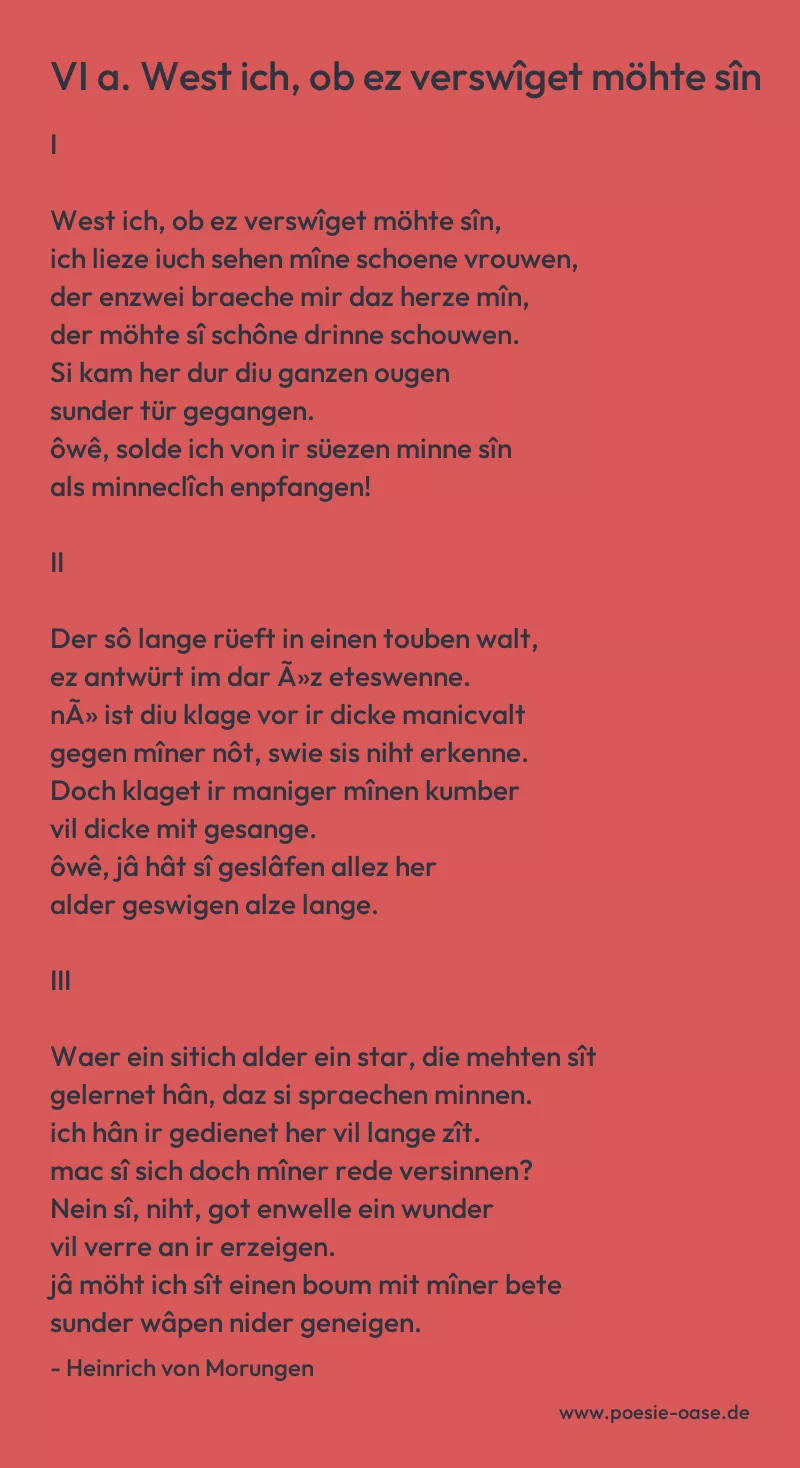
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „VI a. West ich, ob ez verswîget möhte sîn“ von Heinrich von Morungen ist eine feinfühlige Liebesklage, die die Sehnsucht und das Leid des Sprechers angesichts der unerwiderten Liebe thematisiert. Die Strophen offenbaren die Zerrissenheit des Liebenden, der sich nach der Schönheit seiner Angebeteten sehnt, aber gleichzeitig unter der Kälte und dem Schweigen der Geliebten leidet.
In der ersten Strophe drückt der Sprecher seinen Wunsch aus, die Schönheit seiner Geliebten allen offenbaren zu können, doch er erkennt die Unmöglichkeit dieses Unterfangens. Er beschreibt, wie sie „dur diu ganzen ougen“ in sein Herz gelangt ist, ohne dass er sich wehren konnte. Die Sehnsucht nach Zuneigung ist stark, doch sie bleibt unerfüllt, was den Sprecher in tiefe Trauer stürzt, die durch das wiederholte „ôwê“ verdeutlicht wird. Die ersehnte Reziprozität der Liebe, die ihn „minneclîch enpfangen“ sollte, bleibt aus.
Die zweite Strophe vertieft die Thematik des unerwiderten Wunsches. Der Sprecher vergleicht sich mit jemandem, der in einem tauben Wald ruft, in der Hoffnung auf eine Antwort, die jedoch ausbleibt. Seine Klage wird verstärkt durch das Wissen, dass er oft vor seiner Geliebten von seinem Kummer singt, was die Diskrepanz zwischen seiner Sehnsucht und der Realität verdeutlicht. Das lange Schweigen der Geliebten wird beklagt, wodurch die Strophe die Hoffnungslosigkeit und das Gefühl der Ablehnung des Sprechers widerspiegelt.
Die dritte Strophe unterstreicht die Verzweiflung und Ohnmacht des Sprechers. Er wünscht sich die Fähigkeit von Vögeln, die Liebesworte lernen können. Seine lange Zeit des Dienens und der Verehrung hat jedoch keine Wirkung gezeigt. Die abschließenden Verse zeigen eine weitere Eskalation des Schmerzes. Wenn selbst Gebete die Geliebte nicht erweichen können, ist es fast so, als ob der Sprecher eine übernatürliche Kraft benötigt, um sie zu beeinflussen. Die Verzweiflung des Sprechers erreicht hier ihren Höhepunkt. Das Gedicht endet mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und des tiefen Schmerzes über die Unerreichbarkeit der Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.