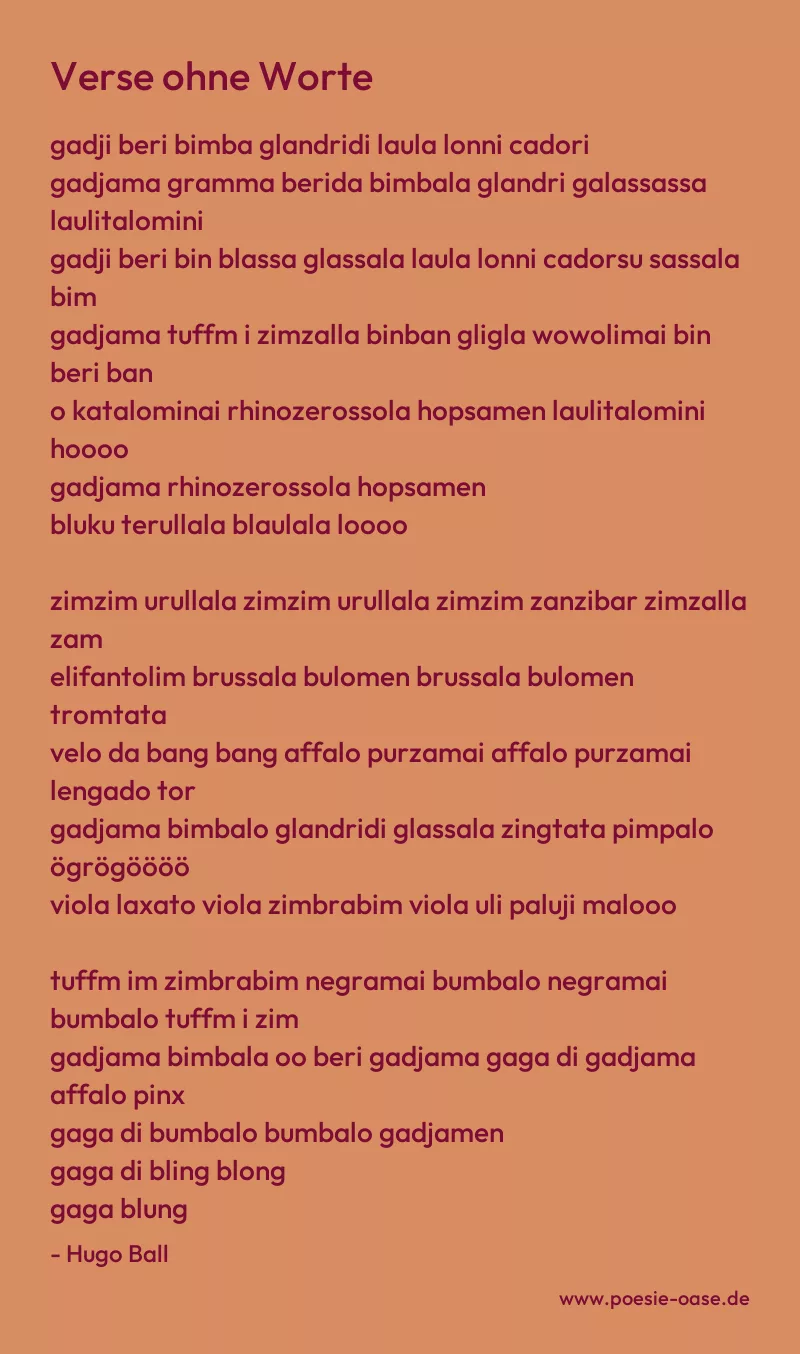Verse ohne Worte
gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori
gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa laulitalomini
gadji beri bin blassa glassala laula lonni cadorsu sassala bim
gadjama tuffm i zimzalla binban gligla wowolimai bin beri ban
o katalominai rhinozerossola hopsamen laulitalomini hoooo
gadjama rhinozerossola hopsamen
bluku terullala blaulala loooo
zimzim urullala zimzim urullala zimzim zanzibar zimzalla zam
elifantolim brussala bulomen brussala bulomen tromtata
velo da bang bang affalo purzamai affalo purzamai lengado tor
gadjama bimbalo glandridi glassala zingtata pimpalo ögrögöööö
viola laxato viola zimbrabim viola uli paluji malooo
tuffm im zimbrabim negramai bumbalo negramai bumbalo tuffm i zim
gadjama bimbala oo beri gadjama gaga di gadjama affalo pinx
gaga di bumbalo bumbalo gadjamen
gaga di bling blong
gaga blung
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
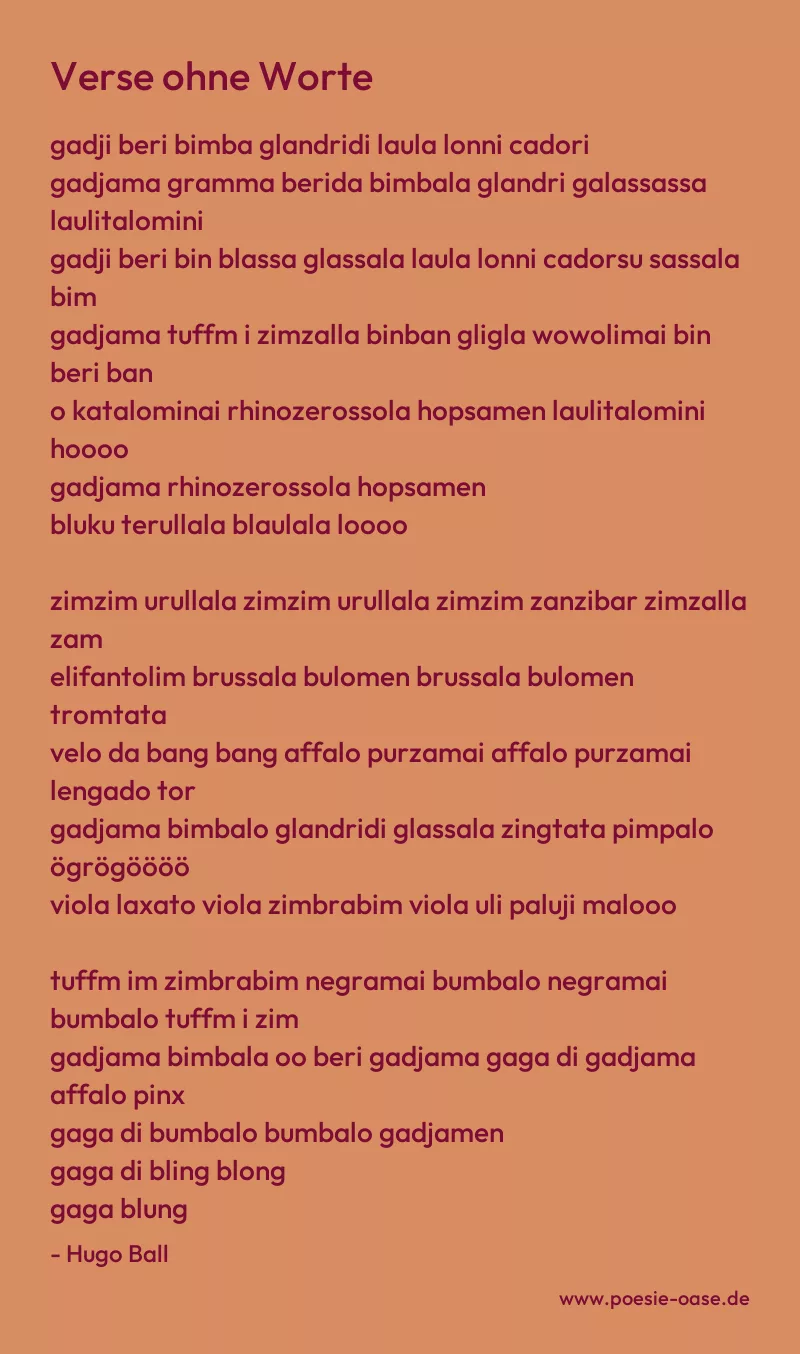
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Verse ohne Worte“ von Hugo Ball ist ein Paradebeispiel für Dadaistische Poesie, die sich bewusst von traditionellen Sprachkonventionen distanziert. Es ist weniger ein Gedicht im herkömmlichen Sinne, das eine Geschichte erzählt oder eine bestimmte Botschaft vermittelt, sondern vielmehr eine Klangkomposition, ein Spiel mit Worten und Silben, das die Grenzen der Sprache auslotet und deren Bedeutung hinterfragt.
Die Struktur des Gedichts ist durch eine Wiederholung von Silben, Lauten und Wörtern gekennzeichnet, die jeglichen semantischen Gehalt zu entleeren scheinen. Wörter wie „gadji“, „bimba“, „glandridi“, „laula“ und „zimzim“ tauchen immer wieder auf, oft in Kombinationen, die jeglicher logischen Ordnung entbehren. Diese Wiederholungen erzeugen einen rhythmischen, fast hypnotischen Effekt, der den Leser dazu einlädt, sich von der Bedeutung der Wörter zu lösen und sich stattdessen auf ihre klangliche Qualität zu konzentrieren. Der Gebrauch von Lautmalerei („tromtata“) und Interjektionen („hoooo“, „ögrögöööö“) verstärkt diesen Eindruck.
Das Gedicht zielt darauf ab, die konventionelle Vorstellung von Poesie als Ausdruck von Gefühlen, Gedanken oder Erfahrungen zu untergraben. Stattdessen präsentiert es eine völlig neue Form der Sprachverwendung, die sich der Rationalität und der Bedeutungsgewinnung entzieht. Es ist ein Protest gegen die konventionellen Werte der bürgerlichen Gesellschaft, die Hugo Ball mit seinem Dadaismus bekämpfen wollte. Das Gedicht versucht, die Welt neu zu erfahren, indem es die Sprache von ihren Fesseln befreit und sie in ein reines Klangereignis verwandelt.
Trotz seiner scheinbaren Sinnlosigkeit erzeugt das Gedicht eine bestimmte Atmosphäre. Durch die rhythmische Wiederholung, die Lautmalerei und die exotisch anmutenden Wörter entsteht eine Welt, die sowohl archaisch als auch futuristisch wirkt, fast wie ein archaischer Gesang oder ein futuristischer Choral. Es ist eine Welt des Spiels, der Freiheit und der Auflösung jeglicher Ordnung. Das Gedicht ist somit ein radikaler Akt der Sprachkritik und der künstlerischen Befreiung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.