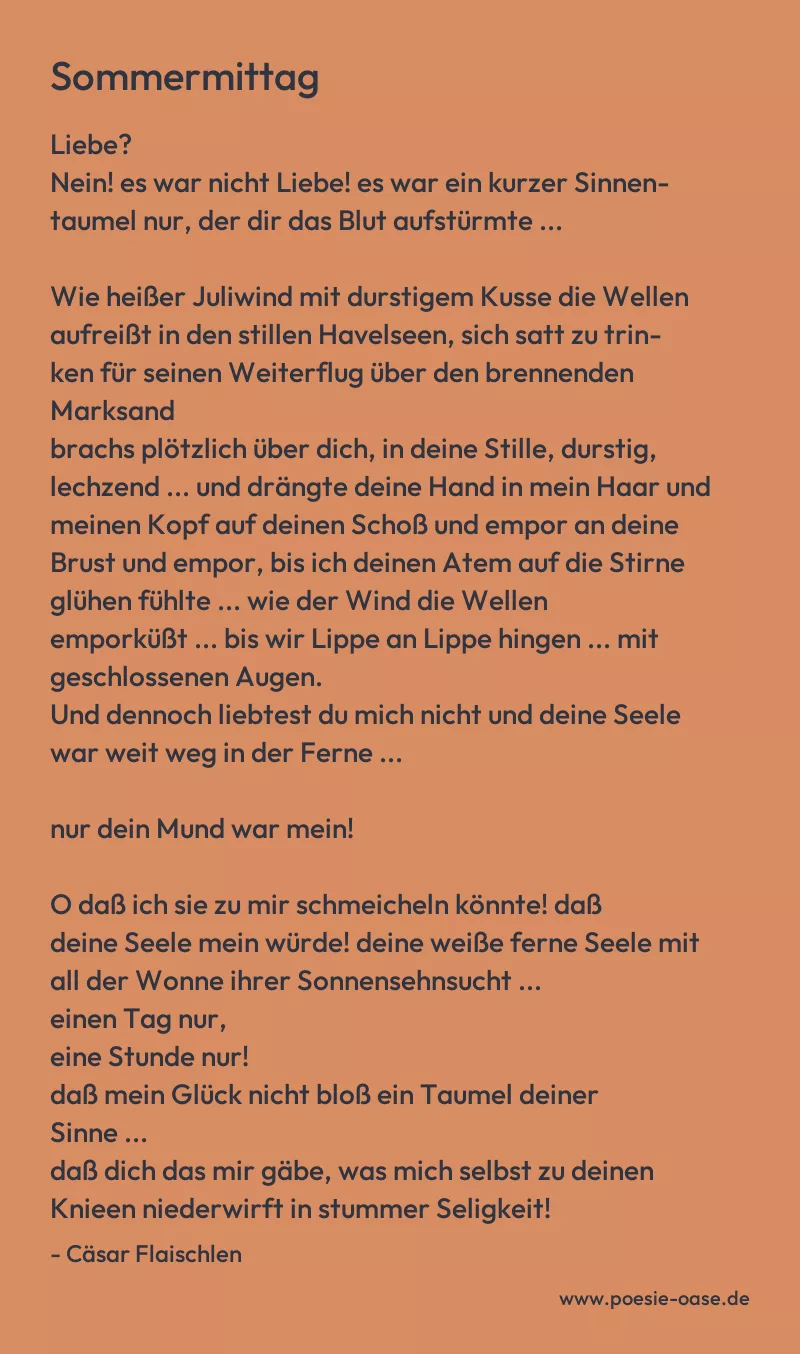Sommermittag
Liebe?
Nein! es war nicht Liebe! es war ein kurzer Sinnen-
taumel nur, der dir das Blut aufstürmte …
Wie heißer Juliwind mit durstigem Kusse die Wellen
aufreißt in den stillen Havelseen, sich satt zu trin-
ken für seinen Weiterflug über den brennenden
Marksand
brachs plötzlich über dich, in deine Stille, durstig,
lechzend … und drängte deine Hand in mein Haar und
meinen Kopf auf deinen Schoß und empor an deine
Brust und empor, bis ich deinen Atem auf die Stirne
glühen fühlte … wie der Wind die Wellen
emporküßt … bis wir Lippe an Lippe hingen … mit
geschlossenen Augen.
Und dennoch liebtest du mich nicht und deine Seele
war weit weg in der Ferne …
nur dein Mund war mein!
O daß ich sie zu mir schmeicheln könnte! daß
deine Seele mein würde! deine weiße ferne Seele mit
all der Wonne ihrer Sonnensehnsucht …
einen Tag nur,
eine Stunde nur!
daß mein Glück nicht bloß ein Taumel deiner
Sinne …
daß dich das mir gäbe, was mich selbst zu deinen
Knieen niederwirft in stummer Seligkeit!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
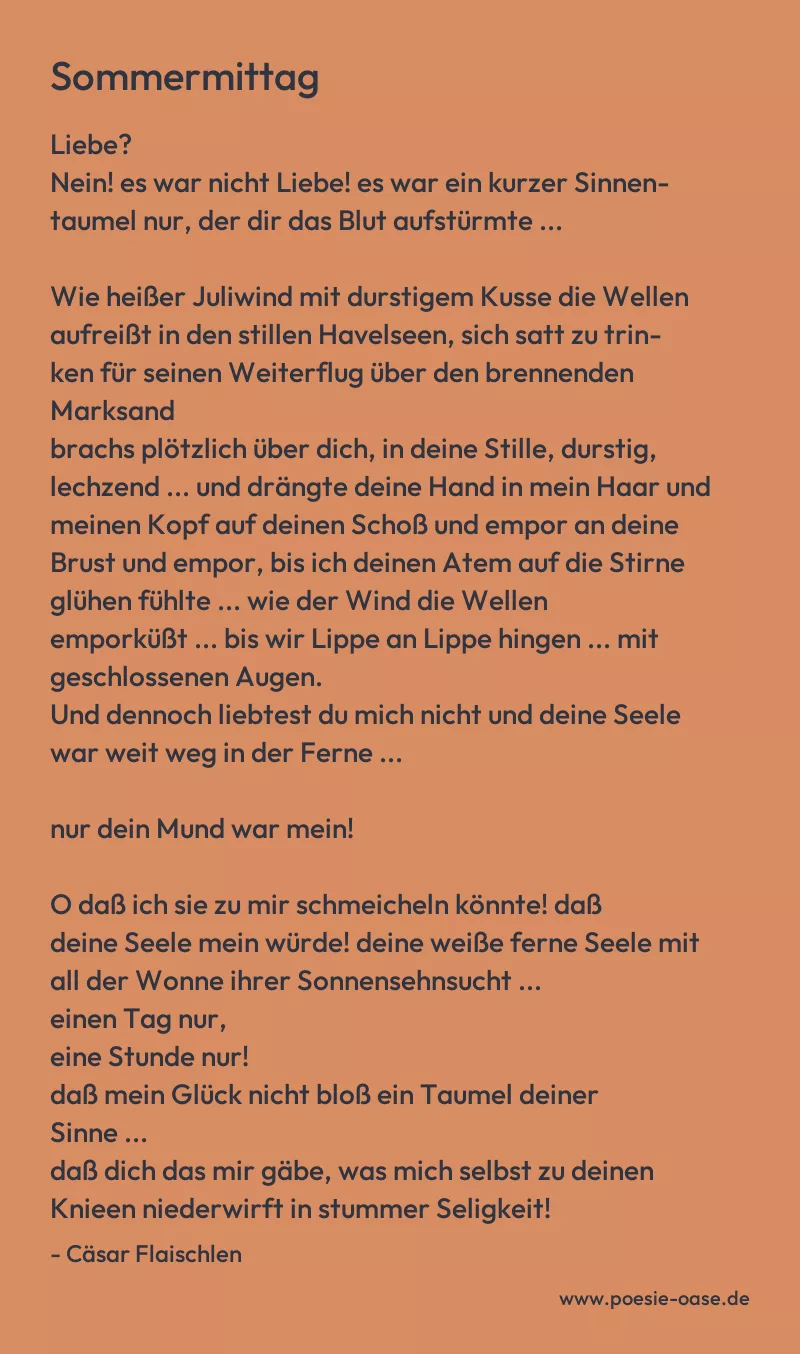
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sommermittag“ von Cäsar Flaischlen ist eine melancholische Betrachtung über eine flüchtige, sinnliche Begegnung, die jedoch nicht mit echter Liebe erfüllt ist. Die unmittelbare, fast schon verzweifelte Frage „Liebe? Nein!“ am Anfang deutet bereits die zentrale Thematik an: die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit, die aber durch die Oberflächlichkeit der Erfahrung getrübt wird. Der Dichter beschreibt einen Moment intensiver körperlicher Nähe, einen „kurzen Sinnentaumel“, der zwar das Blut in Wallung bringt, aber letztendlich nicht die erhoffte Erfüllung bringt.
Flaischlen verwendet eindrucksvolle Bilder, um die Intensität der körperlichen Anziehungskraft zu beschreiben. Der Vergleich des „heißen Juliwinds“ mit den Wellen der Havelseen, die er „durstig“ küsst, vermittelt ein Gefühl von Leidenschaft und Verlangen. Die Sprache ist direkt und sinnlich, die Anweisungen an das „Du“ beschreiben eine Szene der körperlichen Intimität: „drängte deine Hand in mein Haar und meinen Kopf auf deinen Schoß und empor an deine Brust“. Doch inmitten all dieser Nähe wird die Leere der fehlenden Seelenverbindung deutlich. Das „Du“ scheint mit seiner Seele „weit weg in der Ferne“, und nur der Mund gehört dem Dichter.
Die zweite Hälfte des Gedichts ist von einem tiefen Sehnen geprägt. Der Dichter wünscht sich, dass die Seele der geliebten Person ihm zugehörig wäre, dass sie die „Wonne ihrer Sonnensehnsucht“ teilen würde. Er sehnt sich nach mehr als nur dem körperlichen Rausch, nach einer Verbindung, die über den Moment hinausgeht. Der Wunsch nach „einen Tag nur, eine Stunde nur!“ verdeutlicht die Verzweiflung über die Flüchtigkeit des Glücks. Die Formulierung „daß mein Glück nicht bloß ein Taumel deiner Sinne“ zeigt das Bedürfnis nach einem tieferen, echten Gefühl von Zuneigung und Verbundenheit.
Das Gedicht ist somit eine bittersüße Reflexion über die menschliche Sehnsucht nach Liebe und Erfüllung. Es thematisiert das Dilemma, wenn körperliche Nähe nicht zwangsläufig zu emotionaler Nähe führt. Die Verwendung von Bildern aus der Natur, wie der heiße Wind und die Wellen, verstärkt die Sinnlichkeit und die Flüchtigkeit des Augenblicks. Flaischlen gelingt es, die Ambivalenz zwischen dem körperlichen Verlangen und dem tiefen Wunsch nach wahrer Liebe in kraftvollen Bildern und eindringlicher Sprache auszudrücken. Das Gedicht endet mit der Niederwerfung des Dichters „zu deinen Knien“, ein Bild der Demut und des stillen Glücks, das jedoch von der Erkenntnis der unerfüllten Sehnsucht überschattet wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.