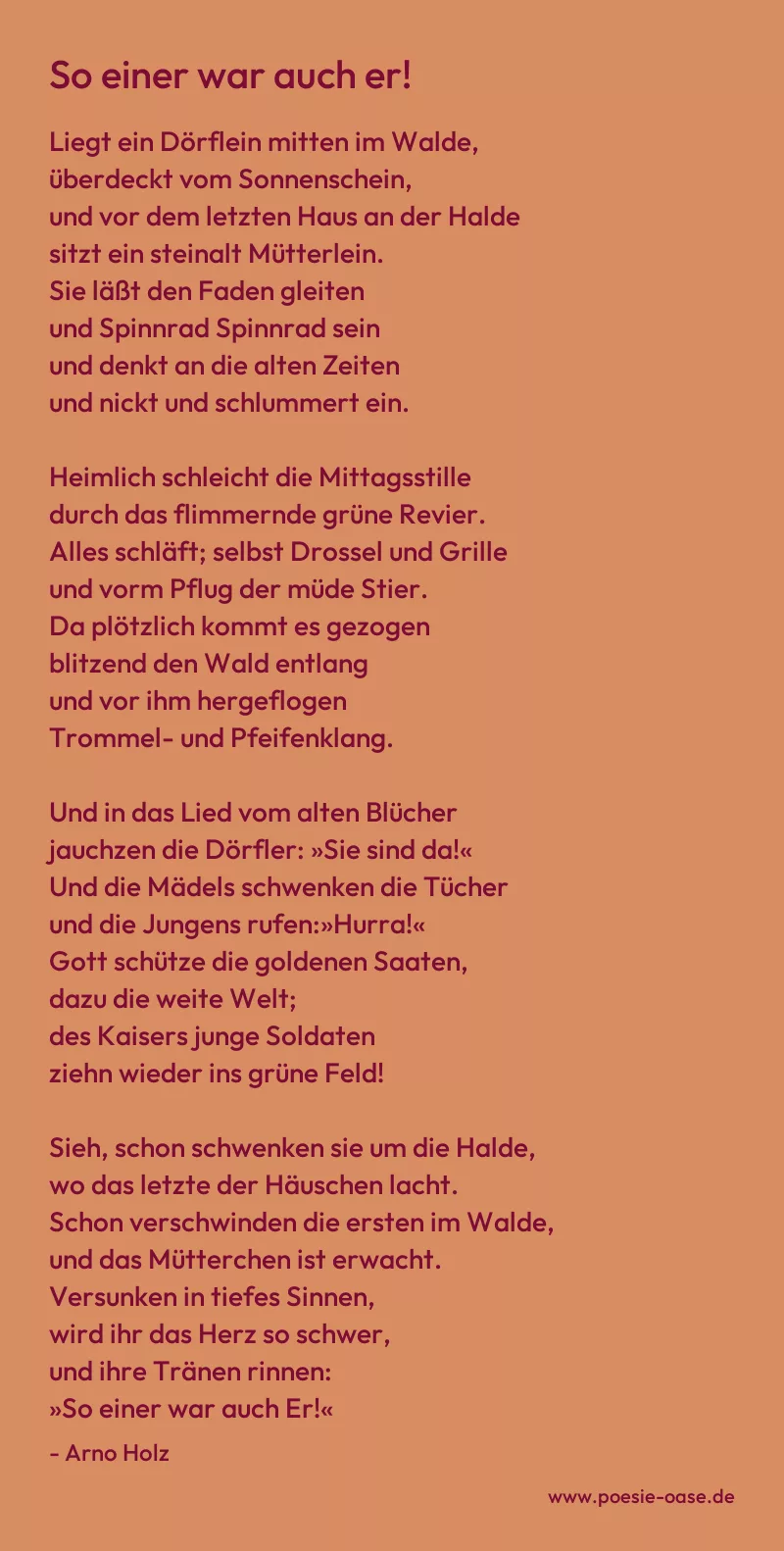So einer war auch er!
Liegt ein Dörflein mitten im Walde,
überdeckt vom Sonnenschein,
und vor dem letzten Haus an der Halde
sitzt ein steinalt Mütterlein.
Sie läßt den Faden gleiten
und Spinnrad Spinnrad sein
und denkt an die alten Zeiten
und nickt und schlummert ein.
Heimlich schleicht die Mittagsstille
durch das flimmernde grüne Revier.
Alles schläft; selbst Drossel und Grille
und vorm Pflug der müde Stier.
Da plötzlich kommt es gezogen
blitzend den Wald entlang
und vor ihm hergeflogen
Trommel- und Pfeifenklang.
Und in das Lied vom alten Blücher
jauchzen die Dörfler: »Sie sind da!«
Und die Mädels schwenken die Tücher
und die Jungens rufen:»Hurra!«
Gott schütze die goldenen Saaten,
dazu die weite Welt;
des Kaisers junge Soldaten
ziehn wieder ins grüne Feld!
Sieh, schon schwenken sie um die Halde,
wo das letzte der Häuschen lacht.
Schon verschwinden die ersten im Walde,
und das Mütterchen ist erwacht.
Versunken in tiefes Sinnen,
wird ihr das Herz so schwer,
und ihre Tränen rinnen:
»So einer war auch Er!«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
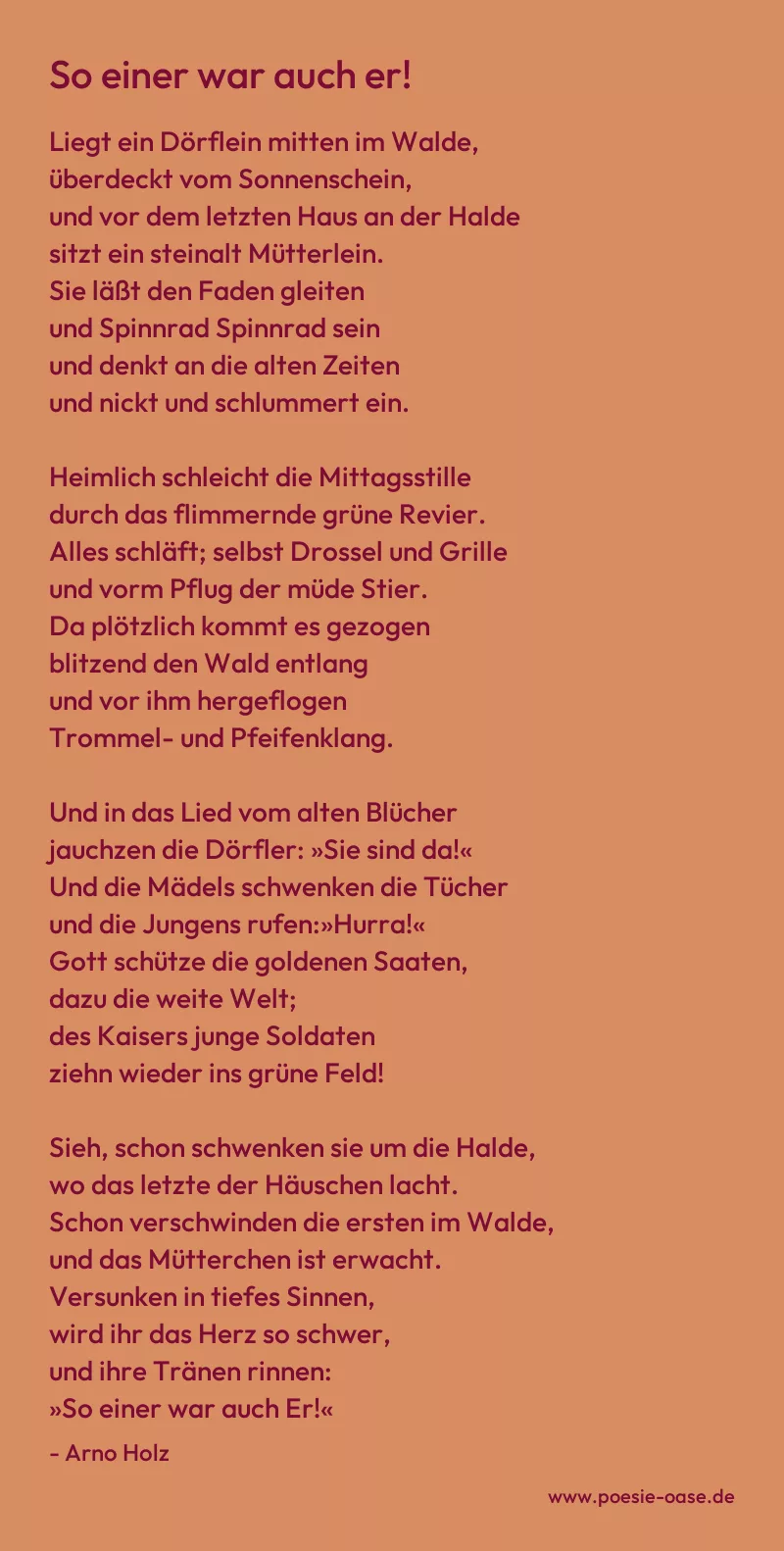
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „So einer war auch er!“ von Arno Holz erzählt auf subtile Weise von den Auswirkungen von Krieg und Verlust auf eine Dorfgemeinschaft, insbesondere auf eine einzelne alte Frau. Das Gedicht beginnt mit einer idyllischen Szene eines sonnenbeschienenen Dorfes, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Die alte Frau, die vor ihrem Haus sitzt und spinnt, verkörpert die Ruhe und Gelassenheit, die durch die kommende militärische Unruhe gestört wird. Das Spinnrad, ein Symbol für das ruhige, gleichmäßige Verstreichen der Zeit, wird durch die Erwähnung der alten Zeiten unterbrochen, was bereits einen Hinweis auf die Vergangenheit und die kommende Veränderung gibt.
Die Stille und der friedliche Schlaf der Natur werden abrupt durch das Auftauchen der Soldaten und den Lärm von Trommeln und Pfeifen unterbrochen. Der Einzug der Truppen, die das Lied vom alten Blücher singen, signalisiert das Ende der Idylle und den Beginn einer neuen Ära, die von Krieg und Bewegung geprägt ist. Die Reaktion der Dorfbewohner, die jubeln und ihre Tücher schwenken, zeigt die Begeisterung und den Enthusiasmus, mit dem die jungen Männer in den Krieg ziehen. Diese anfängliche Euphorie steht im krassen Gegensatz zu der stillen Trauer der alten Frau.
Die alte Frau erwacht aus ihrem Schlummer, als die Soldaten am Rande des Waldes verschwinden. Ihr Herz wird schwer, und ihre Tränen fließen, während sie die Worte „So einer war auch Er!“ murmelt. Dieser Satz ist der Kern des Gedichts und offenbart die tiefe Trauer und den Verlust, den die alte Frau erlebt hat. Er deutet darauf hin, dass sie bereits einen Sohn oder einen geliebten Menschen durch Krieg verloren hat, und die Ankunft der neuen Soldaten weckt schmerzhafte Erinnerungen und Ängste vor zukünftigen Verlusten. Die Wiederholung der Erfahrung des Krieges, die sich in den neuen Soldaten manifestiert, führt zu ihrer tiefen Verzweiflung und ihrem tiefgreifenden Verständnis für die Schrecken des Krieges, die über Generationen weitergegeben werden.
Das Gedicht ist von einer tiefen Melancholie geprägt und zeigt die Zerstörung, die der Krieg anrichtet, nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch die Zerstörung von Familien und Gemeinschaften. Die Wahl der Worte und Bilder, wie die idyllische Szene, die Stille, die durch den Lärm der Soldaten unterbrochen wird, und die Trauer der alten Frau, erzeugen eine starke emotionale Wirkung. Es ist ein stilles, aber eindringliches Mahnmal für die menschlichen Kosten des Krieges und die bleibenden Narben, die er hinterlässt. Das Gedicht wirft die Frage nach dem Wert von Krieg und militärischem Ruhm auf, indem es die Perspektive derer einnimmt, die die wahren Opfer sind: die Zurückgelassenen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.