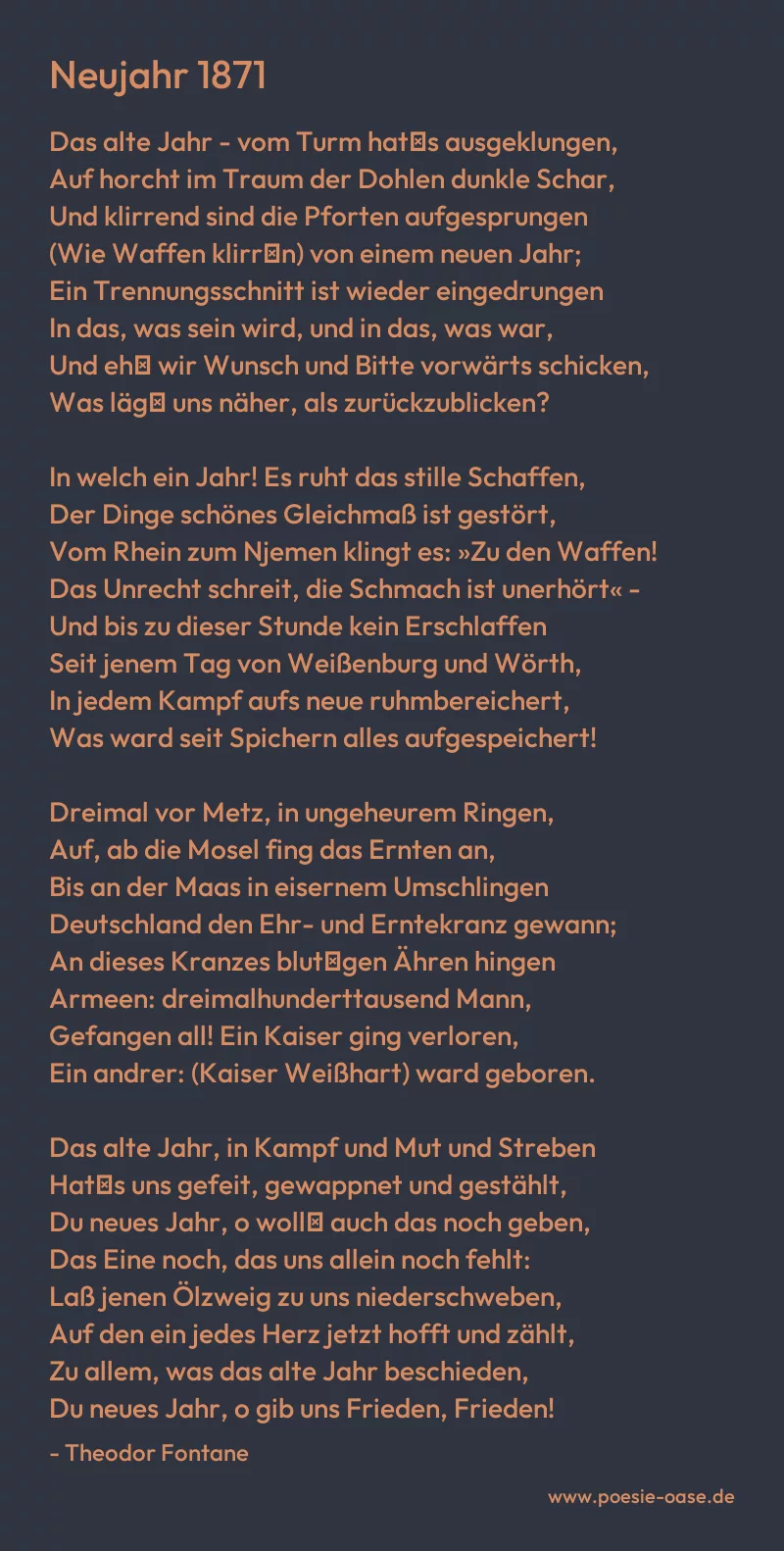Das alte Jahr – vom Turm hat′s ausgeklungen,
Auf horcht im Traum der Dohlen dunkle Schar,
Und klirrend sind die Pforten aufgesprungen
(Wie Waffen klirr′n) von einem neuen Jahr;
Ein Trennungsschnitt ist wieder eingedrungen
In das, was sein wird, und in das, was war,
Und eh′ wir Wunsch und Bitte vorwärts schicken,
Was läg′ uns näher, als zurückzublicken?
In welch ein Jahr! Es ruht das stille Schaffen,
Der Dinge schönes Gleichmaß ist gestört,
Vom Rhein zum Njemen klingt es: »Zu den Waffen!
Das Unrecht schreit, die Schmach ist unerhört« –
Und bis zu dieser Stunde kein Erschlaffen
Seit jenem Tag von Weißenburg und Wörth,
In jedem Kampf aufs neue ruhmbereichert,
Was ward seit Spichern alles aufgespeichert!
Dreimal vor Metz, in ungeheurem Ringen,
Auf, ab die Mosel fing das Ernten an,
Bis an der Maas in eisernem Umschlingen
Deutschland den Ehr- und Erntekranz gewann;
An dieses Kranzes blut′gen Ähren hingen
Armeen: dreimalhunderttausend Mann,
Gefangen all! Ein Kaiser ging verloren,
Ein andrer: (Kaiser Weißhart) ward geboren.
Das alte Jahr, in Kampf und Mut und Streben
Hat′s uns gefeit, gewappnet und gestählt,
Du neues Jahr, o woll′ auch das noch geben,
Das Eine noch, das uns allein noch fehlt:
Laß jenen Ölzweig zu uns niederschweben,
Auf den ein jedes Herz jetzt hofft und zählt,
Zu allem, was das alte Jahr beschieden,
Du neues Jahr, o gib uns Frieden, Frieden!