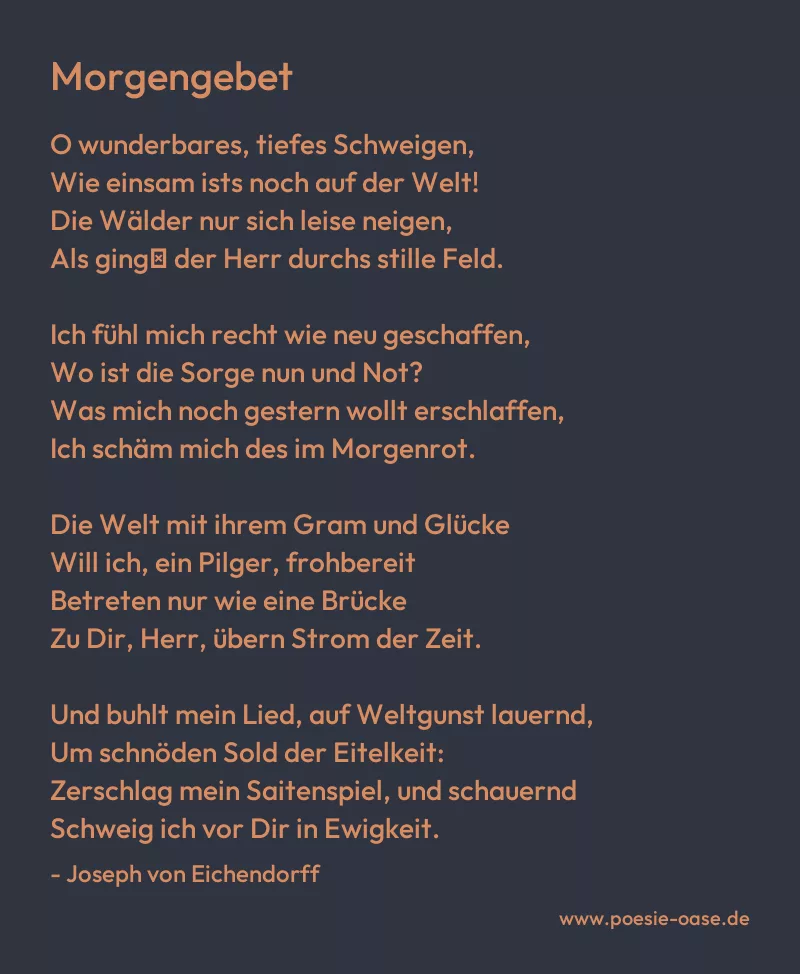Morgengebet
O wunderbares, tiefes Schweigen,
Wie einsam ists noch auf der Welt!
Die Wälder nur sich leise neigen,
Als ging′ der Herr durchs stille Feld.
Ich fühl mich recht wie neu geschaffen,
Wo ist die Sorge nun und Not?
Was mich noch gestern wollt erschlaffen,
Ich schäm mich des im Morgenrot.
Die Welt mit ihrem Gram und Glücke
Will ich, ein Pilger, frohbereit
Betreten nur wie eine Brücke
Zu Dir, Herr, übern Strom der Zeit.
Und buhlt mein Lied, auf Weltgunst lauernd,
Um schnöden Sold der Eitelkeit:
Zerschlag mein Saitenspiel, und schauernd
Schweig ich vor Dir in Ewigkeit.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
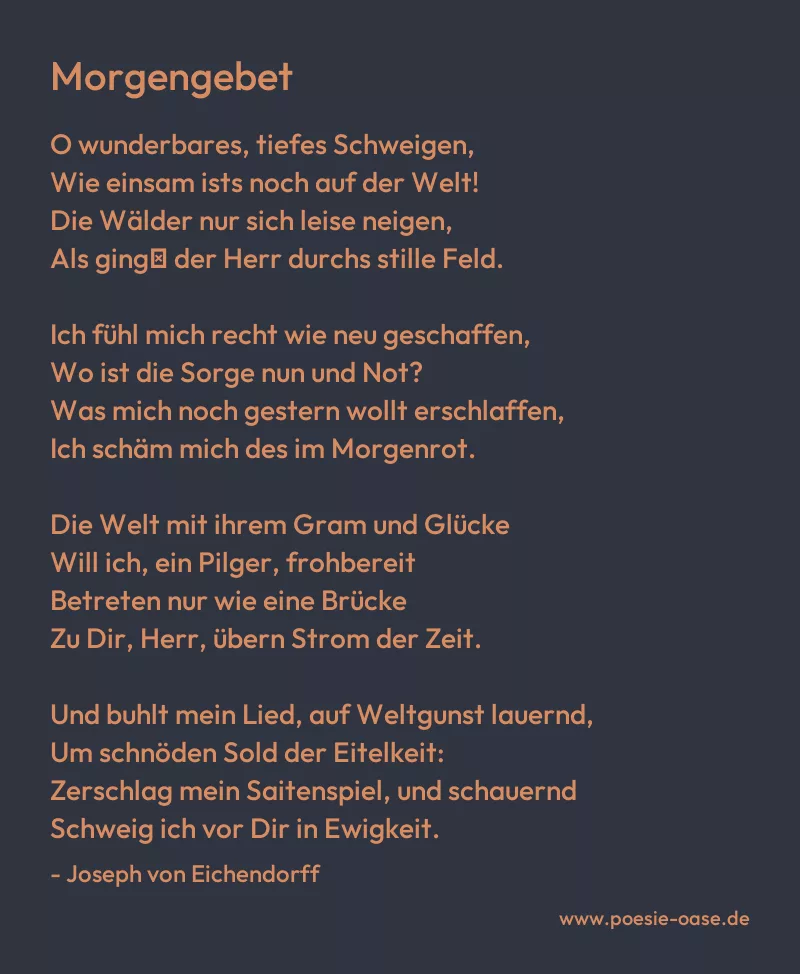
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Morgengebet“ von Joseph von Eichendorff ist eine tief empfundene Reflexion über die Beziehung des Menschen zur Natur und zu Gott, eingebettet in eine beschauliche Morgenszenerie. Es beginnt mit einer Beschreibung der Stille und Einsamkeit der Natur, die von einer Ehrfurcht gebietenden Präsenz Gottes durchdrungen ist. Der Dichter scheint sich in diesem Moment des Innehaltens und der Kontemplation mit der Welt und seinem Schöpfer zu versöhnen. Die ersten beiden Strophen beschreiben einen Zustand der inneren Erneuerung, der durch die Begegnung mit der Natur und dem Göttlichen ausgelöst wird. Die Sorgen und Nöte des Alltags verlieren in diesem erhabenen Moment ihre Bedeutung, und der Dichter empfindet eine tiefe Scham für die Belastungen der Vergangenheit.
In der dritten Strophe weitet sich der Blick des Dichters auf die Welt und das Leben. Er betrachtet die Welt mit ihrem „Gram und Glücke“ als eine „Brücke“ zu Gott, als einen Weg, der durch die Höhen und Tiefen des irdischen Daseins führt. Diese Metapher unterstreicht die Pilgerreise des Menschen durch die Zeit, die letztlich auf das Ziel der ewigen Gemeinschaft mit Gott ausgerichtet ist. Die „Welt“ mit all ihren Freuden und Leiden wird nicht als etwas Negatives wahrgenommen, sondern als notwendiger Bestandteil des Weges zur Erleuchtung.
Die letzte Strophe ist eine eindringliche Bitte an Gott, die Eitelkeit und das Streben nach weltlichem Ruhm zu überwinden. Der Dichter fürchtet die Versuchung, sein Talent für materielle oder gesellschaftliche Anerkennung zu missbrauchen. Er wünscht sich, von solchen egoistischen Motiven befreit zu werden, und bittet Gott, sein „Saitenspiel“ zu „zerschlagen“, wenn es dazu dient, „auf Weltgunst lauernd“ zu agieren. Diese Zeilen verdeutlichen das Streben nach Demut und die Sehnsucht nach einer tiefen, authentischen Beziehung zu Gott.
Die Verwendung von Naturbildern, wie „Wälder“, „Feld“, „Morgenrot“ und die Beschreibung von Stille und Einsamkeit, verstärken die Atmosphäre der Kontemplation und Ergriffenheit. Eichendorffs Sprache ist schlicht und dennoch bildhaft, wodurch er eine Atmosphäre der Ehrfurcht und der Innerlichkeit erzeugt. Das Gedicht ist somit ein Ausdruck der Sehnsucht nach dem Göttlichen und eine Reflexion über die Rolle des Menschen in der Welt, die durch die Akzeptanz der Freuden und Leiden des Lebens und die Abkehr von der Eitelkeit gekennzeichnet ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.