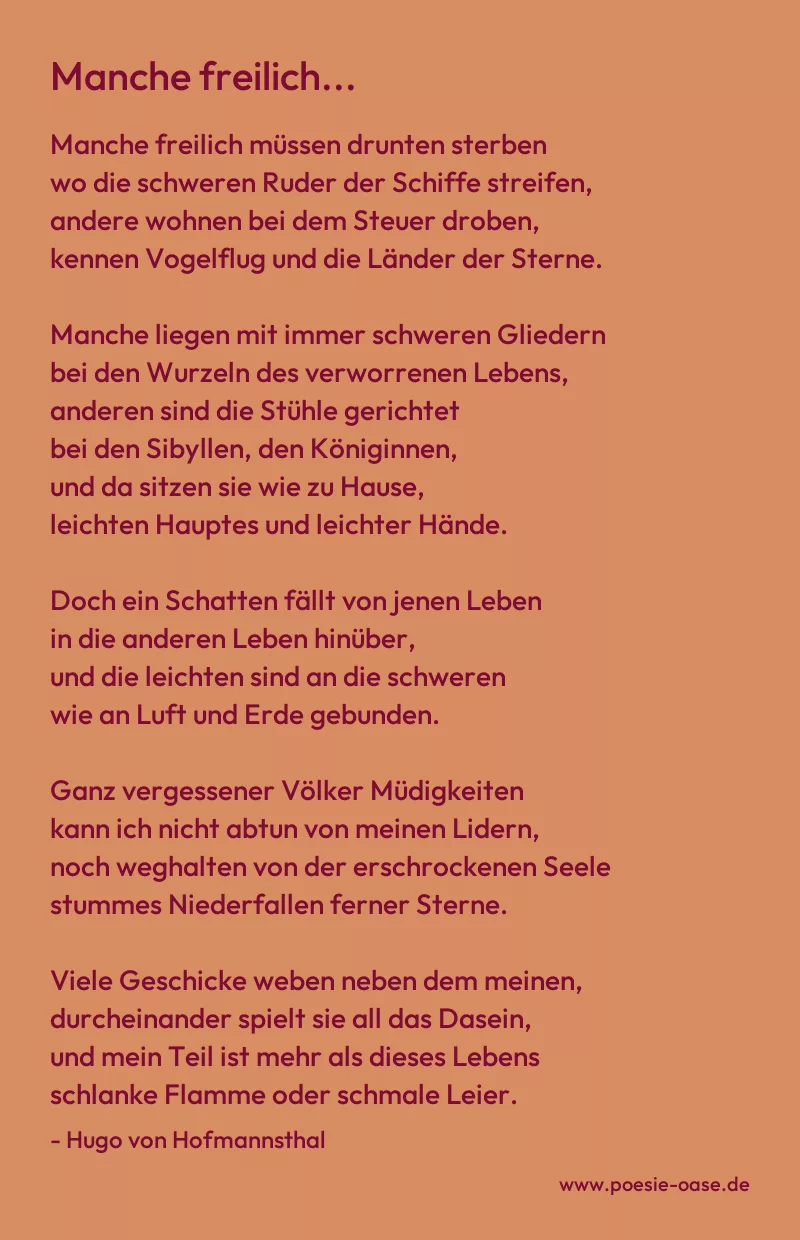Manche freilich…
Manche freilich müssen drunten sterben
wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
andere wohnen bei dem Steuer droben,
kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.
Manche liegen mit immer schweren Gliedern
bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
anderen sind die Stühle gerichtet
bei den Sibyllen, den Königinnen,
und da sitzen sie wie zu Hause,
leichten Hauptes und leichter Hände.
Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
in die anderen Leben hinüber,
und die leichten sind an die schweren
wie an Luft und Erde gebunden.
Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
noch weghalten von der erschrockenen Seele
stummes Niederfallen ferner Sterne.
Viele Geschicke weben neben dem meinen,
durcheinander spielt sie all das Dasein,
und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
schlanke Flamme oder schmale Leier.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
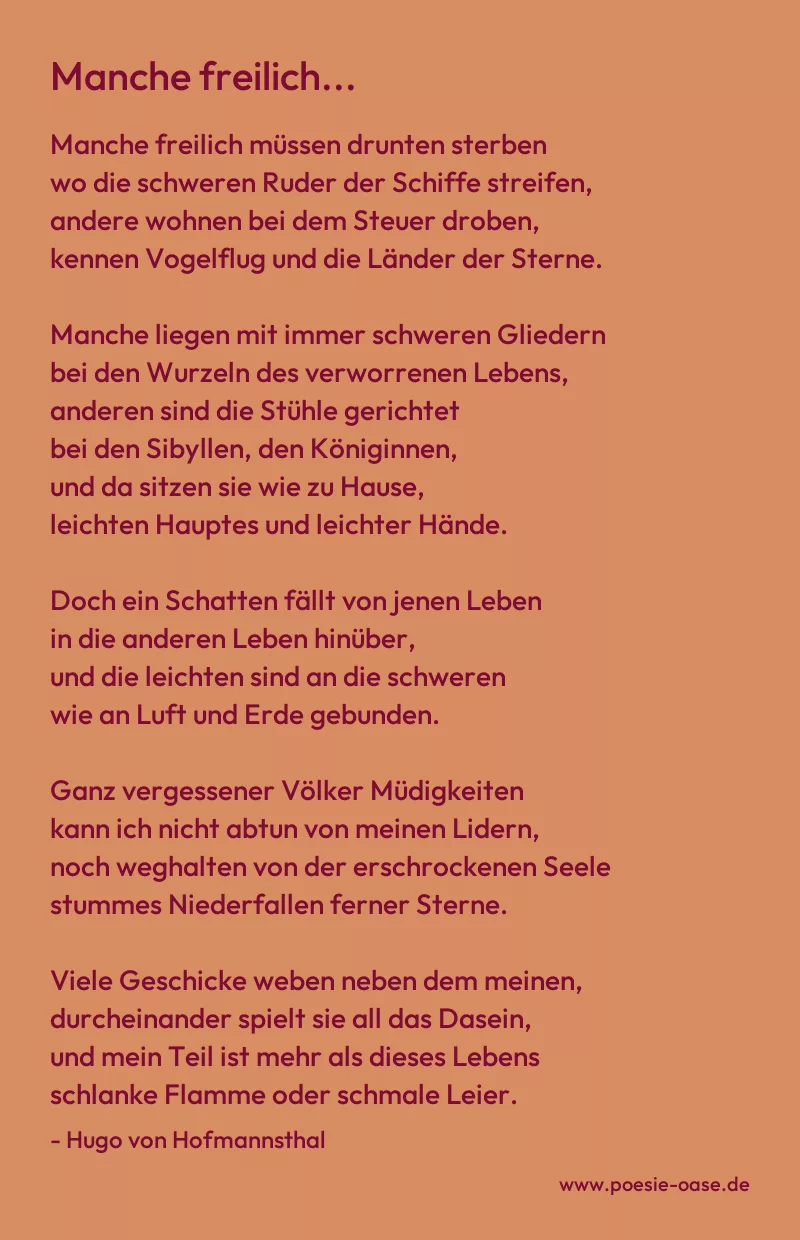
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Manche freilich…“ von Hugo von Hofmannsthal ist eine Reflexion über die Ungleichheit des menschlichen Daseins und die Verbundenheit aller Existenzen. Es beginnt mit der Gegenüberstellung unterschiedlicher Lebensweisen: Die einen, die „drunten sterben“, die schwere Arbeit verrichten und dem Schicksal unterworfen sind, und die anderen, die „droben“ wohnen, eine höhere Perspektive einnehmen und die Welt aus einer distanzierten, fast göttlichen Warte betrachten können. Diese Zweiteilung, die sich in der Symbolik von Schiffen, Sternen und der Erde widerspiegelt, verdeutlicht die soziale Hierarchie und die unterschiedlichen Lebenserfahrungen.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft diese Dichotomie weiter, indem er die Extreme der menschlichen Existenz auslotet. Er vergleicht diejenigen, die „bei den Wurzeln des verworrenen Lebens“ feststecken, mit jenen, die privilegiert sind und „bei den Sibyllen, den Königinnen“ Platz gefunden haben, eine Welt der Weisheit und Macht. Diese Gegenüberstellung von Last und Leichtigkeit, von Unfreiheit und Freiheit, wird durch die Metaphern von „schweren Gliedern“ und „leichten Hauptes und leichter Hände“ sinnlich erfahrbar. Die Zeilen deuten auf eine soziale Ungerechtigkeit hin, aber auch auf eine unaufhebbare Verbindung.
Das Gedicht wendet sich dann der zentralen These zu: Trotz aller Unterschiede und Ungleichheiten besteht eine unsichtbare Verbindung zwischen den verschiedenen Lebensformen. Der „Schatten“, der von den schweren Leben in die leichten Leben fällt, symbolisiert die gegenseitige Beeinflussung und die unweigerliche Verbundenheit aller Menschen. Die „leichten“ sind an die „schweren“ gebunden, so wie an die natürlichen Elemente Luft und Erde. Diese Verbundenheit wird durch die folgenden Zeilen verstärkt, die die Allgegenwart von Leid und die Wahrnehmung von kosmischer Vergänglichkeit thematisieren.
In den abschließenden Zeilen offenbart der Sprecher ein Gefühl der Verantwortung und des Mitgefühls. Er ist sich bewusst, dass sein eigenes Schicksal mit dem der anderen untrennbar verbunden ist. Er spürt die Last „ganz vergessener Völker Müdigkeiten“ und ist von der „erschrockenen Seele“ betroffen. Die Metaphern von „schlanker Flamme“ und „schmaler Leier“ deuten auf eine bescheidene, aber bedeutungsvolle Rolle im großen Gefüge des Daseins hin. Das Gedicht endet mit der Einsicht, dass das eigene Leben nur ein kleiner Teil eines größeren, komplexen Ganzen ist, in dem alle Geschicke miteinander verwoben sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.