Man sagt / es sey kein Ort / da Amor nicht zu finden /
eß sey kein öder Wald / eß sey kein Teil der Welt /
da dieser große Fürst nicht seine Hoffstadt helt;
man sagt / eß sey kein Man / den er nicht könne binden:
noch hat er meinen Muht nicht können überwinden /
weil mir sein schnödes Thun zu keiner zeit gefält;
ob er schon noch so weit ihm bawet sein Gezelt /
daß in Arabia man ihn auch stets kann finden.
Europa ist zwahr sein / er sitzt in Africa /
er wohnt in Asia / und kent America /
In summ / eß ist kein Haus / das er nicht innen hatt /
eß ist kein Menschlich Hertz / das er nicht könte lencken /
mich doch / ob er schon nah mir ist / kan er nicht krencken /
dan ist er auff dem Dorff / so bin ich in der Stadt. Oder:
bin ich dan auff dem Dorff / so ist er in der Stadt.
Man sagt, es sey kein Ort, da Amor nicht zu finden…
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
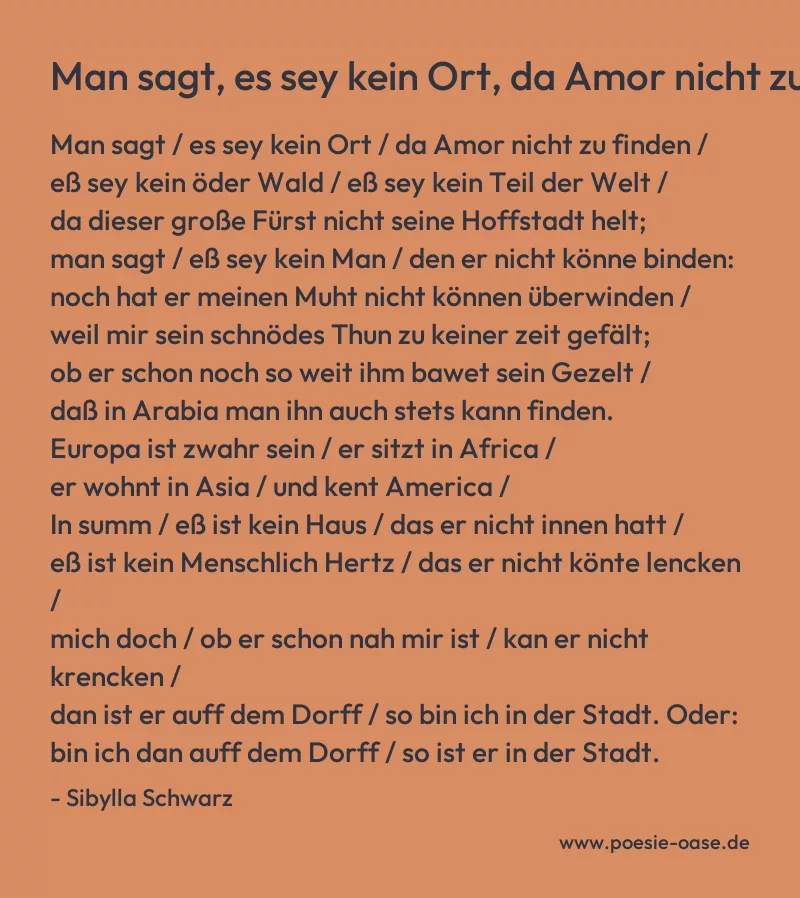
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Man sagt, es sey kein Ort, da Amor nicht zu finden…“ von Sibylla Schwarz ist eine selbstbewusste Abhandlung über die Macht des Liebesgottes Amor und die eigene Unverwundbarkeit gegenüber seinen Pfeilen. Es beginnt mit der weitverbreiteten Vorstellung, dass Amor allgegenwärtig ist und keinen Ort der Welt verschont, um seine Macht auszuüben. Die ersten Verse beschreiben Amors Reichweite, indem sie Orte wie Wälder und Teile der Welt aufzählen, in denen der Gott präsent ist. Zudem wird betont, dass Amor jeden Mann zu binden vermag.
In den folgenden Strophen wird die eigentliche These des Gedichts etabliert: Trotz der universellen Präsenz und Macht Amors ist die lyrische Ich-Erzählerin von seinen Einflüssen unberührt. Ihr „Muht“ (Mut, Geist) wurde nicht überwunden, da sie Amors „schnödes Thun“ (verächtliches Tun) niemals gefällt. Die Autorin veranschaulicht die Allgegenwart Amors mit geografischen Beispielen, indem sie Europa, Afrika, Asien und Amerika als seine Wohnorte aufzählt. Damit wird die Vorstellung verstärkt, dass Amor überall ist und jeden Menschen erreichen kann. Doch trotz dieser weitreichenden Präsenz kann er die Erzählerin nicht verletzen („krencken“).
Die abschließenden Zeilen offenbaren die Ursache für die Unberührtheit: ein Spiel von Nähe und Distanz. Die Erzählerin erklärt, dass sie sich entweder im gegensätzlichen Zustand zu Amor befindet, nämlich entweder in der Stadt oder auf dem Dorf. Dieses Wechselspiel deutet auf eine bewusste Distanzierung von Amor hin, möglicherweise durch eine Art von Lebensweise, die sich den Versuchungen der Liebe entzieht. Diese Strategie unterstreicht die Fähigkeit der Erzählerin, ihre eigene Unabhängigkeit zu bewahren und sich der Kontrolle durch Amor zu entziehen.
Das Gedicht ist ein Ausdruck von persönlicher Stärke und Unabhängigkeit. Es widersetzt sich der Konvention, dass die Liebe unweigerlich jeden Menschen erreicht und beeinflusst. Die Autorin, die sich in einer Zeit verändernder gesellschaftlicher Strukturen bewegte, entwirft hier ein feministisch anmutendes Statement der Selbstbehauptung. Der Kampf zwischen der Allgegenwart Amors und der weiblichen Souveränität wird durch die kluge Gegenüberstellung von Ort und Distanz elegant dargestellt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
