Man hätt es nicht dürfen,
man hätt es nicht sollen,
und man hat es
dennoch gewollt …
Und es war so schön,
wie′s nie gewesen,
hätt man es dürfen,
hätt man′s gesollt.
Man hätt es nicht dürfen,
man hätt es nicht sollen,
und man hat es
dennoch gewollt …
Und es war so schön,
wie′s nie gewesen,
hätt man es dürfen,
hätt man′s gesollt.
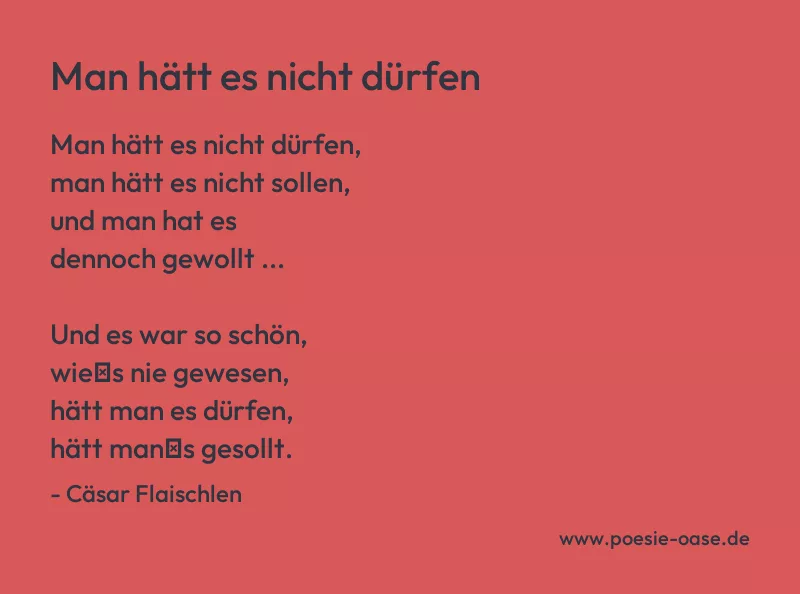
Das Gedicht „Man hätt es nicht dürfen“ von Cäsar Flaischlen ist eine kurze, melancholische Betrachtung über die Sehnsucht nach etwas, das nicht sein durfte. Es umreißt einen universellen menschlichen Konflikt: das Verlangen nach Erfüllung, auch wenn die Umstände oder äußere Verbote dagegen sprechen. Die ersten drei Zeilen etablieren das zentrale Dilemma, indem sie die Konzepte von Verbot, Pflicht und Begierde in einem prägnanten, rhythmischen Sprachgebrauch gegenüberstellen. Der Autor deutet an, dass etwas getan wurde, das eigentlich nicht hätte getan werden sollen.
Der zweite Teil des Gedichts enthüllt die Natur dieses verbotenen Handelns, indem es die Emotionen und die Erfahrung des Handelns beleuchtet. Die Zeile „Und es war so schön, / wie’s nie gewesen“ zeigt, dass die Handlung im Moment des Geschehens intensiv und erhebend war, wahrscheinlich befreiend und erfüllend. Hier wird ein starker Kontrast aufgebaut zwischen der Erfüllung in der Gegenwart und den moralischen Implikationen der Vergangenheit, wobei die Freude in den Vordergrund gerückt wird.
Die beiden abschließenden Zeilen wiederholen in leicht veränderter Form die Eröffnungszeilen, allerdings mit einer entscheidenden Wendung. „Hätt man es dürfen, / hätt man’s gesollt.“ Diese Wiederholung verstärkt nicht nur die strukturelle Symmetrie des Gedichts, sondern unterstreicht auch die Tragweite der Situation. Sie verdeutlicht das Bedauern, dass die Freude nicht ohne Schuldgefühle genossen werden konnte. Gleichzeitig suggeriert es, dass die Handlung, hätte sie erlaubt oder geboten sein können, die ideale Erfahrung gewesen wäre.
Die Kürze des Gedichts und die einfachen Worte machen es zu einem ergreifenden Ausdruck menschlicher Sehnsüchte und moralischer Dilemmata. Flaischlen verwendet eine einfache Sprache, die durch die Wiederholung und den Kontrast der Wörter eine starke emotionale Wirkung erzielt. Das Gedicht lädt dazu ein, über die Natur von Verboten, die Kraft der Begierde und das Verhältnis von Glück und Moral nachzudenken. Es ist ein Nachhall von Bedauern, aber auch von der unwiderstehlichen Anziehungskraft dessen, was uns verboten ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.