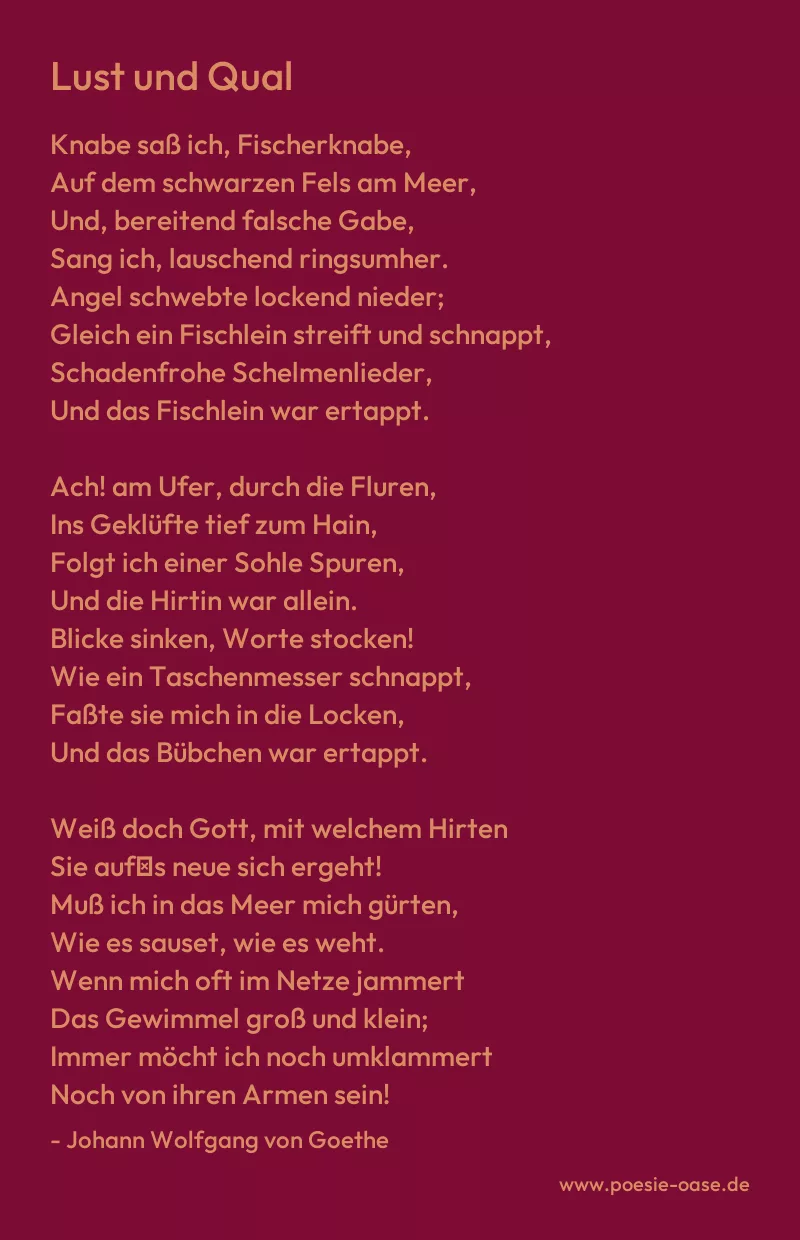Lust und Qual
Knabe saß ich, Fischerknabe,
Auf dem schwarzen Fels am Meer,
Und, bereitend falsche Gabe,
Sang ich, lauschend ringsumher.
Angel schwebte lockend nieder;
Gleich ein Fischlein streift und schnappt,
Schadenfrohe Schelmenlieder,
Und das Fischlein war ertappt.
Ach! am Ufer, durch die Fluren,
Ins Geklüfte tief zum Hain,
Folgt ich einer Sohle Spuren,
Und die Hirtin war allein.
Blicke sinken, Worte stocken!
Wie ein Taschenmesser schnappt,
Faßte sie mich in die Locken,
Und das Bübchen war ertappt.
Weiß doch Gott, mit welchem Hirten
Sie auf′s neue sich ergeht!
Muß ich in das Meer mich gürten,
Wie es sauset, wie es weht.
Wenn mich oft im Netze jammert
Das Gewimmel groß und klein;
Immer möcht ich noch umklammert
Noch von ihren Armen sein!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
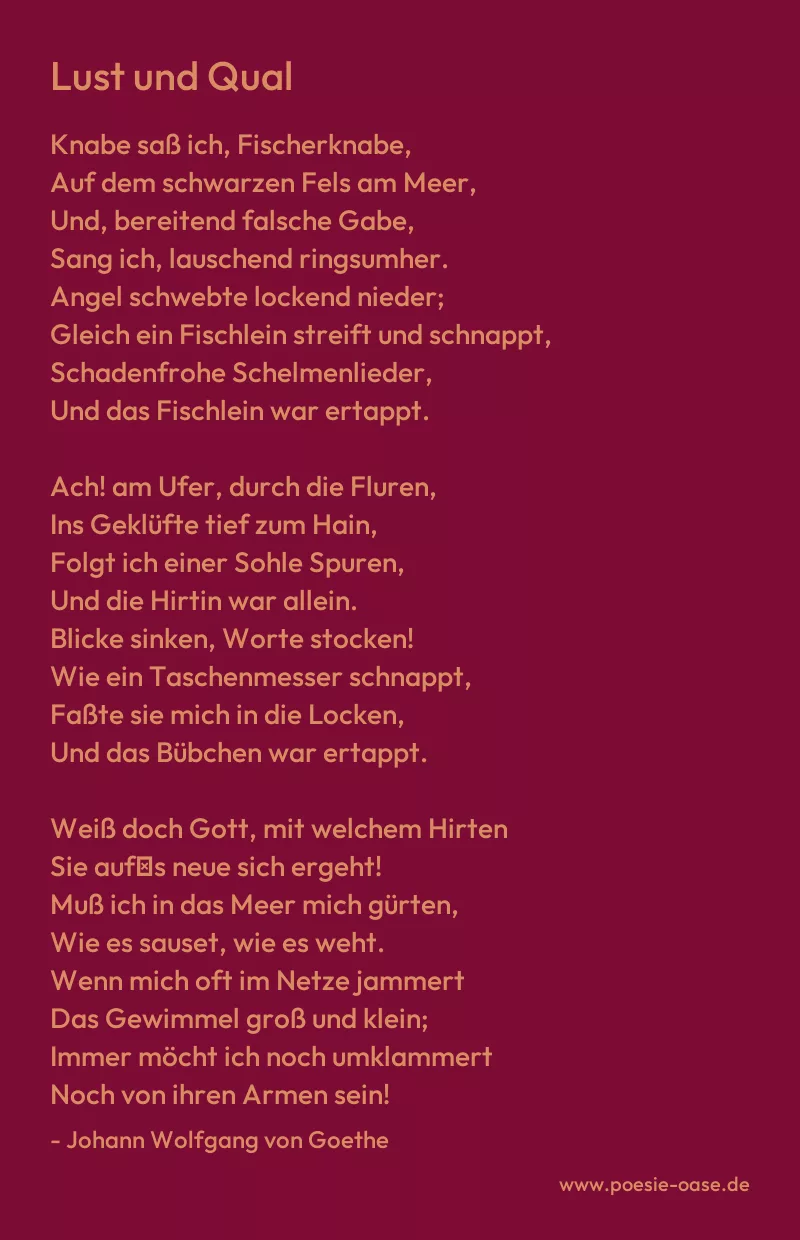
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lust und Qual“ von Johann Wolfgang von Goethe thematisiert die Ambivalenz menschlicher Erfahrungen, insbesondere die Verbindung von Vergnügen und Schmerz in der Liebe. Das Gedicht, das in einer klaren, bildreichen Sprache gehalten ist, entfaltet in zwei Strophen die Erlebnisse des lyrischen Ichs in seiner Jugend, wobei die Liebe zu einem Mädchen im Mittelpunkt steht, gefolgt von der abschließenden, resignierten Reflexion über die anhaltende Sehnsucht, die selbst in der Qual bestehen bleibt.
Die ersten beiden Strophen beschreiben zunächst kindliche Unschuld und ungestümes Begehren, wobei Naturbilder wie das Meer und die Fluren als Kulisse dienen. Die Metaphern der Angel und des Taschenmessers verdeutlichen, wie das lyrische Ich auf die Liebe hereinfällt und in ihrem Bann gefangen wird. Das „Fischlein“ und das „Bübchen“ repräsentieren dabei die Unbedarftheit und die leichte Beute der Liebe. Die Freude am „Schnappen“ des Fischleins und die Faszination, die von der Hirtin ausgeht, werden als unwiderstehlich dargestellt, und verdeutlichen die unkontrollierbare Anziehungskraft, die von der Liebe ausgeht.
Die dritte Strophe enthüllt die tiefe Ambivalenz des lyrischen Ichs. Die Frage nach dem weiteren Schicksal der Hirtin deutet auf die Zerrissenheit zwischen Sehnsucht und Schmerz, zwischen der Erinnerung an das Vergnügen und der Erkenntnis der Konsequenzen. Das lyrische Ich ist bereit, im Meer der Qual zu ertrinken, im „Gewimmel“ des Lebens gefangen zu sein, denn die Erinnerung an die Umarmung der Hirtin, die Sehnsucht nach der einstigen Liebe, überwiegt alle Schmerzen und Leiden.
Goethe gelingt es, die widersprüchliche Natur menschlicher Gefühle in eindrucksvollen Bildern darzustellen. Das Gedicht ist ein Ausdruck der Erfahrung, dass die Liebe sowohl Freude als auch Leid mit sich bringt. Die letzten Verse zeigen die Unfähigkeit des lyrischen Ichs, sich von dieser Sehnsucht zu befreien, und betonen die bleibende Kraft der Liebe, die selbst in der Qual bestehen bleibt. Diese tiefe emotionale Ehrlichkeit und die poetische Gestaltung machen das Gedicht zu einem berührenden Zeugnis menschlicher Erfahrungen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.