Liebst du das Dunkel
Tauigter Nächte?
Graut dir der Morgen,
Starrst du ins Spätrot,
Seufzest beim Mahle
Stößest den Becher
Weg von den Lippen?
Liebst du nicht Jagdlust
Reizet dich Ruhm nicht
Schlachtgetümmel?
Welken dir Blumen
Schneller am Busen
Als sie sonst welkten
Drängt sich das Blut dir
Pochend zum Herzen?
Liebst du das Dunkel…
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
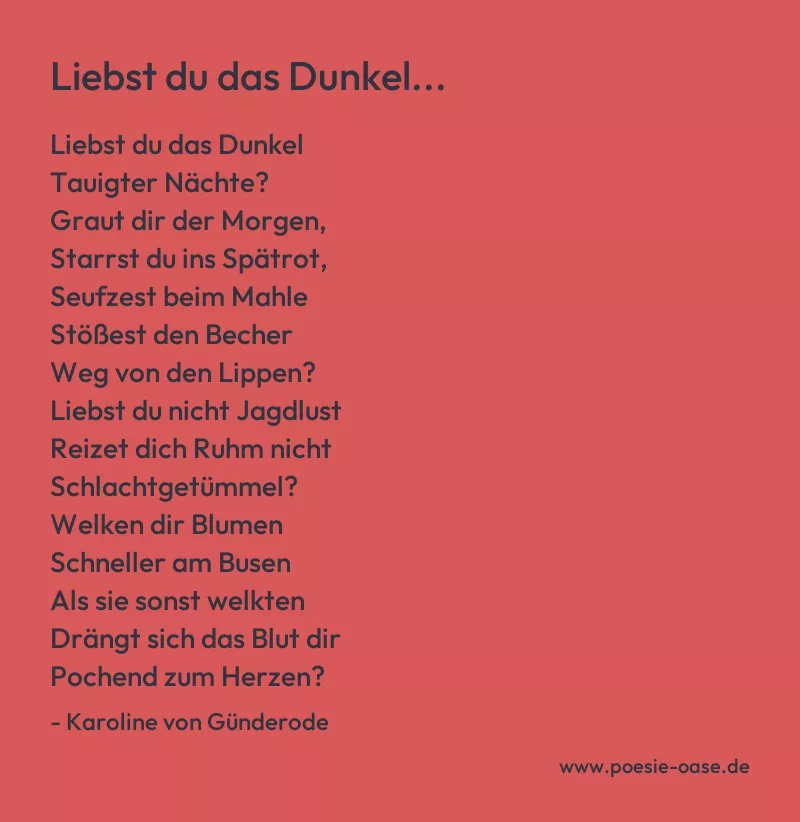
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Liebst du das Dunkel…“ von Karoline von Günderode ist eine kurze, introspektive Ergründung der melancholischen Seele, die sich von der Freude und dem Glanz der Welt entfremdet hat. Es ist eine Reihe von rhetorischen Fragen, die den Leser in die Gefühlswelt einer Person eintauchen lassen, die von innerer Trauer geplagt wird und deren Empfindungen sich von den konventionellen Freuden des Lebens abwenden. Die Struktur des Gedichts ähnelt einer diagnostischen Untersuchung, bei der die Autorin verschiedene Symptome der Verzweiflung abfragt.
Die ersten Fragen konzentrieren sich auf die Ablehnung der Tagesfreude und die Hinwendung zur Dunkelheit, was ein Zeichen für eine tiefe Traurigkeit oder Depression sein kann. Das „Dunkel“ und die „tauigen Nächte“ werden dem Morgen gegenübergestellt, was auf eine Abneigung gegen die helle, aktive Tageszeit hindeutet. Die anschließenden Fragen vertiefen diese Idee, indem sie die Reaktion des Subjekts auf Alltagsereignisse untersuchen, wie z.B. das Essen und die Unfähigkeit, sich an weltlichen Freuden zu erfreuen. Das Wegstoßen des Bechers am Ende des ersten Strophenabschnitts symbolisiert eine Ablehnung des Genusses und des Trostes, der durch die Welt geboten wird.
Im zweiten Teil des Gedichts werden weitere Hinweise auf eine tiefe Unzufriedenheit und das Fehlen von Freude gegeben. Die Fragen nach Jagdlust, Ruhm und dem Schlachtgetümmel zeigen ein Desinteresse an den traditionellen Zielen und Ambitionen, die oft mit männlicher Macht und sozialem Erfolg verbunden werden. Dieses Fehlen von Interesse an solchen Aktivitäten deutet auf eine tiefe innere Leere und eine Abneigung gegenüber den oberflächlichen Aspekten des Lebens hin. Die Metapher der „welkenden Blumen“ am Busen verstärkt die Idee von Verlust und Vergänglichkeit, während das pochende Herz auf eine innere Unruhe hindeutet.
Insgesamt zeichnet Günderodes Gedicht das Porträt einer Seele, die von einer tiefen Melancholie erfasst wurde. Es ist eine ehrliche und einfühlsame Untersuchung der menschlichen Erfahrung, die eine Verbindung zu dem Gefühl der Isolation, der Trauer und der Sehnsucht nach etwas Unbekanntem herstellt. Die offene Form des Gedichts, ohne eine direkte Aussage, erlaubt dem Leser, die Emotionen des Gedichts selbst zu interpretieren und mit den eigenen Erfahrungen zu vergleichen. Das Gedicht endet ohne eine Lösung, sondern lässt den Leser mit dem Gefühl zurück, die tiefe Verzweiflung und die innere Zerrissenheit des lyrischen Ichs nachempfinden zu können.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
