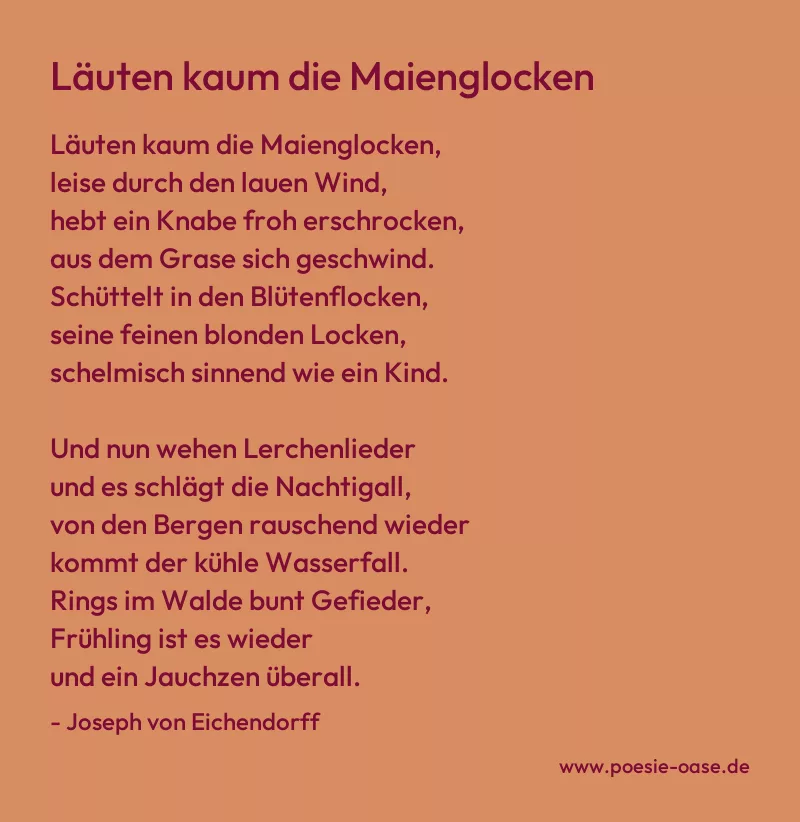Läuten kaum die Maienglocken
Läuten kaum die Maienglocken,
leise durch den lauen Wind,
hebt ein Knabe froh erschrocken,
aus dem Grase sich geschwind.
Schüttelt in den Blütenflocken,
seine feinen blonden Locken,
schelmisch sinnend wie ein Kind.
Und nun wehen Lerchenlieder
und es schlägt die Nachtigall,
von den Bergen rauschend wieder
kommt der kühle Wasserfall.
Rings im Walde bunt Gefieder,
Frühling ist es wieder
und ein Jauchzen überall.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
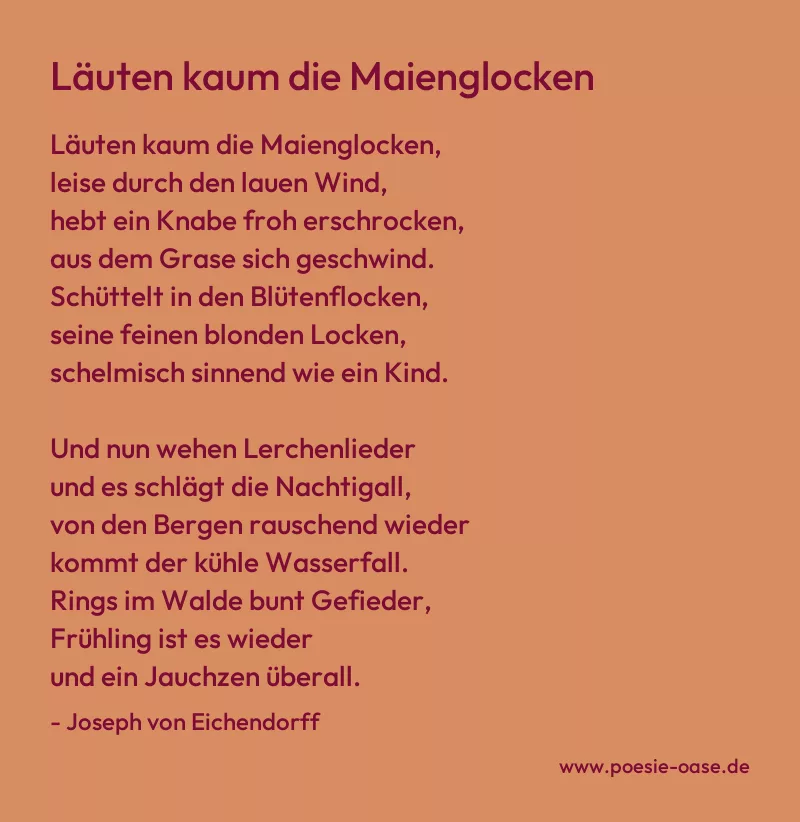
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Läuten kaum die Maienglocken“ von Joseph von Eichendorff fängt auf subtile Weise die unbeschwerte Freude und den Aufbruchsgeist des Frühlings ein. Es beginnt mit einem sanften, fast schon zarten Läuten der Maienglocken, das als akustischer Auftakt dient und eine Atmosphäre der Erneuerung und des Neubeginns schafft. Die Wahl des Wortes „kaum“ deutet auf einen flüchtigen Moment, einen zarten Beginn des Frühlings, der von einer tiefen inneren Freude erfasst wird, und spiegelt die Flüchtigkeit der Jugend und die Freude am Augenblick wider.
Der zweite Teil des Gedichts fokussiert auf die Reaktion eines Knaben, der „froh erschrocken“ aus dem Gras aufsteht. Dieser Ausdruck impliziert eine Mischung aus Freude und Überraschung, als ob der Knabe aus einem tiefen Schlaf erwacht und sich der Fülle des Frühlings bewusst wird. Das Bild des Knaben, der „seine feinen blonden Locken“ ausschüttelt, verstärkt das Bild der Jugendlichkeit und Unschuld, und das „schelmische Sinn[en] wie ein Kind“ unterstreicht die kindliche Freude und das unbeschwerte Staunen vor der Schönheit der Natur. Die Verwendung von Adjektiven wie „fein“ und „blond“ erzeugt dabei ein sinnliches Bild, welches durch die sanfte Berührung des Frühlingswinds noch verstärkt wird.
Die zweite Strophe des Gedichts erweitert die Szenerie und integriert weitere Elemente der Natur. Das Wehen der Lerchenlieder und der Gesang der Nachtigall beschreiben eine akustische Symphonie der Natur, die durch das Rauschen des Wasserfalls von den Bergen ergänzt wird. Die Beschreibung von „buntem Gefieder“ im Wald und dem „Jauchzen überall“ verdeutlicht das Erwachen des Lebens und die allgegenwärtige Freude, die den Frühling kennzeichnet. Diese Elemente verstärken das Gefühl der Lebendigkeit und des Überschwangs, das im ersten Teil des Gedichts angedeutet wurde.
Insgesamt ist das Gedicht eine Hommage an den Frühling und die unbeschwerte Freude der Kindheit. Eichendorff schafft eine harmonische Verbindung zwischen dem äußeren Naturgeschehen und der inneren Gefühlswelt des Menschen. Durch die Verwendung einfacher, aber wirkungsvoller Bilder und einer klaren, melodischen Sprache vermittelt er ein Gefühl der Leichtigkeit und des Glücks, das mit dem Erwachen der Natur einhergeht. Das Gedicht lädt den Leser ein, die Schönheit des Frühlings mit den Augen eines Kindes zu betrachten und sich von seiner erfrischenden Freude anstecken zu lassen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.