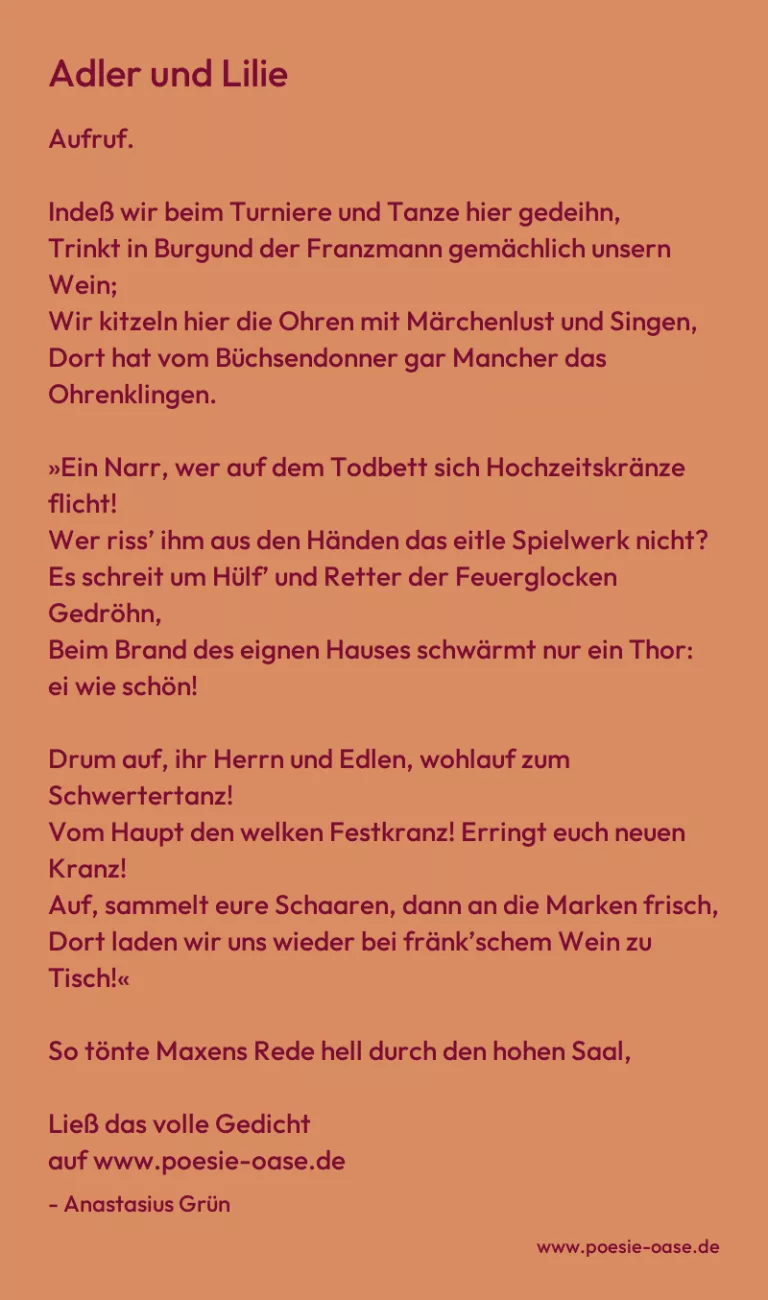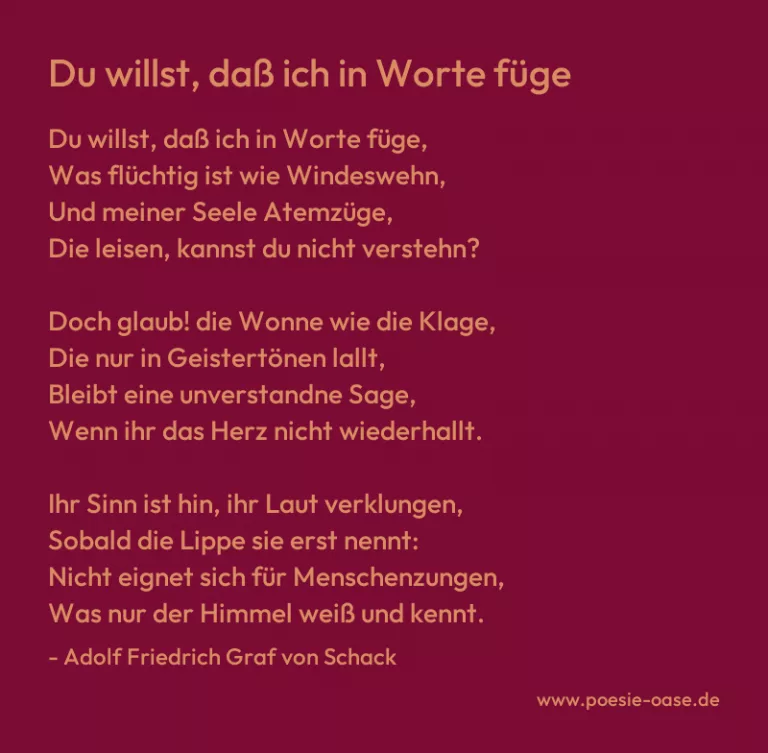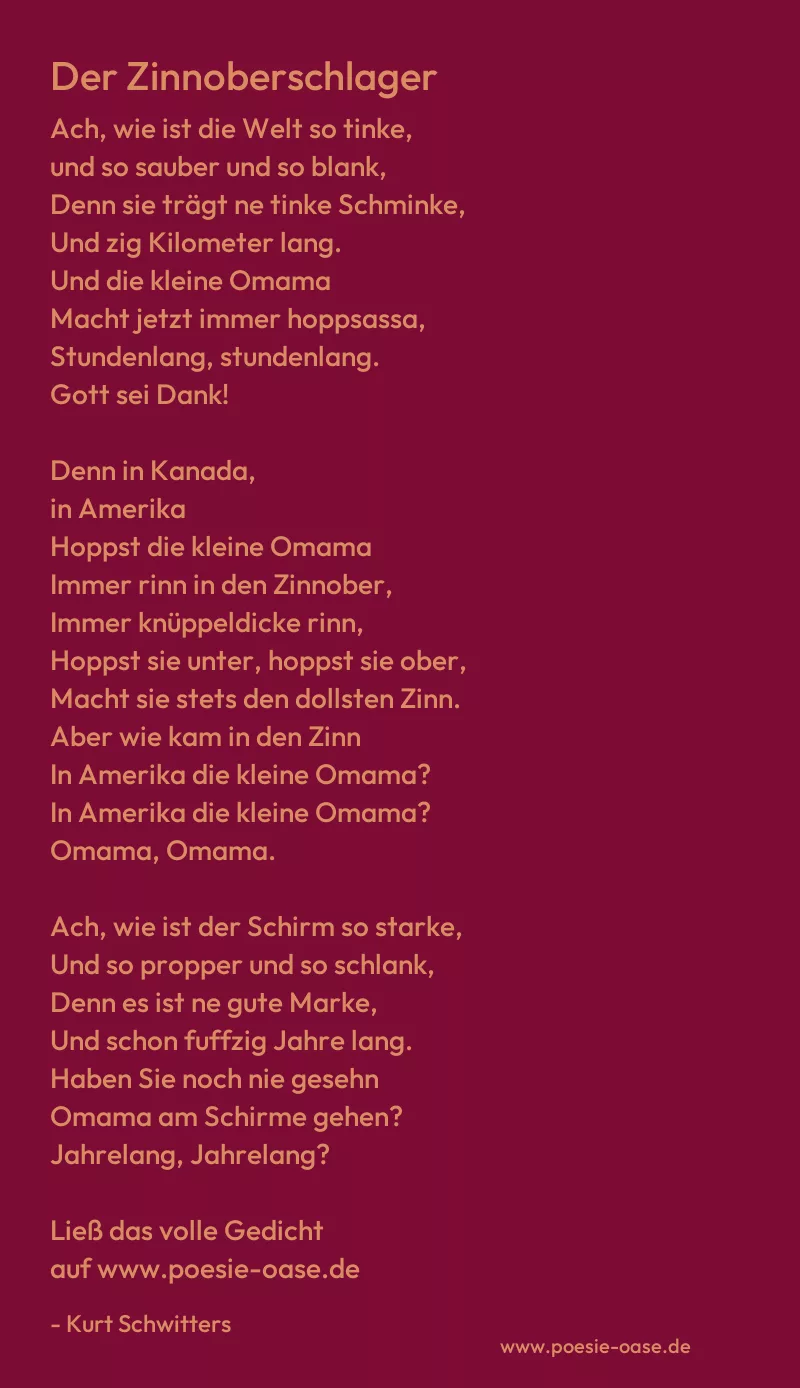Ach, wie ist die Welt so tinke,
und so sauber und so blank,
Denn sie trägt ne tinke Schminke,
Und zig Kilometer lang.
Und die kleine Omama
Macht jetzt immer hoppsassa,
Stundenlang, stundenlang.
Gott sei Dank!
Denn in Kanada,
in Amerika
Hoppst die kleine Omama
Immer rinn in den Zinnober,
Immer knüppeldicke rinn,
Hoppst sie unter, hoppst sie ober,
Macht sie stets den dollsten Zinn.
Aber wie kam in den Zinn
In Amerika die kleine Omama?
In Amerika die kleine Omama?
Omama, Omama.
Ach, wie ist der Schirm so starke,
Und so propper und so schlank,
Denn es ist ne gute Marke,
Und schon fuffzig Jahre lang.
Haben Sie noch nie gesehn
Omama am Schirme gehen?
Jahrelang, Jahrelang?
Gott sei Dank!
Denn in Kanada,
in Amerika
Geht die kleine Omama
Immer rinn in den Zinnober,
Immer knüppeldicke rinn,
Geht se unter, geht sie ober,
Macht se stets den dollsten Zinn.
Aber wie kam in den Zinn
In Amerika die kleine Omama?
In Amerika die kleine Omama?
Omama, Omama.
Dabei ist er abgebrochen,
Dieser so solide Schürm,
Hat sie in die Hand gestochen,
Denn er hat bereits den Würm.
Darum macht die Omama
Nur noch immer hoppsassa,
Stundenlang, stundenlang.
Gott sei Dank!
Denn in Kanada,
in Amerika
Hoppst die kleine Omama
Immer rinn in den Zinnober,
Immer knüppeldicke rinn,
Hoppst se unter, hoppst se ober,
Macht se stets den dollsten Zinn.
Sehn Sie, so kam in den Zinn
In Amerika die kleine Omama
In Amerika die kleine Omama?
Omama, Omama.