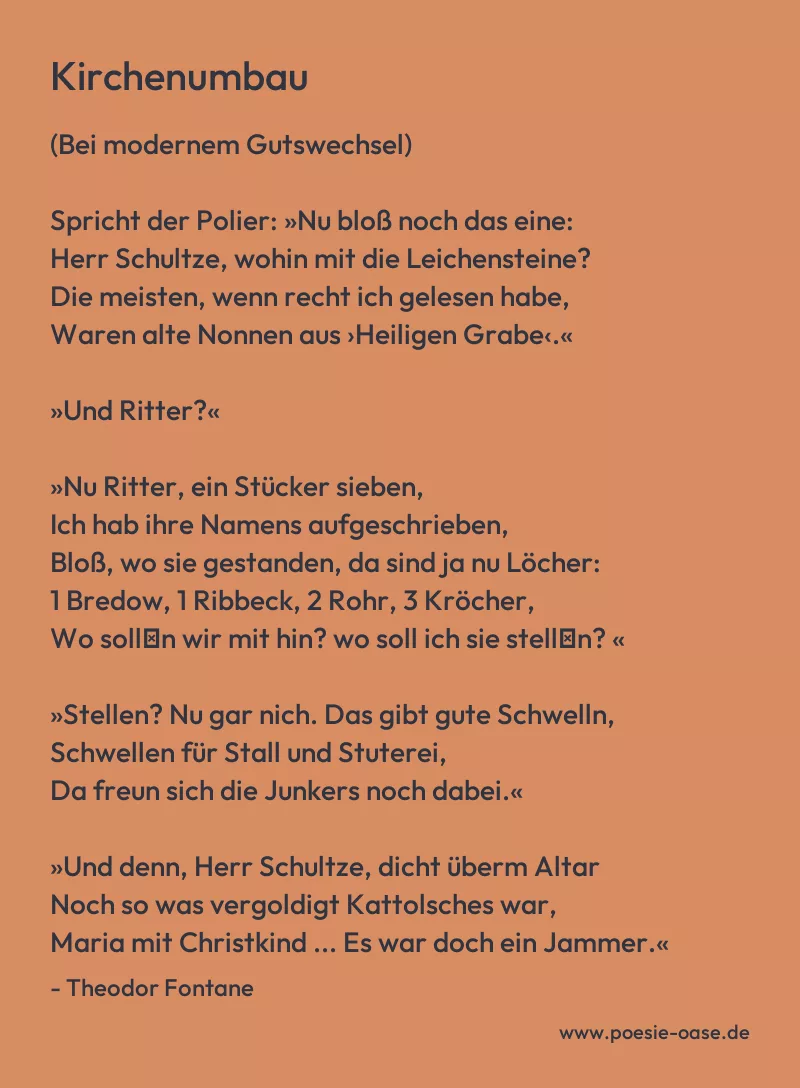Kirchenumbau
(Bei modernem Gutswechsel)
Spricht der Polier: »Nu bloß noch das eine:
Herr Schultze, wohin mit die Leichensteine?
Die meisten, wenn recht ich gelesen habe,
Waren alte Nonnen aus ›Heiligen Grabe‹.«
»Und Ritter?«
»Nu Ritter, ein Stücker sieben,
Ich hab ihre Namens aufgeschrieben,
Bloß, wo sie gestanden, da sind ja nu Löcher:
1 Bredow, 1 Ribbeck, 2 Rohr, 3 Kröcher,
Wo soll′n wir mit hin? wo soll ich sie stell′n? «
»Stellen? Nu gar nich. Das gibt gute Schwelln,
Schwellen für Stall und Stuterei,
Da freun sich die Junkers noch dabei.«
»Und denn, Herr Schultze, dicht überm Altar
Noch so was vergoldigt Kattolsches war,
Maria mit Christkind … Es war doch ein Jammer.«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
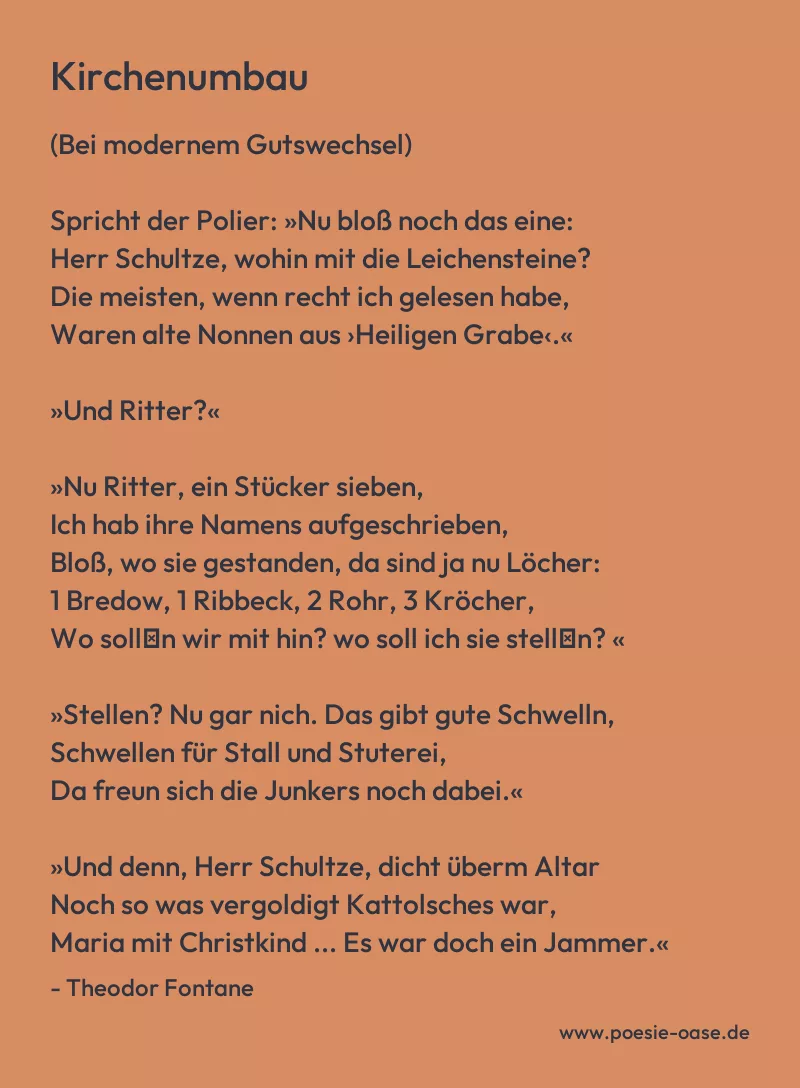
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kirchenumbau“ von Theodor Fontane ist eine bissige Satire auf den Umgang mit Tradition und Geschichte im Zuge eines Modernisierungsprozesses, der von wirtschaftlichen Interessen geleitet wird. Das lyrische Ich ist hier nicht direkt präsent, sondern der Leser wird Zeuge eines Gesprächs zwischen einem Polier und Herrn Schultze, vermutlich dem neuen Gutsherrn. Dieses Gespräch offenbart einen krassen Kontrast zwischen der pietätlosen pragmatischen Denkweise Schultzes und den historischen oder religiösen Werten, die mit den alten Grabsteinen und religiösen Artefakten verbunden sind.
Die zentralen Themen des Gedichts sind der Verlust von kultureller Identität und die Verdrängung von Tradition durch einen rein utilitaristischen Blick auf die Welt. Die Frage des Poliers nach dem Verbleib der Grabsteine und die Antwort von Herrn Schultze illustrieren dies auf eindrucksvolle Weise. Während der Polier die Frage nach dem Verbleib der Überreste der Toten stellt, scheint Schultze keinerlei Respekt vor den historischen Figuren oder den Verstorbenen zu haben. Er plant, die Grabsteine als Baumaterial für Stallungen zu verwenden, was die völlige Missachtung der Vergangenheit und ihrer Symbole verdeutlicht. Das Bild der „Junkers“, die sich über die neuen Schwellen freuen, unterstreicht ironisch die Gleichgültigkeit der neuen Elite gegenüber den alten Traditionen.
Fontanes sprachliche Gestaltung verstärkt die satirische Wirkung. Der Dialekt, in dem das Gespräch geführt wird, deutet auf eine ländliche Umgebung hin und verleiht der Szene Authentizität. Die einfachen, fast derben Formulierungen des Poliers stehen im Kontrast zu der kalten, berechnenden Sprache Schultzes, was die unterschiedlichen Perspektiven verdeutlicht. Die Nennung der Namen der Ritter, wie Bredow, Ribbeck, Rohr und Kröcher, verleiht dem Gedicht eine konkrete historische Dimension und verstärkt den Verlust, der durch die Zerstörung ihrer Grabstätten entsteht. Die Erwähnung der vergoldeten Maria mit Christkind am Ende des Gedichts verstärkt das Gefühl des Verlustes und der Missachtung des Religiösen.
Insgesamt ist „Kirchenumbau“ eine scharfe Kritik an der Zerstörung des Alten durch den Fortschritt und die Profitgier. Das Gedicht prangert die Respektlosigkeit gegenüber der Vergangenheit und den Verlust kultureller Werte an, indem es die Ignoranz und den Materialismus der neuen Gesellschaftsschicht entlarvt. Fontanes Werk ist somit nicht nur eine Beschreibung eines Umbaus, sondern auch ein Kommentar zur gesellschaftlichen Transformation und den damit verbundenen Verlusten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.