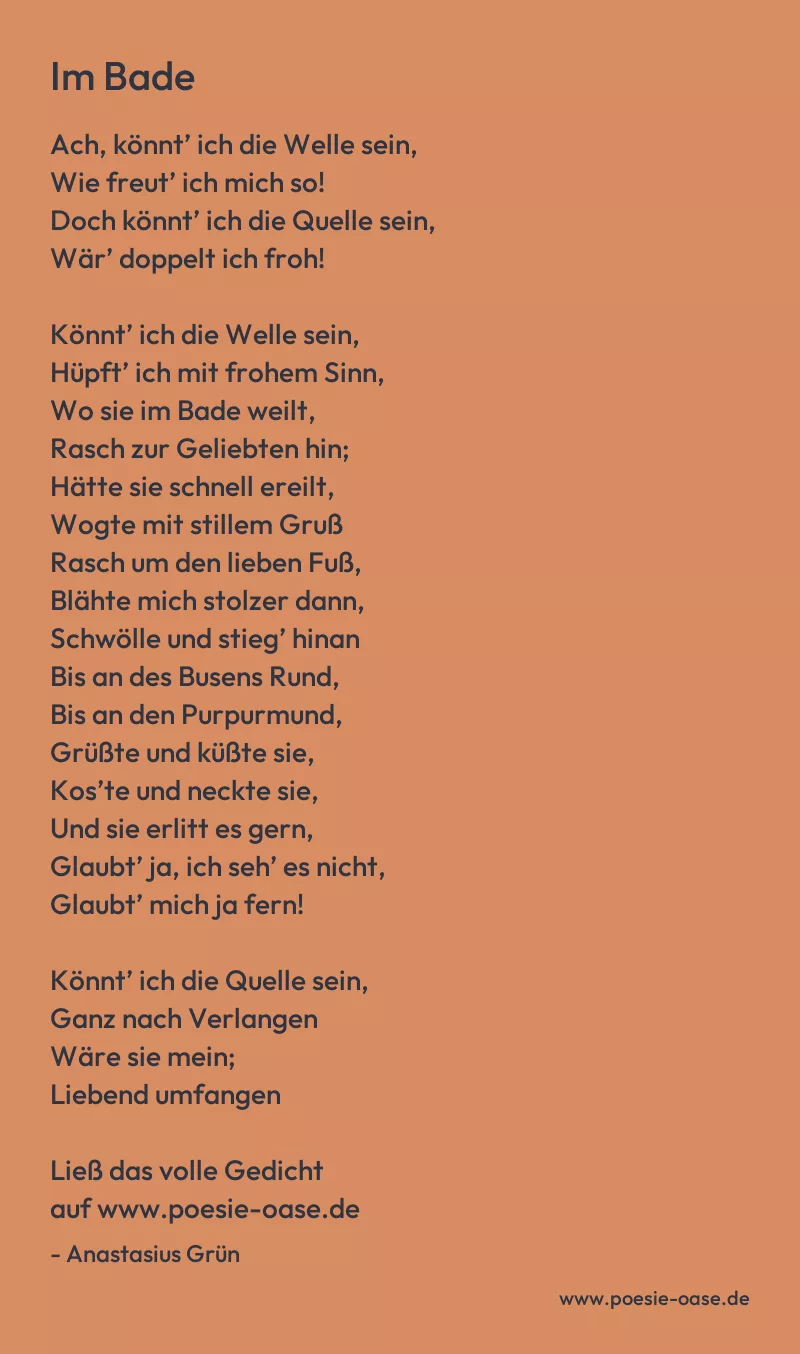Im Bade
Ach, könnt’ ich die Welle sein,
Wie freut’ ich mich so!
Doch könnt’ ich die Quelle sein,
Wär’ doppelt ich froh!
Könnt’ ich die Welle sein,
Hüpft’ ich mit frohem Sinn,
Wo sie im Bade weilt,
Rasch zur Geliebten hin;
Hätte sie schnell ereilt,
Wogte mit stillem Gruß
Rasch um den lieben Fuß,
Blähte mich stolzer dann,
Schwölle und stieg’ hinan
Bis an des Busens Rund,
Bis an den Purpurmund,
Grüßte und küßte sie,
Kos’te und neckte sie,
Und sie erlitt es gern,
Glaubt’ ja, ich seh’ es nicht,
Glaubt’ mich ja fern!
Könnt’ ich die Quelle sein,
Ganz nach Verlangen
Wäre sie mein;
Liebend umfangen
Wollt’ ich die Holde,
Aber so bald nicht
Ließ ich sie los.
Dann zu dem Herzchen
Rauscht’ ich empor,
Pochte und schlüge
Rege daran,
Pochte und früge
Liebend mich an.
Dann zu den Händen
Wogt’ ich dahin;
Aber das Ringlein,
Das sie als fremder
Seligkeit Pfand
Trägt an der kleinen
Blendenden Hand;
Wollt’ ich ihr raubend
Tief in der Wogen
Nächtliche Brandung
Heimlich verbergen;
Rauschte zur Hand dann
Wieder hinan
Und nur mein Ringlein
Ließ ich daran.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
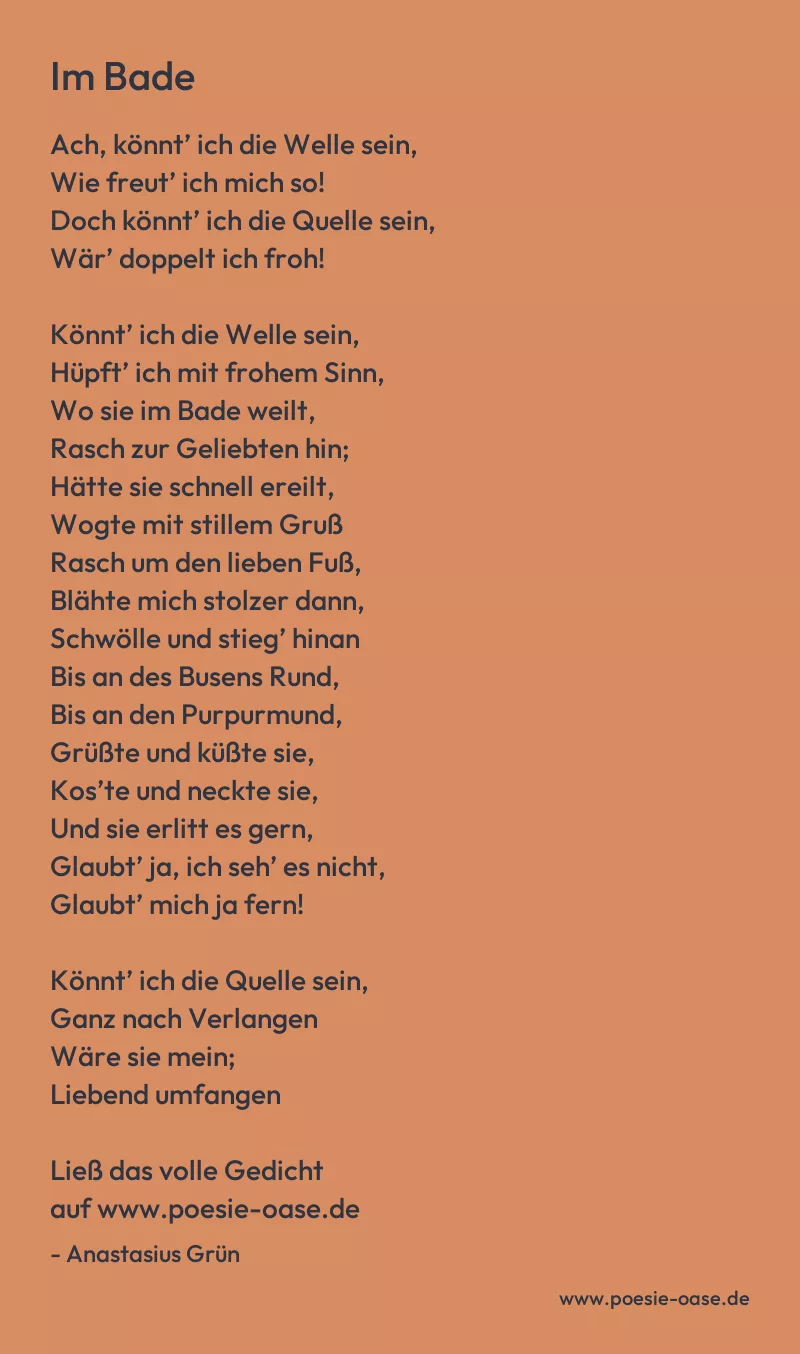
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Im Bade“ von Anastasius Grün beschreibt in zwei Strophen, durch ein Wechselspiel von Sehnsüchten, die Fantasie eines lyrischen Ichs. Die zentralen Metaphern sind die Welle und die Quelle, die beide unterschiedliche Weisen der Nähe und Vereinigung mit der geliebten Frau repräsentieren. Das Gedicht zeichnet sich durch eine romantisch-spielerische Atmosphäre aus, die von einer kindlichen Unschuld geprägt ist, welche die Intensität des Begehrens und der Fantasie des lyrischen Sprechers verdeutlicht.
Die erste Strophe ist von der Vorstellung einer Welle geprägt, die spielerisch und mit Anmut die Geliebte umspielt. Die Welle ist frei, leicht und erlaubt dem lyrischen Ich, die Geliebte zu berühren, zu küssen und mit ihr zu spielen. Die Sehnsucht nach körperlicher Nähe und der Wunsch nach einem spielerischen Umgang mit der Angebeteten stehen hier im Vordergrund. Die Fantasie ist geprägt von Unbekümmertheit und dem Wunsch, die Geliebte zu erobern und zu necken, was die unschuldige Natur der Sehnsucht des lyrischen Ichs unterstreicht.
Die zweite Strophe wechselt zur Metapher der Quelle, die eine tiefere und intime Verbindung andeutet. Die Quelle, als Ursprung des Wassers, symbolisiert die Kontrolle und das Besitzverlangen. Die Vorstellung, die Geliebte ganz für sich zu haben und sie in seinen Armen zu halten, wird hier manifestiert. Das lyrische Ich möchte die Geliebte nicht nur berühren, sondern auch ihr Herz erobern und sie für sich beanspruchen. Die Fantasie gipfelt in dem Wunsch, ein Zeichen der Verbindung, den Ring der Geliebten, zu stehlen und sie so noch fester an sich zu binden, was das Verlangen nach ewiger Zugehörigkeit impliziert.
Insgesamt ist „Im Bade“ ein Gedicht, das die romantische Vorstellungswelt des lyrischen Ichs darstellt, das zwischen dem Wunsch nach spielerischer Nähe und dem Verlangen nach intensiver Vereinigung mit der Geliebten oszilliert. Die wechselnden Metaphern der Welle und der Quelle verdeutlichen dabei die Bandbreite der Sehnsüchte und die Ambivalenz des Begehrens. Das Gedicht zeugt von der kindlichen Unschuld der romantischen Fantasie, die das Verlangen nach Liebe in all seinen Facetten widerspiegelt, von spielerischer Zuneigung bis hin zur tiefen Sehnsucht nach ewiger Verbundenheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.