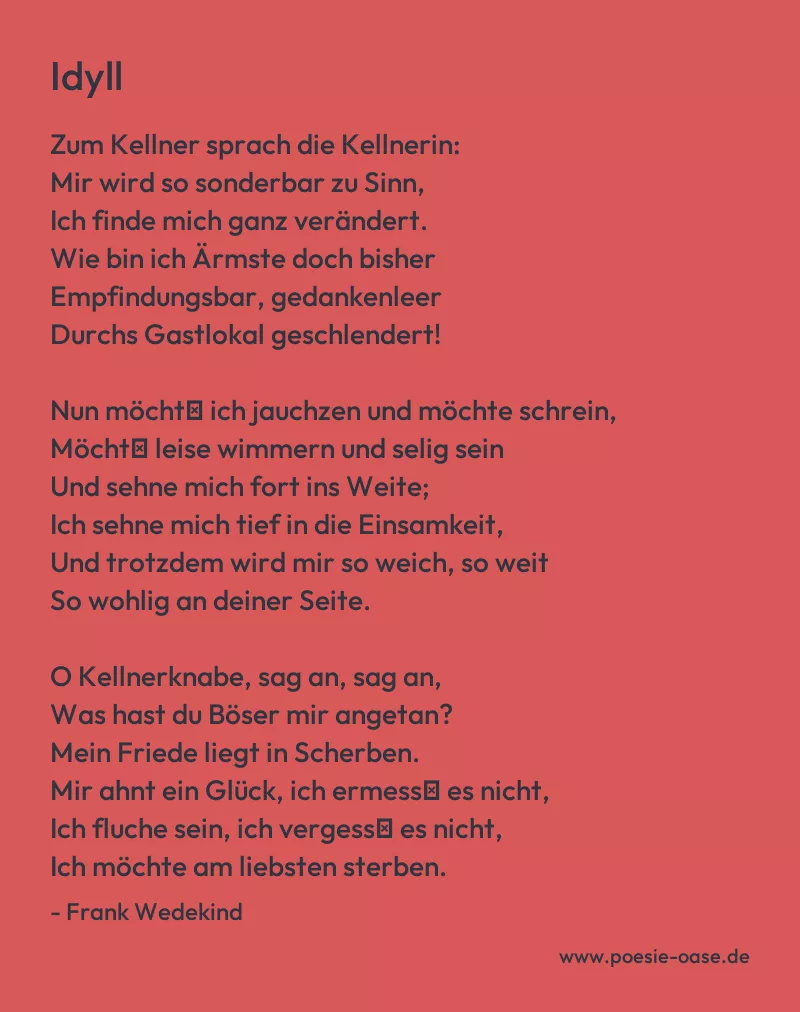Idyll
Zum Kellner sprach die Kellnerin:
Mir wird so sonderbar zu Sinn,
Ich finde mich ganz verändert.
Wie bin ich Ärmste doch bisher
Empfindungsbar, gedankenleer
Durchs Gastlokal geschlendert!
Nun möcht′ ich jauchzen und möchte schrein,
Möcht′ leise wimmern und selig sein
Und sehne mich fort ins Weite;
Ich sehne mich tief in die Einsamkeit,
Und trotzdem wird mir so weich, so weit
So wohlig an deiner Seite.
O Kellnerknabe, sag an, sag an,
Was hast du Böser mir angetan?
Mein Friede liegt in Scherben.
Mir ahnt ein Glück, ich ermess′ es nicht,
Ich fluche sein, ich vergess′ es nicht,
Ich möchte am liebsten sterben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
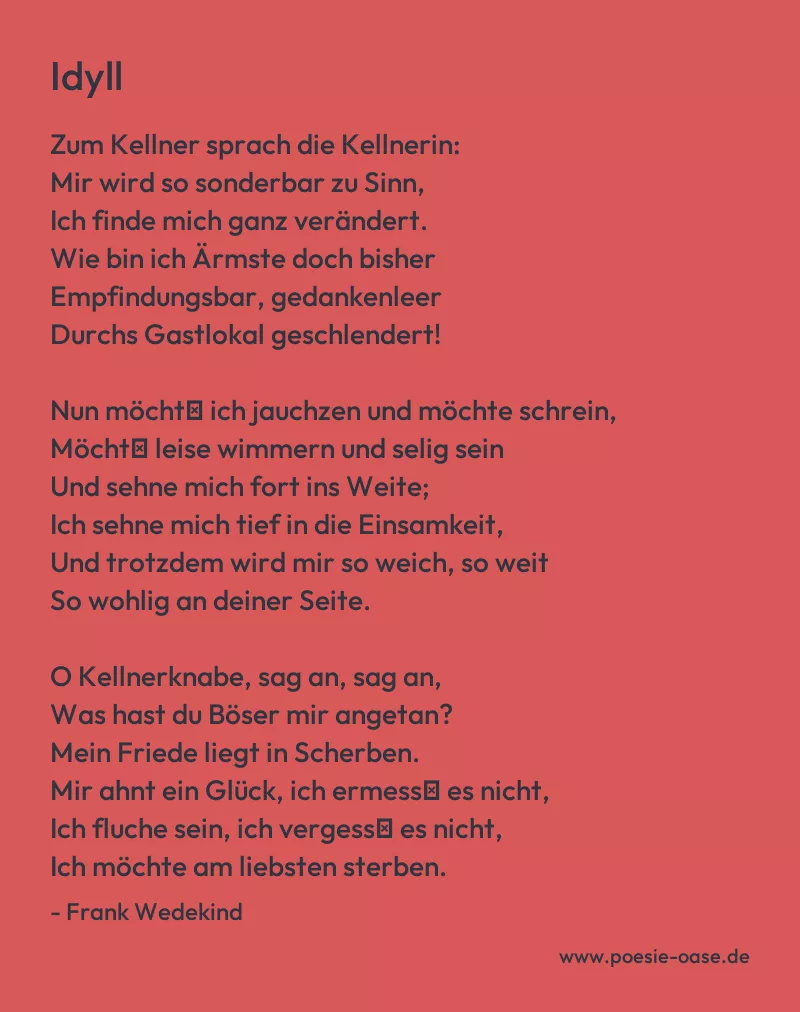
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Idyll“ von Frank Wedekind beschreibt eine plötzliche, tiefgreifende Veränderung in der Gefühlswelt einer Kellnerin, die sich unerwartet in den Kellnerknaben verliebt. Das Gedicht beginnt mit der Feststellung der Kellnerin, dass sie sich verändert fühlt. Sie erkennt, wie leer und unberührt sie zuvor durch ihr Leben im Gastlokal geschlendert ist. Diese erste Strophe etabliert den Kontrast zwischen ihrem bisherigen, unreflektierten Dasein und der nun einsetzenden emotionalen Erschütterung.
In der zweiten Strophe entfaltet sich die Bandbreite der neu entdeckten Gefühle. Die Kellnerin erlebt eine Mischung aus Euphorie und Sehnsucht, zwischen Schreien und Weinen, zwischen der Sehnsucht nach Weite und der Geborgenheit an der Seite des Kellnerknaben. Dieses Ambivalenz deutet auf die Zerrissenheit und die Komplexität der Liebe hin, die sowohl Glück als auch Leid beinhaltet. Der Gegensatz zwischen dem Wunsch nach Einsamkeit und dem Wohlgefühl in der Nähe des Geliebten verdeutlicht die Unvereinbarkeit von Freiheit und Bindung, die in der Liebe oft empfunden wird.
Die dritte Strophe ist von einer direkten Ansprache an den Kellnerknaben geprägt. Die Kellnerin wirft ihm vor, ihr Unheil angetan zu haben, und spricht von dem „Frieden, der in Scherben liegt“. Ihre Aussagen drücken die Wucht der Liebe aus, die ihr Leben verändert und ihren Zustand radikal transformiert hat. Sie beschreibt ein Glück, das sie ahnt, aber nicht fassen kann, und das sie gleichzeitig verflucht und verehrt. Der Wunsch zu sterben, symbolisiert die Intensität ihrer Gefühle, die sie an den Rand des Existenz bringens treiben.
Wedekinds „Idyll“ ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Darstellung der radikalen und widersprüchlichen Emotionen, die mit der Liebe einhergehen können. Das Gedicht zeigt auf, wie eine Person durch die Liebe aus der Routine und der Unberührtheit gerissen wird und in einen Zustand der Verwirrung und des intensiven Erlebens eintritt. Die Worte der Kellnerin spiegeln die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen wieder, von Glück bis Verzweiflung, von Sehnsucht bis zum Todestrieb.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.